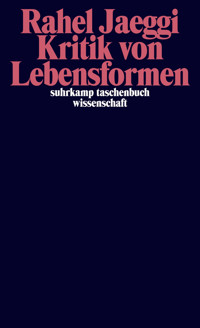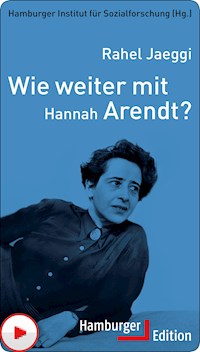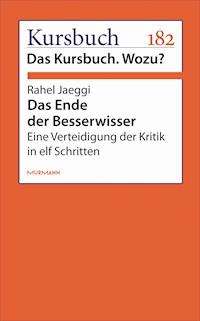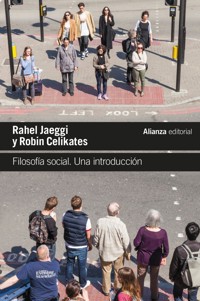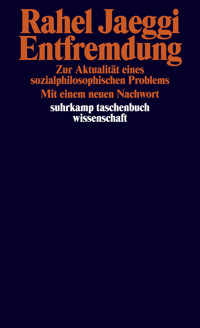
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Entfremdung bedeutet Indifferenz und Entzweiung, Machtlosigkeit und Beziehungslosigkeit sich selbst und einer als gleichgültig und fremd erfahrenen Welt gegenüber. Eine entfremdete Welt präsentiert sich dem Individuum als eine Welt, in der es nicht »zu Hause« ist. Das entfremdete Subjekt wird sich selbst zum Fremden, es erfährt sich als passives Objekt, das ihm unbekannten Mächten ausgeliefert ist. Rahel Jaeggi eignet sich diesen Schlüsselbegriff der Kritischen Theorie auf eine Weise neu an, die ohne problematische Annahmen über das Wesen des Menschen auskommt. Entfremdung ist ihr zufolge eine »Beziehung der Beziehungslosigkeit«, deren Defizite sich beschreiben und kritisieren lassen. Ein Klassiker der neueren Sozialphilosophie, der nun, versehen mit einem neuen Nachwort, erstmals als Taschenbuch erscheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
2Entfremdung bedeutet Indifferenz und Entzweiung, Machtlosigkeit und Beziehungslosigkeit sich selbst und einer als gleichgültig und fremd erfahrenen Welt gegenüber. Eine entfremdete Welt präsentiert sich dem Individuum als eine Welt, in der es nicht »zu Hause« ist. Das entfremdete Subjekt wird sich selbst zum Fremden, es erfährt sich als passives Objekt, das ihm unbekannten Mächten ausgeliefert ist.
Rahel Jaeggi eignet sich diesen Schlüsselbegriff der Kritischen Theorie auf eine Weise neu an, die ohne problematische Annahmen über das Wesen des Menschen auskommt. Entfremdung ist ihr zufolge eine »Beziehung der Beziehungslosigkeit«, deren Defizite sich beschreiben und kritisieren lassen. Ein Klassiker der neueren Sozialphilosophie, der nun, versehen mit einem neuen Nachwort, erstmals als Taschenbuch erscheint.
Rahel Jaeggi ist Professorin für praktische Philosophie/Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Suhrkamp Verlag erschien zuletzt: Kritik von Lebensformen (stw 1987).
3Rahel Jaeggi
Entfremdung
Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems
Mit einem neuen Nachwort
Suhrkamp
4Die Originalausgabe ist 2005 im Campus Verlag als Band 8 der Frankfurter Beiträge zur Soziologie und Sozialphilosophie erschienen, die von Axel Honneth im Auftrag des Instituts für Sozialforschung, Frankfurt am Main, herausgegeben wird.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der folgende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2185.
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Copyright © 2005 Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
eISBN 978-3-518-75048-3
www.suhrkamp.de
5Inhalt
Vorwort von Axel Honneth
Einleitung
I. Die Beziehung der Beziehungslosigkeit: Zur Rekonstruktion eines sozialphilosophischen Motivs
1. A stranger in the world that he himself has made – Begriff und Phänomen der Entfremdung
2. Exkurs: Marx und Heidegger – Zwei Varianten der Entfremdungskritik
3. Struktur und Problematik der Entfremdungskritik
4. Über-sich-verfügen-Können – Zur Rekonstruktion des Entfremdungsbegriffs
II. Sein eigenes als ein fremdes Leben leben: Vier Fälle
1. Seinesgleichen geschieht – Das Gefühl der Machtlosigkeit und die Verselbstständigung eigener Handlungen
2. Ein blasser, halber, fremder, künstlicher Mensch – Rollenverhalten und Authentizitätsverlust
3. Sie als nicht sie – Selbstentfremdung als innere Entzweiung
4. Wie durch eine Wand von Glas – Indifferenz und Selbstentfremdung
III. Entfremdung als gestörte Welt- und Selbstaneignung
1. Wie ein Gebilde aus Zuckerwatte – Selbstsein als Selbstaneignung
2. Sein eigenes Leben leben – Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und Authentizität
3. Schluss: Man selbst im Anderen sein – Sozialität des Selbst, Sozialität der Freiheit
Literaturverzeichnis
Nachwort zur Taschenbuchausgabe
7Vorwort
Kaum ein Begriff hat das Schaffen der ursprünglichen Kritischen Theorie stärker und mit größerer Selbstverständlichkeit bestimmt als der der »Entfremdung«. Es war erst gar nicht nötig, den terminologischen Gehalt des Begriffs festzulegen oder zu umreißen, weil er als nahezu evidenter Ausgangspunkt aller gesellschaftstheoretischen Analysen gelten konnte: So undurchschaubar die sozialen Verhältnisse auch sein sollten, sosehr sie sich auch verkompliziert haben mochten, an der Tatsache ihrer entfremdeten Gestalt bestand unter Adorno, Marcuse und Horkheimer nicht der geringste Zweifel. Aus heutiger Sicht wirkt dieser theoretische Hintergrundkonsens mehr als befremdlich; denn die Autoren, allen voran Adorno, hätten doch wissen müssen, dass der Begriff auf Prämissen beruht, die ihren eigenen Einsichten in die Fallstricke vorschneller Verallgemeinerungen und Objektivierungen widersprechen. Der Begriff der Entfremdung, in seiner sozialphilosophischen Bedeutung ganz und gar ein Produkt der Moderne, setzt bei Rousseau nicht weniger als bei Marx und seinen Erben eine Wesensbestimmung des Menschen voraus: Das, was als entfremdet diagnostiziert wird, muss sich von etwas entfernt haben, demjenigen fremd geworden sein, was als die eigentliche Natur des Menschen, seine wahre Essenz gelten kann. Die philosophische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat diesseits und jenseits des Atlantiks solchen essentialistischen Bestimmungen den Garaus gemacht; inzwischen wissen wir, dass wir auch dann, wenn wir bestimmte Universalien der menschlichen Natur gar nicht bezweifeln, von einem »Wesen« des Menschen, seinen »Gattungskräften« und originären Zielsetzungen nicht mehr in einem objektivistischen Sinn reden dürfen. Eine Folge dieser theoretischen Selbstkorrektur war das Verschwinden der Entfremdungskategorie aus der lebendigen Umgangssprache der Philosophie. Und in nichts mag sich die Gefahr des Veraltens der Kritischen Theorie deutlicher bekunden als im Ersterben ihres einstigen Schlüsselbegriffs.
Gleichwohl hat es in den letzten Jahren nicht wenige gegeben, denen unserem philosophischen Vokabular etwas zu fehlen schien, wenn ihm der Begriff der Entfremdung nicht mehr zur Verfügung steht. Häufig kommen wir kaum umhin, individuelle Formen des 8Lebens als entfremdet zu beschreiben, nicht selten neigen wir dazu, gesellschaftliche Zustände nicht deswegen als verfehlt, als falsch zu betrachten, weil sie Prinzipien der Gerechtigkeit verletzten, sondern weil sie Bedingungen unseres Wollens und Könnens widersprechen. In derartigen Reaktionsformen auf Zustände unserer sozialen Umwelt scheinen wir auch dann unweigerlich stets wieder auf den Begriff der Entfremdung zurückzugreifen, wenn wir um seine essentialistischen Gefährdungen wissen; so veraltet die Rede von der Entfremdung auch sein mag, aus unserem diagnostischen, kritischen Vokabular ist sie offensichtlich nicht einfach wegzudenken. Die vorliegende Studie lässt sich als philosophische Verteidigung dieses unabgegoltenen Rechts der Entfremdungskategorie begreifen. Sie verfolgt die Absicht, den sozialphilosophischen Gehalt des gescholtenen Begriffs für die Gegenwart zu retten.
Über die Schwierigkeiten, die ein solches Unterfangen mit sich bringen muss, ist sich die Autorin, Rahel Jaeggi, vollends im Klaren. Es bedarf bei einer Aktualisierung der Entfremdungskategorie ja nicht nur des begrifflichen Geschicks, ihren Bedeutungsgehalt so zu explizieren, dass er auch ohne essentialistische Voraussetzungen unverkürzt zur Geltung gelangen kann. Vielmehr muss darüber hinaus auch gezeigt werden, dass es für eine kritische Diagnose der Bedingungen unseres Zusammenlebens tatsächlich unverzichtbar ist, vom Begriff der Entfremdung Gebrauch zu machen. Bei der Bewältigung der ersten Aufgabe kommt der Autorin die Tatsache entgegen, dass sie sowohl mit der klassischen Ideengeschichte des Entfremdungsbegriffs als auch mit den neueren, analytisch geprägten Diskussionen um die Konturen menschlicher Personalität und Freiheit gleichermaßen vertraut ist. Diese Kombination von Kenntnissen in zwei bislang eher getrennt gehaltenen Wissenssphären erlaubt es ihr, an dem klassischen Entfremdungsbegriff exakt die Stellen zu identifizieren, an denen durch den Einsatz formalerer Begriffe menschlicher Fähigkeiten die essentialistischen Konsequenzen vermieden werden können. In Hinblick auf die zweite Aufgabe kommt der Autorin zu Hilfe, dass sie über eine große Gabe zur phänomenologischen Vergegenwärtigung alltäglicher Lebenszusammenhänge verfügt. Diese Befähigung ermöglicht es ihr, bestimmte Szenerien menschlichen Verhaltens des Erstarrens, des Selbstverlustes oder der Vergleichgültigung so plastisch als Entfremdungsphänomene zu schildern, dass wir als Leser oder Leserin nachgerade genötigt 9werden, nach Möglichkeiten einer Wiedergewinnung des verpönten Begriffs zu suchen. Mit der Benennung dieser beiden Argumentationsquellen sind Strategie und Anlage der vorliegenden Studie umrissen: Während es in einem Vorlauf darum geht, die Tradition des Entfremdungsbegriffs historisch so zu vergegenwärtigen, dass mit den kategorialen Stärken zugleich auch die essentialistischen Voraussetzungen durchsichtig werden, soll im Hauptteil anhand der Schilderung von Typen individuellen Sich-selbst-Entfremdens das analytische Potential der neueren Bestimmungen menschlicher Freiheit dazu genutzt werden, einen vom essentialistischen Makel befreiten Begriff der Entfremdung zu etablieren.
Wie deutlich und klar Rahel Jaeggi die Schwierigkeiten vor Augen hat, mit denen der klassische Begriff der Entfremdung behaftet war, zeigt ihre historische Vergegenwärtigung in souveräner Übersichtlichkeit. Hier werden mit Mut zur pointierten Darstellung im Ausgang von Rousseau die zwei Traditionslinien skizziert, auf denen die Pathologien des modernen Lebens mehr oder weniger ausdrücklich stets als Vorgänge der Entfremdung analysiert wurden: Bei Marx und seinen Erben, die gemeinsam an Hegel anschließen, wird dabei unter »Entfremdung« die sozialstrukturell, zumeist ökonomisch erzwungene Verhinderung einer Aneignung der menschlichen Gattungskräfte verstanden, bei Kierkegaard und Heidegger hingegen, der »existentialistischen« Linie, die wachsende Verunmöglichung der Rückkehr aus dem Allgemeinen in die selbstgewählte, authentische Individualität. In beiden Fällen wird, so heißt es bei Rahel Jaeggi prägnant, als Kern aller Entfremdung begrifflich eine »Beziehung der Beziehungslosigkeit« ausgemacht, nämlich ein mangelndes, gestörtes Verhältnis zu dem Verhältnis, in dem als Kooperation oder als Selbstbezug die eigentliche Natur des Menschen besteht. Von hier aus ist leicht zu erkennen, inwiefern sowohl in der marxistischen als auch in der existentialistischen Tradition eine objektivistische Bestimmung des menschlichen Wesens die normative Grundlage der Entfremdungsdiagnose bildet: Dort als Arbeitsbeziehung gedacht, hier als eine spezifische Form der Innerlichkeit gefasst, soll ein solches vorgängiges Verhältnis des Menschen in der Entfremdung so weit aus dem Blick geraten sein, dass es in die eigene Lebenspraxis nicht mehr zurückgeholt werden kann.
Mit diesem Einblick in die Architektonik des klassischen Entfremdungsbegriffs im Rücken unternimmt Rahel Jaeggi nun im 10Hauptteil ihrer Studie den Versuch, in der Durchmusterung einzelner, glänzend porträtierter Fälle von Entfremdung ein alternatives Beschreibungsmuster zu entwickeln, das ohne die starke, substantielle Auszeichnung einer einzigen Strebensnatur des Menschen auszukommen hat. Die Möglichkeiten einer solchen sparsamen Fundierung erblickt sie in der Aufnahme von Elementen einer Freiheitskonzeption, die an den Funktionsbedingungen des menschlichen Wollens und Könnens ansetzt; was dazu in einer weitgespannten, untergründigen Diskussion zwischen Harry Frankfurt und Ernst Tugendhat, Thomas Nagel und Charles Taylor in den letzten beiden Jahrzehnten herausgearbeitet worden ist, macht sich Rahel Jaeggi zu Eigen, um es für ihre Grundlegung des Entfremdungsbegriffs zu verwenden. Das Ergebnis dieser ungemein fruchtbaren, die Studie wie eine zweite Argumentationsebene durchziehende Aufarbeitung ist die These, dass Entfremdung eine Beeinträchtigung unseres Wollens bedeutet, die aus der Verunmöglichung der Aneignung, des Sich-zu-eigen-Machens des eigenen Selbsts oder der Welt resultiert. Ist damit das Schwergewicht des Entfremdungsbegriffs zunächst erst einmal auf die Dimension der individuellen Selbstbeziehung verlagert, so deutet Rahel Jaeggi im letzten Schritt ihrer Arbeit allerdings an, wie von hier aus der notwendige Übergang zur Gesellschaftsanalyse zu bewerkstelligen wäre: Häufig haben Beeinträchtigungen von Aneignungsvollzügen, wie sie in der Vergleichgültigung gegenüber zugewachsenen Rollen oder der mangelnden Identifikation mit den eigenen Wünschen zum Ausdruck gelangen, ihre Ursache in sozialen Verhältnissen, die die notwendigen Bedingungen für solche Aneignungen nicht erfüllen.
Auf diese Weise werden in dem vorliegenden Buch die Wege abgesteckt, auf denen es möglich ist, durch Formalisierung des normativen Bezugssystems einen gehaltvollen Begriff der Entfremdung zurückzugewinnen. Wer den damit gesetzten Hinweisen folgt, wird feststellen, dass es nicht einen Rückfall in einen verstaubten Essentialismus bedeuten muss, wenn innerhalb der Gesellschaftskritik in Zukunft wieder in diagnostischer Absicht von Entfremdungsphänomenen die Rede ist. Für das Institut für Sozialforschung stellt es daher zugleich eine Genugtuung und theoretische Ermunterung dar, die Arbeit von Rahel Jaeggi in die eigene Reihe aufnehmen zu können.
Axel Honneth
Frankfurt am Main, 1. September 2005
11Einleitung
»Yet another work on alienation?«[1] So oder so ähnlich begannen noch zu Beginn der 1980er Jahre angesichts einer überbordenden Literatur viele Bücher zum Thema »Entfremdung«. Die Lage stellt sich heute anders dar. Der Begriff der Entfremdung scheint problematisch und in mancher Hinsicht beinahe unzeitgemäß geworden zu sein. War er lange Zeit Zentralbegriff linker (aber auch konservativer) Gesellschaftskritik, entscheidendes Motiv der Marx’schen Sozialphilosophie und damit prägend für den »westlichen Marxismus« und die »Kritische Theorie«, wirksam andererseits auch in verschiedenen Varianten existentialistisch inspirierter Zeitkritik, so ist »Entfremdung« heute nicht nur aus der philosophischen Literatur nahezu verschwunden. Auch als zeitdiagnostische Vokabel spielt »Entfremdung« kaum noch eine Rolle. Zu inflationär war der Gebrauch des Entfremdungsbegriffs in den Zeiten seiner Hochkonjunktur geworden, zu überkommen scheinen seine philosophischen Grundlagen im Zeitalter der »Postmoderne«, zu fragwürdig seine politischen Konsequenzen in dem des »politischen Liberalismus« – und vielleicht auch zu aussichtslos das Anliegen der Entfremdungskritik im Zeichen des siegreichen Kapitalismus.
Das Problem der Entfremdung allerdings, so scheint es, ist immer noch – vielleicht auch: wieder – gegenwärtig. Angesichts neuerer ökonomischer und gesellschaftlicher Entwicklungen artikuliert sich in wachsendem Maße eine Beunruhigung, die sich, wenn nicht dem Namen, so doch der Sache nach, mit dem Phänomen der Entfremdung in Verbindung bringen lässt. Die große Beachtung, die Richard Sennetts Buch Der flexible Mensch mit seiner These gefunden hat, der »flexible Kapitalismus« bedrohe die Identität des Einzelnen und den sozialen Zusammenhang der Gesellschaft, die zunehmend laut werdenden Bedenken gegenüber Tendenzen einer Vermarktlichung oder »Kommodifizierung« immer größerer Lebensbereiche[2] und auch die neu entstandenen Pro12testbewegungen gegen den Kontrollverlust und die Machtlosigkeit angesichts einer sich globalisierenden Ökonomie[3] sind Anzeichen für eine wiedererwachende Sensibilität gegenüber Phänomenen, die man im Zusammenhang der oben erwähnten Theoriebildung mit den Begriffen »Entfremdung« oder »Verdinglichung« charakterisiert hatte. Und auch wenn im »neuen Geist des Kapitalismus« (vgl. Boltanksi/Chiapello 2003) die Entfremdungskritik auf geradezu zynische Weise aufgehoben zu sein scheint – realisiert sich in den vielfältigen Anforderungen an den flexibel-kreativen, modernen »Arbeitskraftunternehmer«, für den es zwischen Arbeit und Freizeit keine Grenze mehr gibt, nicht die Marx’sche Utopie des »allseitig entwickelten« Menschen, der »morgens fischen, mittags jagen, abends kritisieren« kann? –, so verweisen die Ambivalenzen einer solchen Entwicklung eher auf die Resistenz des Problems als auf sein Verschwinden.[4]
Gibt es also keine Entfremdung mehr, oder verfügen wir nur nicht mehr über ihren Begriff? Angesichts der sich immer wieder erneuernden Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen dem gesellschaftlichen Versprechen auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung und seiner defizitären Einlösung, so die Diagnose Robert Misiks[5], bleibt das Thema »Entfremdung« virulent, selbst wenn der feste Bezugspunkt ihrer Kritik verloren gegangen zu sein scheint.
Die vorliegende Untersuchung zielt auf eine Vergegenwärtigung des Entfremdungsbegriffs als sozialphilosophischer Grundbegriff. Mein Ausgangspunkt ist dabei ein zweifacher: Einerseits bin ich der Überzeugung, dass der Entfremdungsbegriff ein philosophisch gehaltvoller und produktiver Begriff ist, mit dem sich Phänomenbe13reiche erschließen lassen, die man nur um den Preis der Verarmung theoretischer Ausdrucks- und Deutungsmöglichkeiten umgehen kann. Andererseits lässt sich meines Erachtens nach an die Theorietradition, mit der der Entfremdungsbegriff assoziiert ist, nicht unbefangen anknüpfen: Zu Recht sind die mit dieser Tradition gesetzten Annahmen problematisiert worden. Ein Anschluss an die Entfremdungsdiskussion erfordert deshalb eine kritische Rekonstruktion ihrer konzeptuellen Grundlagen.
Dieses Buch ist der Versuch einer solchen Rekonstruktion. Eine Rekonstruktion ist es damit in doppelter Hinsicht: Einerseits gilt es, den Entfremdungsbegriff überhaupt in seiner Bedeutung zu vergegenwärtigen. Andererseits muss dieser auf dem Hintergrund der sich hier andeutenden Probleme systematisch neu interpretiert und begrifflich transformiert werden. Damit geht es um die philosophische Wiederaneignung eines Theorems, das aus vielerlei Gründen problematisch geworden ist – und um den Versuch einer Wiedergewinnung seines Erfahrungsgehalts.[6]
Gezielt wird hier also weder auf eine zeitdiagnostisch verfahrende Reaktualisierung des Entfremdungsproblems noch auf einen theorieimmanenten Anschluss an die entfremdungstheoretische Diskussion. Was ich dagegen versuche, ist eine kategoriale Analyse der Grundbegriffe bzw. der Voraussetzungen, die dem Deutungsmuster der Entfremdung in seinen verschiedenen Ausprägungen zugrunde liegen. So setzt die Entfremdungsdiagnose Annahmen über die Struktur menschlicher Selbst- und Weltverhältnisse, die Beziehung von Akteuren zu sich selbst, zu ihren eigenen Handlungen und zur sozialen wie natürlichen Welt und damit ein komplexes und dichtes Bild der Person in ihren Relationen zur Welt voraus. Es sind diese Annahmen, und damit die philosophisch-anthropologischen Grundlagen des Entfremdungsbegriffs, die schon auf begrifflicher Ebene klärungsbedürftig sind und bei denen es anzusetzen gilt.
Was nämlich bedeutet es, dass man im Verhältnis zu sich auf verschiedene Weise mit sich entzweit sein kann? Wie ist es zu verstehen, dass einem die eigenen Handlungen als »fremde« gegenübertreten können? Und wie ist das Subjekt verfasst, das in der Weise mit der Welt verbunden ist, dass es sich von sich entfremdet, 14wenn ihm dieser Bezug verloren geht? Um diese Fragen soll es im Folgenden gehen. Schon hier bedarf es allerdings einer Klarstellung: Wenn im Zentrum meiner Analyse die vielfältigen Formen stehen werden, in denen Individuen sich »von sich selbst« entfremden können, so soll das ausdrücklich nicht bedeuten, dass Entfremdung hier als ein auf das Selbstverhältnis reduzierbares subjektives Problem verstanden wird. Ein Missverständnis, dem Hannah Arendts Kritik an Marx unterliegt, ist hier instruktiv: Findet sich in Arendts Vita Activa die Bemerkung, Weltentfremdung, nicht, wie Marx geglaubt habe, Selbstentfremdung sei das wirkliche Problem moderner Gesellschaften, so handelt es sich hier um eine glatte – wenn auch in mancher Hinsicht produktive – Fehldeutung:[7] Bei Marx ist (wie bei Arendt auch) die Entfremdung von sich mit der Entfremdung von der dinglichen und sozialen Welt untrennbar verbunden; es ist gerade die Unmöglichkeit, sich die »Welt« als Resultat der eigenen Tätigkeit anzueignen, die Entfremdung ausmacht. Weltentfremdung bedeutet also Selbstentfremdung und umgekehrt, das Subjekt ist »von sich« entfremdet, weil es von der Welt entfremdet ist – und es ist genau dieser Zusammenhang, der den Begriff interessant macht. Der Ansatz bei der »Selbstentfremdung« schließt also immer auch das Verhältnis ein, welches das Subjekt zu den unterschiedlichen Dimensionen der »Welt« hat. Die Differenz ist also eine der Perspektive, nicht des Gegenstandsbereichs.
Wenn es sich so als Pointe der entfremdungstheoretischen Perspektive herausstellen wird, dass »sein eigenes Leben zu leben« bedeutet, sich auf bestimmte Weise mit sich und der Welt identifizieren, sich diese »aneignen« zu können, ist damit auch ein Unterschied zum geläufigen, häufig kantisch verstandenen Autonomiebegriff markiert, dem die Welt im positiven wie im negativen Sinn »nichts anhaben« kann. Der für die Entfremdungskritik entscheidende Ansatz, qualitativ auf Selbst- und Weltverhältnisse von Individuen zu zielen, gelingende von gestörten oder defizitären Selbst- und Weltverhältnissen unterscheiden zu wollen, eröffnet dabei den Weg für eine Kritik derjenigen sozialen Institutionen, in denen Individuen ihr Leben führen. Diese Kritik überschreitet die liberal-gerechtigkeitstheoretische Perspektive auf das rechtlich geregelte »Aneinandervorbei« der Individuen, ohne dabei auf sub15stantielle Konzepte des Selbst und der Gemeinschaft Bezug nehmen zu müssen.[8] Die Thematisierung des Entfremdungsproblems steht so für die Idee einer »qualitativ anderen Gesellschaft« (Herbert Marcuse), Entfremdungskritik ist immer schon verbunden mit der Frage danach, »wie wir leben wollen«. »Negativistisch« im Ansatz, thematisiert der Entfremdungsbegriff dabei nicht nur, was uns daran hindert, gut zu leben, sondern vor allem auch, was uns daran hindert, die Frage danach, wie wir leben wollen, auch nur angemessen zu stellen.
Schon vor dem Einstieg in eine detailliertere Diskussion lassen sich mehrere Dimensionen des Entfremdungsproblems unterscheiden:
– Als ethisches Problem verweist Entfremdung auf eine Dimension des verfehlten Lebens einzelner Individuen. In diesem Fall droht das mit dem Entfremdungsmotiv verbundene »Lebensgefühl der Gleichgültigkeit und Indifferenz« die Frage nach dem guten Leben überhaupt zu untergraben.[9] Die mit Entfremdung assoziierte innere Entzweiung und das »Gefühl der Machtlosigkeit«, so die Diagnose, affizieren die Bedingungen personaler Autonomie in ihrem Kern.
– Ein sozialphilosophischer Schlüsselbegriff ist Entfremdung (seit Rousseau), sofern sich mit ihm »soziale Pathologien«, also Beeinträchtigungen der »überindividuellen Bedingungen für individuelle Selbstverwirklichung« diagnostizieren lassen.[10] Entfremdet (oder entfremdend) ist demnach eine gesellschaftliche Lebensform, mit der der Einzelne sich nicht identifizieren, in der er sich nicht »verwirklichen«, die er sich nicht »zu Eigen« machen kann.
– Als gesellschaftstheoretischer Grundbegriff hingegen fungiert Entfremdung nicht nur als diagnostische, sondern als analy16tisch-explanatorische Kategorie, Schlüssel zum Verständnis der Funktionsweise bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften. So beschreibt Marx (noch wo er sich von der anthropologischen Stoßrichtung der Frühschriften gelöst hat) die »bürgerliche Ökonomie« nach dem Muster eines Entfremdungsgeschehens.[11]
Wenn ich im Folgenden an die sozialphilosophische Dimension des Entfremdungsbegriffs anknüpfen möchte, so wird dadurch gegenüber der bloß ethischen Dimension (mit der dieser, wie zu sehen sein wird, gleichwohl verschränkt ist) die Perspektive auf die sozialen Beziehungen betont, in denen Individuen ihr Leben führen. Entfremdung ist in diesem Sinne ein sozialphilosophischer Begriff par excellence, sofern mit dem Deutungsmuster der Entfremdung eine Perspektive gesetzt ist, in der Selbst- und Weltverhältnis, individueller Selbstbezug und überindividuelle Lebensform schon konzeptuell miteinander verschränkt sind. Es ist dieser Zug der Entfremdungsdiskussion – und seine Konsequenzen für die Analyse »sozialer Pathologien« –, den ich für anschlussfähig halte. Wo Entfremdung als analytisches, die Gesellschaft erklärendes Konzept zu schmal und überdies in seiner Mischung von deskriptiven und normativen Aspekten ungeklärt ist, können so im Anschluss an die sozialphilosophische Bedeutung des Begriffs Maßstäbe zur Diagnose gesellschaftlicher Fehlentwicklungen gewonnen werden. Dass andererseits der sozialphilosophische Aspekt mit dem ethischen aufs Engste verbunden ist, liegt auf der Hand: Es sind die Voraussetzungen des guten menschlichen Lebens, die hier auf dem Spiel stehen, und es ist das Gelingen dieses Lebens, an dem soziale Pathologien gemessen werden.
Wenn es hier – im Anschluss an die Motivlage der älteren Kritischen Theorie – immer schon um die gerechte und die gute Gesellschaft, um Freiheit und Glück, um Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung geht, so liegt die Produktivität der von der Entfremdungsthematik geleiteten Sichtweise darin, dass sich mit ihr einige der heute diskussionsbeherrschenden Dichotomien in 17Frage stellen lassen und Dimensionen in den Blick geraten, die sonst verstellt sind. Auch darin liegt der Reiz, an die Potentiale der mit dem Entfremdungsbegriff umschriebenen Tradition in systematischer Perspektive anzuknüpfen.
Aufbau und Vorgehen
Meine Untersuchung gliedert sich in drei Hauptteile. Der erste Teil soll das mit dem Begriff der Entfremdung umschriebene Problemfeld in historisch-systematischer Perspektive entfalten. Orientiert an der alltagssprachlichen wie der philosophischen Verwendung des Begriffs werden Gehalt und Problematik des Entfremdungsmotivs erkundet und ein Rekonstruktionsvorschlag skizziert. Der zweite Teil führt unter dem Titel »Sein eigenes als ein fremdes Leben leben« diesen Rekonstruktionsvorschlag am Verhältnis der »Selbstentfremdung« durch. Den vier Kapiteln dieses Teils liegt jeweils eine Situationsbeschreibung zugrunde, anhand derer sich je verschiedene Dimensionen von Entfremdung darstellen und analysieren lassen. Was man so als eine Art von »Phänomenologie«[12] der Entfremdung (oder auch als Mikroanalyse von Entfremdungsphänomenen) verstehen kann, soll den Ausgangspunkt liefern für die konzeptuelle Rekonstruktion des Begriffs.
Der dritte Teil, »Entfremdung als verhinderte Welt- und Selbstaneignung«, zieht die systematischen Konsequenzen aus diesen Analysen und integriert sie in eine Gesamtdeutung des Entfremdungsproblems, wie es sich in Auseinandersetzung mit Begriffen wie Freiheit, Emanzipation, Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung darstellt, um schließlich auf den Zusammenhang von Selbstentfremdung und sozialer Entfremdung einzugehen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Lektüre dieses Buches: Wer den direkten Problemeinstieg sucht, kann mit dem zweiten, phänomenorientierten Teil beginnen, um sich den im ersten Teil entwickelten Rekonstruktionsansatz sowie den Traditionsbezug nachträglich zu erschließen. Der dritte Teil wiederum sollte als Auswertung und Systematisierung der Phänomenanalysen soweit aus sich heraus verständlich sein, dass man die Bezüge zur entfrem18dungstheoretischen Diskussion des ersten Teils herstellen kann, aber nicht muss.
Dieses Buch ist die überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die ich im Juli 2001 am Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main eingereicht habe.
Zu danken habe ich vor allem Axel Honneth, der mich von Beginn an zu diesem Unternehmen ermutigt und in den verschiedenen, nicht immer einfachen Phasen der Ausarbeitung motiviert und unterstützt hat. Der Zusammenarbeit mit ihm verdankt diese Arbeit mehr Impulse, als ich im Einzelnen ausweisen könnte. Gustav Falke war der vermutlich wichtigste Gesprächspartner in der Konzeptionsphase des Projekts, Martin Löw-Beer in einem schwierigen Moment entscheidend für seine Fertigstellung. Rainer Forst, Martin Saar und Stefan Gosepath waren während dieser Zeit Kollegen, auf deren Zusammenarbeit, Hilfe und Freundschaft ich immer setzen konnte. Mit Werner Konitzer führe ich seit Jahren Gespräche im Umfeld des Entfremdungsproblems. Undine Eberlein und Helmuth Fallschessl danke ich für das Lesen der ersten Fassung und die vielen skeptischen Bemerkungen an den linken und rechten Seitenrändern. Auch Martin Frank und Arnd Pollmann haben sich der undankbaren Aufgabe unterzogen, früh den noch sehr fragmentarischen Entwurf zu kommentieren. Martin Saar, Ina Kerner und Carolin Emcke danke ich darüber hinaus für die entschlossene Rettungsaktion in der bemerkenswerten Nacht vor der Abgabe der Arbeit bei der Promotionskommission in Frankfurt. Emmanuel Renault für sein Interesse und seine hilfreichen Hinweise ganz zum Schluss.
Christoph Menke möchte ich für die Bereitschaft danken, als Gutachter am Dissertationsverfahren mitzuwirken, Seyla Benhabib für die Einladung nach Yale im akademischen Jahr 2002/2003 und für die Impulse, die aus unserem gemeinsamen Seminar über zeitgenössische Kritische Theorie für die Überarbeitung des Manuskriptes hervorgegangen sind. Jan-Phillip Reemtsma und der Hamburger Stiftung für Wissenschaft und Kultur habe ich für die großzügige Gewährung eines Stipendiums zur Fertigstellung des Projekts zu danken, den Kollegiaten des Frankfurter Instituts für Sozialforschung für die Aufnahme des Buchs in die Institutsreihe.
19Ohne Robin Celikates’ Hilfe bei der Überarbeitung des Manuskripts wäre ich verloren gewesen. Sandra Beaufays und den Mitarbeiterinnen des IfS danke ich für Korrektur und Redaktion. Die freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Staatsbibliothek wissen vermutlich gar nicht, wie hilfreich ihre unentwegte Aufmunterung in besonders angestrengten Arbeitsphasen manchmal sein kann. Schließlich hat Jakob Wohlgemuths immer deutlicher werdende Präsenz entscheidend dazu beigetragen, die Abgabe des Manuskripts endlich zu bewerkstelligen. Der persönlichste Dank geht an Andreas Fischer. Aber das gehört nicht hierher.
20I. Die Beziehung der Beziehungslosigkeit: Zur Rekonstruktion eines sozialphilosophischen Motivs
Entfremdung ist eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. Das ist, auf eine sehr kurze und sehr abstrakte Formel gebracht, der Ausgangspunkt der hier entwickelten Überlegungen. Entfremdung bezeichnet demnach nicht die Abwesenheit einer Beziehung, sondern ist selbst eine – wenn auch defizitäre – Beziehung. Umgekehrt bedeutet die Aufhebung von Entfremdung nicht die Rückkehr zu einem ungeschiedenen Einssein mit sich und der Welt, sondern ist wiederum eine Beziehung, ein Aneignungsverhältnis. Die systematisch entscheidende Idee meiner Rekonstruktion des Entfremdungsmotivs ist nun die folgende: Um den Entfremdungsbegriff erneut produktiv zu machen, sollte man ihm eine formale Wendung geben. Im Gegensatz zu einer substantiellen Bestimmung dessen, wovon man sich in Entfremdungsbeziehungen entfremdet, ist es dann der Charakter dieser Beziehung, der zu untersuchen ist, sind es verschiedene Formen der Störung von Aneignungsverhältnissen, die sich mit dem Begriff der Entfremdung diagnostizieren lassen. Dieses Aneignungsverhältnis sollte dabei als produktives Verhältnis und als offener Prozess verstanden werden, in dem Aneignung stets beides bedeutet: Integration wie Transformation von Gegebenem. Entfremdung ist die Verkennung und Stillstellung dieser Aneignungsbewegung. So kommt die Analyse von Entfremdungsprozessen durchgängig ohne die Bezugnahme auf einen »archimedischen Punkt« jenseits der Entfremdung aus.
Mit diesem Ansatz lassen sich, so werde ich argumentieren, zwei Probleme überwinden, mit denen die Entfremdungstheorie häufig konfrontiert wird: einerseits ihr Essentialismus und ihre perfektionistische Orientierung an einer Vorstellung von »Wesen« oder Natur des Menschen oder an einem objektivistisch gefassten Ideal des guten Lebens; andererseits das Versöhnungsideal, das Ideal spannungsfreier Einheit, das mit der Entfremdungskritik als Identitäts- wie auch als Sozialtheorie verbunden zu sein scheint. Wenn sich Entfremdung so als ein Verhältnis gestörter bzw. verhinderter Welt- und Selbstaneignung darstellt, ergibt sich daraus ein aufschlussrei21cher Zusammenhang zwischen Freiheit und Entfremdung. Sofern Freiheit nämlich voraussetzt, dass man sich das, was man tut, und die Bedingungen, unter denen man es tut, zu Eigen machen kann, ist die Überwindung von Entfremdung Voraussetzung für die Verwirklichung von Freiheit.
Der folgende erste Teil dieser Untersuchung soll in das mit dem Begriff der Entfremdung umschriebene Problemfeld einleiten. Dabei nähere ich mich zunächst (1) den verschiedenen Dimensionen des Begriffs und des Phänomens der Entfremdung, wie sie sich sowohl aus dem Alltagsgebrauch als auch aus der philosophischen Behandlung des Begriffs erschließen lassen. Anhand einer genaueren Beschäftigung mit den entfremdungstheoretischen Ansätzen, wie sie sich einerseits aus der Marx’schen Theorie, andererseits aus Heideggers Existentialontologie gewinnen lassen, soll das vertieft werden (2). Vor dem Hintergrund des damit aufscheinenden Potentials des Begriffs als einem sozialphilosophischen Grundbegriff soll dann (3) seine Struktur wie seine Problematik erörtert werden. Schließlich wird der Rekonstruktionsvorschlag skizziert, wie ich ihn in der Durchführung des Buches entwickeln werde (4).
1. A stranger in the world that he himself has made – Begriff und Phänomen der Entfremdung
Der Begriff »Entfremdung« verweist auf ein ganzes Bündel miteinander verbundener Motive. Entfremdung bedeutet Indifferenz und Entzweiung, Machtlosigkeit und Beziehungslosigkeit sich selbst und einer als gleichgültig und fremd erfahrenen Welt gegenüber. Entfremdung ist das Unvermögen, sich zu anderen Menschen, zu Dingen, zu gesellschaftlichen Institutionen und damit auch – so eine Grundintuition des Entfremdungsmotivs – zu sich selbst in Beziehung zu setzen. Eine entfremdete Welt präsentiert sich dem Individuum als sinn- und bedeutungslos, erstarrt oder verarmt, als eine Welt, die nicht »die seine« ist, in der es nicht »zu Hause« ist oder auf die es keinen Einfluss nehmen kann. Das entfremdete Subjekt wird sich selbst zum Fremden, es erfährt sich nicht mehr als »aktiv wirksames Subjekt«, sondern als »passives Objekt« (Israel 1985), das Mächten ausgeliefert ist, die es nicht kennt. »Wo immer Individuen sich in ihren eigenen Handlungen nicht wiederfinden« 22(Habermas 1991: 48) oder wir nicht »Herr über die Macht, die wir selber sind«, sein können (Heidegger), kann man von Entfremdung sprechen. Der Entfremdete ist, so der frühe Alasdair MacIntyre, »a stranger in the world that he himself has made« (MacIntyre 1953: 23).
Phänomene der Entfremdung
Entfremdung ist, man sieht es schon bei der ersten Annäherung, ein Begriff mit »unscharfen Rändern«. Die »Familienähnlichkeiten« und vielfältigen Überlappungen mit anderen Begriffen wie dem der »Verdinglichung«, der »Unauthentizität« oder der »Anomie« ist dabei für das Wirkungsfeld des Begriffs ebenso charakteristisch wie die wechselseitige Verschränkung, die hier der Alltagsgebrauch mit der philosophischen Verwendung eingegangen ist. Wenn sich nämlich der »Erfahrungsgehalt«[13] des Begriffs aus den historischen und sozialen Erfahrungen speist, die sich in ihm Ausdruck verschafft haben, so hat umgekehrt der Begriff der Entfremdung als philosophischer Begriff auf die Selbst- und Weltdeutungen von Individuen und sozialen Bewegungen eingewirkt. In diesen »unreinen«[14] Mischungsverhältnissen ergibt sich ein vielfältiges Feld von Phänomenen, die sich mit dem Entfremdungsbegriff assoziieren lassen:
– Seiner selbst »entfremdet« ist man, dem Sprachgebrauch zufolge, sofern man sich nicht so verhält, wie man »eigentlich« ist, sondern »künstlich« und »unecht« oder sofern man von Wünschen geleitet ist, die in bestimmter Hinsicht nicht »die eigenen« sind oder nicht als solche erfahren werden. Man lebt dann (so bereits Rousseaus kritische Diagnose) »in der Meinung der anderen« statt »in sich selbst«. Als entfremdet oder unauthentisch gelten dementsprechend z. B. Rollenverhalten und sozialer Konformismus; aber auch die konsumkritische Rede von »falschen Bedürfnissen« gehört in das Umfeld der Entfremdungsdiagnose.
23– »Entfremdet« sind Verhältnisse, die nicht um ihrer selbst willen eingegangen werden, oder Tätigkeiten, mit denen man sich nicht »identifizieren« kann. Der Arbeiter, der nur auf den Feierabend wartet, der Wissenschaftler, der ausschließlich mit Blick auf den citation index publiziert, der Arzt, der die Gebührenordnung nicht einen Moment lang vergessen kann – sie alle sind entfremdet von dem, was sie tun. Und wer eine Bekanntschaft nur pflegt, weil sie dem eigenen Vorteil nutzt, hat ein entfremdetes Verhältnis zu seinem Gegenüber.
– Die Rede von Entfremdung charakterisiert weiterhin die Herauslösung aus sozialen Zusammenhängen. In diesem Sinne kann man sich von seinem Lebenspartner oder von seiner Familie, dem Ort seiner Herkunft, einer Gemeinschaft oder einem kulturellen Milieu »entfremden«. Von Entfremdung spricht man, spezifischer, sofern sich jemand mit den sozialen oder politischen Institutionen, in denen er lebt, nicht identifizieren, sie nicht als »seine« begreifen kann. Auch soziale Isolation oder individualistische Privatisierung werden manchmal als Symptome von Entfremdung gewertet. Leicht romantisiert, wird Entfremdung als Ausdruck von »Entwurzelung« und »Heimatlosigkeit« verstanden, die im konservativ-kulturkritischen Repertoire auf die Unübersichtlichkeit oder Anonymität moderner Lebensverhältnisse oder auf die »Künstlichkeit« ihrer medialen Vermittlung zurückgeführt wird.
– Als entfremdend wird die Entpersönlichung und Versachlichung von zwischenmenschlichen Beziehungen und Verhältnissen zur Welt charakterisiert, sofern diese nicht mehr unmittelbar, sondern z.B. durch Geld vermittelt, nicht »konkret«, sondern »abstrakt«, nicht unveräußerlich, sondern austauschbar sind. Die Vermarktlichung oder »Kommodifizierung« von vorher nicht marktförmigen Bereichen oder Gütern ist in dieser Hinsicht ein Beispiel für Entfremdungsphänomene. Dass die bürgerliche Gesellschaft, »beherrscht vom Äquivalent« (Adorno), die Eigenheit von Dingen und Menschen, ihre Besonderheit und Unvertretbarkeit, zerstöre, findet sich als entfremdungskritische Diagnose weit über den Marxismus hinaus.
– Entfremdung bedeutet – ein beherrschendes Thema schon der Goethezeit – den Verlust des »ganzen Menschen«, die durch Arbeitsteilung und Spezialisierung hervorgebrachte Fragmen24tierung und Beschränkung von Tätigkeiten und die daraus folgende Verkümmerung menschlicher Potentiale und Ausdrucksmöglichkeiten. Nur noch »Rädchen im Getriebe«, ist der entfremdet Arbeitende entindividualisiert, bloße Teilfunktion innerhalb eines von ihm nicht überschaubaren und von ihm nicht kontrollierbaren Geschehens.
– Als »entfremdet« lassen sich schließlich Verhältnisse beschreiben, in denen sich Institutionen als übermächtig darstellen oder »systemische« Zwänge keinen Handlungsspielraum zu erlauben scheinen: Entfremdung oder Verdinglichung bedeutet so die Verselbstständigung von Verhältnissen gegenüber denen, die diese konstituieren. Die »tote Ehe« ist in diesem Sinn genauso ein Entfremdungsphänomen wie der Zustand mancher demokratischer Selbstverwaltungsgremien; der Verlust von Handlungsspielräumen gegenüber den durch die Ökonomie gesetzten Bedingungen ebenso wie das »stählerne Gehäuse« sozialstaatlicher Bürokratie.
– Aber auch das »Absurde« kann als Mitglied der Entfremdungsfamilie gelten. Die literarischen Figuren Kafkas, Becketts oder Camus’ sind nur die bekanntesten Repräsentanten für Erfahrungen vollkommener Unverbundenheit und Sinnlosigkeit.
Entfremdungstheorie(n) – Krise im Zeitbewusstsein
Was also ist Entfremdung? »It seems that whenever he feels that something is not as it should be, he characterizes it in terms of alienation« (Schacht 1970: 116) – diese Bemerkung Richard Schachts über Erich Fromm scheint die Verwendung des Begriffs (nicht nur bei diesem) treffend zu beschreiben. So verschieden aber die hier aufgezählten Phänomene auch sein mögen, lässt sich doch ein erster Umriss des Entfremdungsbegriffs ausmachen. Eine entfremdete ist eine defizitäre Beziehung, die man zu sich, zur Welt und zu den Anderen hat. Indifferenz, Instrumentalisierung, Versachlichung, Absurdität, Künstlichkeit, Isolation, Sinnlosigkeit, Ohnmacht – die verschiedenen Charakterisierungen, die sich für diese Beziehung ergeben hatten, sind Gestalten dieses Defizits. Dabei ist es für den Entfremdungsbegriff kennzeichnend, dass mit ihm beides gefasst wird: Unfreiheit und Machtlosigkeit, aber auch eine cha25rakteristische »Verarmung« der Beziehung zu sich und zur Welt. (So ist auch der Doppelsinn zu verstehen, auf den Marx mit seiner Formel von Entfremdung als »doppelter Entwirklichung« der Welt und des Menschen zielt: Unwirklich geworden, erfährt der Mensch sich nicht als »wirksam«, und unwirklich geworden, ist die Welt bedeutungslos und indifferent.) Es ist die Komplexität der damit angedeuteten Zusammenhänge, die den Begriff der Entfremdung zum Schlüsselbegriff einer Krisendiagnose der Moderne und zu einem der Gründungsbegriffe der Sozialphilosophie gemacht haben.
Als Ausdruck einer »Krise im Zeitbewusstsein« (Hegel) nämlich reicht die moderne Entfremdungsdiskussion von Rousseau und Schiller über Hegel bis zu Kierkegaard und Marx. Zur »Zivilisationskrankheit par excellence« (vgl. Nicolaus 1995: 27) avanciert, wird Entfremdung seit dem 18. Jahrhundert zur Chiffre, mit der man sich über die mit der fortschreitenden Industrialisierung einhergehende »Unsicherheit, Zerrissenheit und Entzweiung« im Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zur Welt verständigt, eine Diagnose, die die Marx’sche Entfremdungstheorie eingefangen und kapitalismuskritisch gewendet hat. Und wenn der »Bestimmungsverlust des modernen Menschen« (Theunissen 1981) die von Kierkegaard herkommende existenzphilosophische Frage nach Selbstsein und Selbstverlust prägt, so stellt sich die hier beschriebene Erfahrung von Indifferenz und radikaler Fremdheit als geradezu ontologisch situierte Verkennung der Welt, des menschlichen Verhältnisses zur Welt und des Verhältnisses der Menschen zu sich selbst dar, die bei allen Unterschieden zur Marx’schen Diagnose auch einiges mit ihr teilt. Dabei umkreist die Entfremdungsdiagnose – in ihrer modernen Form – immer (z. B. Freiheit und Selbstbestimmung) und ihrer verfehlten Einlösung. Entfremdung ist, so verstanden, nicht nur ein Problem der Moderne, sondern auch ein modernes Problem.
Eine kurze Geschichte der Entfremdungstheorie
Eine (sehr) kurze Geschichte der modernen Entfremdungstheorie ließe sich, in einer ihrer Versionen, so erzählen:
1. Nicht dem Begriff, wohl aber der Sache nach sind in den Werken Jean-Jacques Rousseaus bereits alle Stichworte gegeben, die die Rede von Entfremdung – sofern sie einen sozialphilosophischen 26Sinn hat – bis heute ausmachen.[15] Das Bild, mit dem Rousseau seinen »Diskurs über die Ungleichheit unter den Menschen« (1755) einleitet, ist prägnant:
Die menschliche Seele gleicht der Statue des Glaukus, welche die Zeit, das Meer und die Stürme derart entstellt hatten, dass sie weniger einem Gott als einem wilden Tier glich. Sie hat das Gesicht sozusagen bis zur Unkenntlichkeit verändert. (Ebd.: 65)
Die Entstellung, von der Rousseau hier spricht, ist die Deformation des Menschen durch die Gesellschaft: Mit seiner Natur entzweit, von seinen eigenen Bedürfnissen entfremdet, dem konformistischen Diktat der Gesellschaft unterworfen, in seinem Geltungsdrang und seiner Eitelkeit abhängig von der Meinung der Anderen, ist der gesellschaftliche Mensch eine missgestaltet-künstliche Person. Die wechselseitige Abhängigkeit des zivilisierten Menschen, die durch den sozialen Kontakt erzeugte Entgrenzung seiner Bedürfnisse und die Orientierung an den Anderen führt, Rousseau zufolge, gleichzeitig zu Herrschaft und Unfreiheit wie zu Authentizitätsverlust und (Selbst-)Entfremdung, in einen Zustand, dem die Autonomie und Authentizität eines als Autarkie gedachten Naturzustands entgegengesetzt wird.
Dabei sind es zwei auf den ersten Blick entgegengesetzte Ideen, die Rousseaus Werk als Entfremdungstheorie folgenreich gemacht haben: Einerseits die Entwicklung des modernen Ideals der Authentizität als ungestörter Übereinstimmung mit »sich« und der eigenen »Natur«, andererseits die Idee der sozialen Freiheit, wie sie sich in der Aufgabenstellung des »Gesellschaftsvertrags« ausdrückt. Beschreibt Rousseau im »Zweiten Diskurs« in eindringlichen Worten den entfremdenden Charakter der in diesem Zusammenhang durchweg negativ bewerteten Effekte der Vergesellschaftung, so ist es wiederum Rousseau, der mit dem Contrat Social das normative Ideal einer nichtentfremdenden Vergesellschaftungsform in die Welt setzt. Ohne die werkimmanenten Spannungen leugnen zu wollen, lässt sich der Zusammenhang zwischen diesen beiden Aspekten so 27erläutern: Die Kluft zwischen authentischem Selbstsein und Gesellschaft, die Rousseau so beredt gedeutet hat, erweist sich, seinen eigenen Voraussetzungen nach, als Aporie, die sich nur durch die Herstellung eines Zustands, in dem die Individuen in gesellschaftlichen Institutionen leben, die sie als die ihren erfahren können, lösen lässt. Einerseits also verliert der von Rousseau beschriebene entfremdete Mensch sich, sofern er sich mit anderen verbindet: »Der natürliche Mensch lebt in sich, der gesellschaftliche dagegen immer außer sich.« Andererseits aber kann er sich nur durch die Gesellschaft wiedergewinnen. Wenn nämlich die Wiederherstellung der Autarkie des Rousseau’schen »Naturzustands« und damit einer Freiheit, die sich aus Unabhängigkeit und Unverbundenheit speist, einen »zu hohen Preis« hätte[16] – den Preis des Verlustes spezifisch menschlicher Eigenschaften wie Reflexivität und Vernunft nämlich –, kann die Lösung des Entfremdungsproblems nicht darin bestehen, die sozialen Bande aufzulösen, sondern nur darin, sie zu transformieren. Die als entfremdend erfahrene wechselseitige Abhängigkeit der gesellschaftlichen Individuen voneinander wird entsprechend durch die im »Gesellschaftsvertrag« projektierte Idee einer Vereinigung, in der jeder Einzelne alle seine Rechte an die Gesellschaft veräußert und dabei »so frei ist als zuvor«, umgestaltet. Aus entfremdender Fremdherrschaft wird die Unterwerfung unter das »eigene Gesetz«. Die Wirkung Rousseaus ist also doppeldeutig: Steht Rousseau, vor allem aber der »Rousseauismus«, einerseits für die immer wiederkehrenden entfremdungskritischen Bewegungen einer Abkehr vom »Allgemeinen«, denen – vom Ideal unverfälschter Natur oder ursprünglicher Autarkie her betrachtet – Sozialität und gesellschaftliche Institutionen per se als entfremdend gelten, so wird er andererseits zum Vorläufer nicht nur des kantischen Gedankens der Selbstherrschaft, sondern auch der Hegel’schen Idee einer »Sozialität der Freiheit«.
2. Es ist allerdings Hegel vorbehalten, die damit aufscheinende Idee einer »Selbstverwirklichung im Allgemeinen« philosophisch zu konzeptualisieren. Ist auch für ihn die Moderne von Entfremdungserscheinungen gezeichnet – die Zerrissenheit des modernen Bewusstseins, das Auseinandertreten von »Besonderem« und »All28gemeinem« in den von Desintegration bedrohten Zusammenhängen der bürgerlichen Gesellschaft –, so gilt ihm nicht der Selbstverlust der Individuen durch die Gesellschaft, sondern die Kluft zwischen Individuum und Gesellschaft als Kern des Problems. Entfremdung (bzw. Entzweiung) bei Hegel ist defizitäre Sittlichkeit, der »Verlust sittlicher Allgemeinheit«. Wenn »Sittlichkeit« dabei nicht die ethisch substantielle Integration in vormoderne Gemeinschaftstypen (die ethisch integrierte Sittlichkeit der vormodernen polis) meint, sondern dem »Recht des Individuums auf seine Besonderheit« Genüge tun soll, so beruht der Anti-Atomismus[17] Hegels auf der Idee, dass Individuen sich immer schon in Beziehungen befinden, deren »Realisierung« (in mehrfachem Sinn) zu den Voraussetzungen ihrer Freiheit gehört.
Wo Hegel also die von Rousseau skizzierte Problematik aufnimmt, transformiert er dessen Ansatz in ein Konzept von Freiheit als Sittlichkeit und Sittlichkeit als Freiheit: Frei sind wir in und vermittelt durch die überindividuellen Institutionen, in denen wir uns als Individuen erst verwirklichen können. Das (atomistisch bleibende) Rousseau’sche Begehren nach Authentizität wird also durch das Konzept einer Selbstverwirklichung ersetzt, die sich als Identifikation mit den Institutionen des sittlichen Lebens erst realisiert. Gilt Hegels theoretische Anstrengung so einerseits der Überwindung des Autarkieideals von Freiheit, so zielt sie andererseits auf die Einbettung der (kantischen) Idee der Selbstherrschaft: Gefragt wird nach den Bedingungen dafür, sich in überindividuellen Institutionen »wiederzufinden«; thematisiert wird unter dem Titel der »Bildung«, der Prozess, in dem sich Individuen aus vorgefundenen Abhängigkeiten herausarbeiten und den gesellschaftlichen Zusammenhang – als Teil ihrer eigenen Voraussetzungen – zu Eigen machen können.[18]
293. Mit Kierkegaard und Marx treffen sich die beiden »nachhegelschen« Stränge der Entfremdungstheorie im Projekt einer Anthropologisierung Hegels (Löwith 1988: 143). Die zeitgenössisch virulente Orientierung an der »wirklichen Existenz« und dem »wirklichen, tätigen Menschen« lenkt beide zwar in unterschiedliche Richtungen: Der Hinwendung zur Ökonomie bei Marx steht die Vertiefung in eine Ethik der Existenz bei Kierkegaard gegenüber. Die entfremdungstheoretische Aufmerksamkeit für das Problem der Entzweiung, der Indifferenz und des Bezugsverlusts zu sich und zur Welt führt aber interessanterweise beide zum Motiv der praktischen Aneignung. Denkt Kierkegaard Selbstwerdung als Aneignung der eigenen Handlungen und der eigenen Geschichte, als den Vorgang also, »sich praktisch zu ergreifen«, und damit als tätige Inbesitznahme des fremd Gesetzten, so fungiert auch bei Marx der Gedanke produktiver Welt- und Selbstaneignung als Gegenmodell zur Entfremdung.
Kierkegaards sittlich-ethische Zielbestimmung besteht nun allerdings darin, gegenüber der konformisierenden Öffentlichkeit der sich durchsetzenden modernen bürgerlichen Gesellschaft »ein einzelner Mensch«, ein »vereinzelter Einzelner« zu werden. Der Marx’sche Ansatz hingegen ist dadurch charakterisiert, dass sich in ihm die Aneignung des eigenen menschlichen Wesens als Aneignung seines »Gattungswesens« vollzieht (wobei der von Feuerbach kommende Terminus »Gattungswesen« als naturalisierte Hegel’sche Sittlichkeit verstanden werden kann). So unterscheiden sich Ausgangspunkt wie Ergebnis der existentialistischen Entfremdungskritik von der »Hegel-Marx-Linie« nicht zuletzt darin, dass im einen Fall Entfremdung als Entfremdung von der sozialen Welt gedacht wird, während hier das Faktum des Eingelassenseins in eine öffentliche Welt gerade die Quelle der Entfremdung – des Authentizitätsverlusts der Subjekte angesichts der als »Nivellierung« (Kierkegaard) oder »Herrschaft des Man« (Heidegger) beschriebenen öffentlichen Welt – zu sein scheint. Dennoch ergeben sich (nicht nur rezeptionsgeschichtlich) mehrfache Überschneidungen zwischen diesen beiden Strängen der Entfremdungstheorie. Zielt die Hegel’sche Diagnose der »Entzweiung« auf den Umstand, dass Individuen »sich« in den politisch-sozialen Institutionen der Sittlichkeit »nicht wiederfinden« können, und ergibt sich aus der Entfremdungsanalyse der Marx’schen »Ökonomisch-Philosophischen 30Manuskripte«, dass wir uns, entfremdet arbeitend, unsere eigene Tätigkeit, ihre Produkte und die Bedingungen ihrer gemeinschaftlichen Produktion »nicht aneignen« können, so verweist auch die existentialistisch inspirierte Fassung der Entfremdungsthematik auf strukturelle Hindernisse dafür, dass Individuen die Welt als die ihre und sich als diese Welt prägende Subjekte verstehen können.
4. Wenn im zwanzigsten Jahrhundert der so genannte »westliche Marxismus« in seinen verschiedenen Strömungen prominent an die Entfremdungsdiskussion (und damit an das sozialphilosophische Erbe der Marx’schen Theorie) anknüpfte, so vor allem deshalb, weil sich im Anschluss an diese eine »qualitative Dimension« von Gesellschaftskritik erschließen ließ, die insbesondere für die Entwicklung einer kritischen Theorie des fortgeschrittenen Kapitalismus von fundamentaler Bedeutung war. So arbeitet Georg Lukács in seinem berühmten Aufsatz »Die Verdinglichung und das Bewußtsein des Proletariats« (vgl. Lukács 1988) bereits in den 20er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts (ohne noch die entfremdungstheoretischen »Ökonomisch-Philosophischen Manuskripte« zu kennen[19]) die Marx’sche Analyse des Warenfetischs zu einer Theorie der Entfremdung bzw. Verdinglichung aus. Dabei wird mit der zentralen These von der »Universalität der Warenform« als Charakteristikum der modernen Gesellschaft die Theorie der Verdinglichung zur Theorie der modernen kapitalistischen Gesellschaft in allen ihren Erscheinungsformen. Der Einfluss der Weber’schen Theorie der Rationalisierung und der Simmel’schen Versachlichungsdiagnose auf Lukács führt dabei zu einem (gegenüber Marx) leicht veränderten Blick: Prägend werden für Lukács die Phänomene von Indifferenz, Versachlichung, Quantifizierung und Abstraktion, die sich mit Ausbreitung der kapitalistischen Tauschwirtschaft in sämtlichen Lebensverhältnissen und Ausdrucksformen der modernen bürgerlichen Gesellschaft niederschlagen. Max Webers Bild vom »stählernen Gehäuse», in dem der Mensch der bürokratisierten kapitalistischen Gesellschaft gefangen ist, sowie Simmels Beschreibung der »Tragödie der Kultur», in der die Produkte menschlicher Freiheit sich den Menschen gegenüber 31als etwas Objektives verselbstständigt haben, und seine Analyse der mit der Ausbreitung der Geldwirtschaft einhergehenden Verkehrung von Freiheit in Sinnverlust fangen die Phänomene, die Lukács »in der Luft« liegen sah, auf prägnante Weise ein. War dabei auch für Lukács die Überschneidung von marxistischen und existentialistischen Motiven kennzeichnend[20], so ist leicht zu sehen, dass es sich hier um theoretische Mischungsverhältnisse handelt, die für die Fortentwicklung der Kritischen Theorie entscheidend waren und sich in den verschiedenen Konjunkturen des Begriffs bis heute gehalten haben.[21]
2. Exkurs:Marx und Heidegger – Zwei Varianten der Entfremdungskritik
Ich werde im Folgenden auf Marx und Heidegger – als zwei folgenreiche Varianten einer Entfremdungskritik, die sich in ihrer Wirkung mehrfach überschneiden – näher eingehen. Gerichtet gegen die »Pseudoontologie der gegebenen Welt« (Goldmann 1975: 118) thematisieren die Entfremdungskritiken Marx’ und Heideggers mit je verschiedenen konzeptuellen Hintergründen die Vorherrschaft verdinglichender Objektivationen im Welt- und Selbstverhältnis 32moderner Individuen und die damit einhergehende »Verwandlung des Menschen in ein Ding« (Fromm 1981), eine Situation also, in der die Welt als »gegeben« verkannt wird, statt als Resultat praktischer Weltvollzüge aufgefasst zu werden. Aus den charakteristischen Unterschieden zwischen beiden Positionen wiederum – die sich u.a. auf die Differenz zwischen der Marx’schen Orientierung an einem expressivistisch aufgefassten »Produktionsparadigma« und dem Heidegger’schen Verständnis des »In-der-Welt-seins« zurückführen lassen – lässt sich für das Projekt einer Rekonstruktion des Entfremdungsbegriffs einiges gewinnen.
Marx: Arbeit und Entfremdung
Marx unterscheidet in den »Ökonomisch-Philosophischen Manuskripten« von 1844[22] vier Resultate des »nationalökonomischen Faktums« entfremdeter Arbeit: Entfremdete Arbeit entfremdet den Arbeiter erstens vom Produkt seiner Arbeit; zweitens von seiner eigenen Tätigkeit; drittens von dem, was Marx in Anschluss an Feuerbach »Gattungswesen« nennt; viertens von den anderen Menschen. Entfremdung liest sich so als die Störung eines Verhältnisses, das man zu sich und zur Welt (sei es die soziale oder die natürliche Welt) hat oder haben sollte. Umgekehrt ist nichtentfremdete Arbeit als eine bestimmte Form produktiver Weltaneignung die Voraussetzung dafür, ein angemessenes Verhältnis zu sich, zur gegenständlichen Welt und zu den anderen entwickeln zu können.
In dieser Darstellung sind bereits die beiden Aspekte angedeutet, die, meiner These nach, die Pointe der Marx’schen Entfremdungsdiskussion ausmachen. Erstens sind hier (mit dem Spannungsfeld von Aneignung und Fremdheit) zwei Probleme zusammengedacht, deren Zusammenhang nicht ohne weiteres selbstverständlich ist: das des Sinnverlusts, der »Verarmung« und »Bedeutungslosigkeit der Welt« und das der Ohnmacht oder Machtlosigkeit ihr gegenüber. Zweitens zeigt sich in diesem zentralen Text der Marx’schen Entfremdungstheorie die spezifische Wendung, die Marx dem Problem der Beziehungslosigkeit zwischen Welt und Menschen gibt: Der Skandal der Entfremdung ist, dass es sich um eine Entfremdung von Selbstgemachtem handelt. Es sind unsere eigenen Tätig33keiten und Produkte, die sozialen Institutionen und Verhältnisse, die wir selbst erzeugt haben, die hier zur fremden Macht geworden sind. Man kann das mit Charles Taylor als »prometheisch-expressivistische« Wendung bezeichnen, mit der Marx, Hegels Entäußerungsmodell des Geistes und Feuerbachs Projektionsbegriff folgend, das Entfremdungsproblem interpretiert.[23]
Ich werde im Folgenden zunächst den von Marx angesprochenen Dimensionen der Entfremdung (und damit dem Reichtum und Gehalt seines Entfremdungsbegriffs) nachgehen, um anschließend, auf dem Hintergrund einer Erläuterung der Bedeutung des Konzepts der »Arbeit« im Zusammenhang mit der Marx’schen »Anthropologie«, die oben erwähnte »produktivistische Wendung« des Entfremdungsbegriffs zu diskutieren.
Dimensionen der Entfremdung. Im von Marx als »Entfremdung« angesprochenen »Defizit« im Verhältnis zu sich und zur Welt kann man zwei Dimensionen identifizieren: Erstens die Unfähigkeit, sich mit dem, was man tut, und mit denjenigen, mit denen man es tut, sinnhaft zu identifizieren; zweitens die Unfähigkeit, über das, was man tut, Kontrolle auszuüben, d.h. individuell oder kollektiv in dem, was man tut, »Subjekt seiner Handlungen« zu sein. So bedeutet die Entfremdung vom Gegenstand, vom Produkt der eigenen Tätigkeit, zum einen Kontrollverlust und Enteignung. Über das, was der entfremdet Arbeitende (als Verkäufer seiner Arbeitskraft) selber hergestellt hat, verfügt er nicht mehr, es gehört ihm nicht. Es wird auf einem Markt, den er nicht kontrolliert, zu Bedingungen, die er nicht kontrolliert, getauscht. Entfremdung vom Gegenstand bedeutet zum anderen, dass dieser ihm fragmentiert erscheinen muss: Unter Bedingungen von Spezialisierung und Arbeitsteilung arbeitend, hat der Arbeiter keine Beziehung zum Produkt seiner Arbeit als Ganzem. Als jemand, der in einen der mannigfachen Teilprozesse involviert ist, die in die Herstellung der berühmten 34Adam Smith’schen Stecknadel eingehen, hat er kein Verhältnis zur Stecknadel als fertigem Produkt, so klein diese auch sein mag. Das Produkt seiner spezifischen Arbeit (also des spezifischen Anteils, den er bei der Herstellung der Stecknadel geleistet hat) fügt sich ihm, anders gesagt, nicht zu einem sinnvollen Ganzen, einer bedeutungsvollen Einheit zusammen.
Dieselbe Dopplung von Machtlosigkeit und Sinnverlust bzw. Verarmung kennzeichnet die Entfremdung von der eigenen Tätigkeit. Entfremdete Arbeit ist einerseits unfreie Tätigkeit, Arbeit also, in die man und in der man gezwungen ist. Arbeitend ist der entfremdet Arbeitende nicht Herr über das, was er tut. Unter fremdem Kommando stehend, ist er in seiner Arbeit fremdbestimmt. »Wenn er sich zu seiner eigenen Tätigkeit als einer unfreien verhält, so verhält er sich zu ihr als der Tätigkeit im Dienst, unter der Herrschaft, dem Zwang und dem Joch eines anderen Menschen.« (Marx 1968: 519) Und ohnmächtig kann er den ihm intransparenten Gesamtprozess, dessen Teil er ist, weder durchschauen noch kontrollieren. Entfremdete Arbeit ist aber gleichzeitig auch – als Pendant zur Fragmentierung des Produkts – durch Fragmentierung und Verarmung der Tätigkeiten ausgezeichnet. Marx spricht als entfremdet also auch die Beschränktheit und Stumpfheit der Arbeit selbst an, »welche aus dem Menschen ein möglichst abstraktes Wesen, eine Drehmaschine etc. macht und bis zur geistigen und physischen Missgeburt ihn umwandelt« (so Marx in den Mill-Exzerpten). Auch die Entfremdung »von den Anderen«, von der Welt sozialer Kooperationsverhältnisse spiegelt diese Dimensionen: Entfremdet arbeitend hat der Arbeiter keine Kontrolle über das, was er – mit anderen zusammen – tut. Und entfremdet arbeitend sind ihm die anderen, so könnte man sagen, »strukturell gleichgültig«.[24]
Interessant und für den Charakter seiner Theorie folgenreich ist dabei, dass Marx nicht nur die Instrumentalisierung des Arbeiters durch den Besitzer seiner Arbeitskraft anprangert, sondern auch das instrumentelle Verhältnis, das der Arbeiter dadurch zu sich selbst gewinnt. Als problematisch (stärker: »unmenschlich«) erscheint aus der Perspektive von Marx eben auch das instrumentelle Verhältnis, das der Arbeiter unter entfremdenden Bedingungen zu sich und seiner Arbeit entwickelt (bzw. in das er unter diesen Bedingungen 35gezwungen ist). Entfremdend an entfremdeter Arbeit ist, dass sie keinen intrinsischen Zweck hat, dass sie nicht (zumindest auch) um ihrer selbst willen ausgeübt wird. Tätigkeiten, die man entfremdet ausübt, fasst man nicht als Zweck, sondern lediglich als Mittel auf. Ebenso werden einem die Fähigkeiten, die man hier erwirbt oder einbringt, und damit: man sich selbst, zum Mittel. Anders: Man identifiziert sich nicht mit dem, was man tut. Die Instrumentalisierungsdiagnose spitzt sich also wiederum auf eine Diagnose umfassender Sinnlosigkeit zu: Wenn, wie Marx es ausdrückt, im entfremdeten Zustand das Leben selbst zum Mittel wird (»Das Leben selbst erscheint nur als Lebensmittel« – Marx 1968: 516) – also das, was eigentlich Zweck sein soll, Mittelcharakter bekommt –, ist damit ein vollkommen sinnloses Geschehen, man könnte sagen: die Struktur von Sinnlosigkeit selbst beschrieben. Anders gesagt: Der »infinite Regress« der Zwecksetzungen ist die Marx’sche Erläuterung von Sinnlosigkeit. Marx ist hier aristotelisch geprägt: Es muss einen Zweck geben, der selbst nicht wiederum Mittel ist.[25]
Man sieht hier die Vielschichtigkeit des Begriffs: Entfremdet besitzt man nicht, was man selber produziert hat, ist also ausgebeutet und enteignet,[26] man verfügt und bestimmt nicht über das, was man tut, ist also machtlos und unfrei; und man kann sich in seinen eigenen Tätigkeiten nicht verwirklichen, ist also sinnlosen, verarmten und instrumentellen Verhältnissen ausgesetzt, Verhältnissen, mit denen man sich nicht identifizieren kann und in denen man mit sich entzweit ist. Umgekehrt steht die dem von Marx entgegengestellte »wirkliche Aneignung« für eine Form des »Reichtums«,[27] der 36über die bloße Frage der Verteilung von Besitztümern hinausgeht. »Aneignung« in diesem Sinn zielt gleichermaßen auf Inbesitznahme, Ermächtigung und Sinn. Den Gehalt der so beschreibbaren »Konzeption des guten Lebens« bei Marx macht demnach eine Idee von Selbstverwirklichung als identifikatorisch-aneignender Bezugnahme auf sich und die Welt aus (vgl. dazu Brudney 2002).
Marx’ Anthropologie der Arbeit. Entscheidend für dieses Verständnis von Aneignung und Entfremdung ist die Fundierung in einem philosophischen Begriff von Arbeit – als dem für Marx paradigmatischen menschlichen Weltverhältnis –, in dem Arbeit als Entäußerung und Vergegenständlichung menschlicher Wesenskräfte konzipiert wird. Knapp skizziert: Vermittelt über Arbeit, werden die »menschlichen Wesenskräfte«, der Wille, die Ziele und die Fähigkeiten von Menschen »gegenständlich«, sie materialisieren sich, indem sie sich in die Welt »entäußern«. Das Vermögen der Arbeit, gedacht als Stoffwechselprozess mit der Natur, transformiert so gleichzeitig die Welt wie den Menschen. Der Mensch erzeugt in einem sich und seine Welt. Er erzeugt sich, indem er seine Welt erzeugt, und umgekehrt. Und er macht sich, sofern dieser Prozess gelingt, gleichzeitig die gegenständliche Welt und sich selbst zu Eigen. Er »erkennt« sich nämlich (man könnte übersetzen: seinen Willen und seine Fähigkeiten) in seinen Tätigkeiten und Produkten wieder und gewinnt sich selbst vermittelt über diese Beziehung zu seinen eigenen Produkten; er »verwirklicht« sich also in der aneignenden Beziehung auf die Welt als Produkt seiner Tätigkeiten. In diesem Sinne ist Arbeit – nichtentfremdete Arbeit – bei Marx »Wesensbestimmung« des Menschen.[28] Was ihn als Menschen ausmacht, ist, dass er, im Unterschied zum Tier, sich und seine Welt bewusst und in sozialer Kooperation gestalten kann und dass er in diesem Prozess »sich selbst verwirklicht«, aber auch »sich selbst produziert« in dem sehr konkreten Sinne, dass sich seine eigenen Fähigkeiten, sei37ne Sinne und seine Bedürfnisse in dem Maße entwickeln, in dem er sich arbeitend und gestaltend auf die Welt bezieht.
Folgenreich für den Entfremdungsbegriff ist nun folgende Wendung: Wenn ein gelingender Selbst- und Weltbezug qua Arbeit als ein Prozess von Entäußerung, Vergegenständlichung und Aneignung dieser menschlichen »Wesenskräfte« vorgestellt wird – im Sinne der aneignenden Bezugnahme auf die vergegenständlichte eigene Arbeitskraft –, so stellt sich Entfremdung dar als das Scheitern dieses Prozesses, als verhinderte Rückkehr aus dieser Entäußerung. Was scheitert, ist also genau genommen eine Art von Rückholbewegung, die das Entäußerte dem Entäußernden »zurückgeben« soll. Derjenige, der etwas produziert, entäußert sich in die Welt, vergegenständlicht sich bzw. »seine Wesenskräfte« in dieser und eignet sie sich, vermittelt über das Produkt, wieder an. Im berühmten Bild von der Industrie als »Spiegel« der menschlichen Gattungstätigkeit kommt das zum Ausdruck. In diesem Bild bedeutet Versöhnung, Aufhebung von Entfremdung, die Deckungsgleichheit zwischen dem sich Spiegelnden und dem Gespiegelten. Umgekehrt ist Entfremdung die verhinderte Aneignung der entäußerten eigenen Wesenskräfte, also das Unvermögen, sich im Spiegel zu erkennen, oder die Entstellung des Spiegelbilds.[29] Nun ist dieses Modell von Arbeit und Entäußerung und die mit ihm einhergehende Vorstellung, dass sich hier ein »innerer« Plan »außen« materialisiert, aus vielerlei Gründen problematisch.[30] Zu diskutieren ist in unserem Zusammenhang aber vor allem der Umstand, dass Aneignung diesem Verständnis zufolge immer nur als Wiederaneignung von etwas schon Bestehendem gedacht werden kann. Dass Handlungsresultate – auch jenseits entfremdender Verzerrung – eine Eigendynamik entwickeln können und dass sich Verhältnisse, auch wenn sie »von uns gemacht« sind, nicht immer als vollkommen transparent und verfügbar darstellen, ist im hier skizzierten – am Arbeitsmodell entwickelten – begrifflichen Rahmen nicht vorgesehen.
Wenn sich nämlich die »prometheische Wendung« des Ent38fremdungsproblems auf den Umstand bezieht, dass es die eigenen Tätigkeiten sind, deren Resultate sich als »fremde Macht« gegen ihre Erzeuger richten, so ist fremd dasjenige, was einmal eigen war, Entfremdung das Problem des nicht (mehr) Verfügens über etwas, das sich unserer Verfügung verdankt. Entfremdet oder verdinglicht ist etwas, das gemacht ist, sich aber (quasinatürlich und unverfügbar) als gegeben darstellt. Dieses Analysemuster findet sich (unter dem Einfluss der Feuerbach’schen Kritik der religiösen Projektion wie der Hegel’schen Geistphilosophie stehend) schon in den den Pariser Manuskripten vorangehenden Schriften (etwa in »Zur Judenfrage« und der »Kritik der Hegel’schen Rechtsphilosophie«) als immer wiederkehrender Verweis auf den »Götzencharakter« der gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich als von uns selbst produzierte verselbstständigen und gegen uns kehren, und taucht im Kapital mit der Metapher vom »Fetischcharakter« der Ware wieder auf. Das Motiv der fremden Gestalt des eigenen hält sich so in der »Kritik der politischen Ökonomie« durch als »de-naturalisierende« Kritik, die den gesellschaftlichen Charakter dessen enthüllt, was sich als Naturverhältnis ausgibt.
An diesem Punkt lassen sich die Parallelen zwischen »existentialistischer« und »hegel-marxistischer« Entfremdungskritik am leichtesten identifizieren: Als »Objektivierungsfehler« (vgl. Geuss 1983: 24) macht der Aufweis dieser Struktur, in der etwas »Gemachtes« als »Gegebenes« verkannt wird, auch den Kern dessen aus, was man die Heidegger’sche Entfremdungskritik nennen könnte. Anders als bei Marx ist das Verhältnis zur Welt hier allerdings nicht als Produktionsvorgang gedacht: nicht aus der Annahme einer arbeitenden Erzeugung der Welt, sondern aus der Analyse des vorgängigen »In-der-Welt-Seins« ergibt sich eine Position, die man als existenzphilosophische Version eines »Vorrangs der Praxis« der Marx’schen gegenüberstellen kann.
Heidegger: Welt und Verdinglichung
Als entfremdende »Verdinglichung« kann man auf Heidegger’scher Grundlage erstens das objektivierende Weltverhältnis verstehen, in Heideggers Terminologie: die Verkennung von »Zuhandenheit« als »Vorhandenheit« und die damit einhergehende Verkennung der 39Welt, die damit als Gesamtheit von Gegebenem statt als Praxiszusammenhang begriffen wird.[31]
Im Hintergrund dieser Objektivierungs- bzw. Verdinglichungskritik steht Heideggers Analyse des »In-der-Welt-seins«. Man kann die Basisintuition Heideggers so zusammenfassen: Die Welt ist uns nicht »gegeben« als etwas, das vorgängig da ist und auf das wir uns dann (gewissermaßen nachträglich) erkennend oder handelnd beziehen. Wir bewegen uns als Wesen, die ein Leben führen, immer schon in der Welt, finden uns immer schon handelnd in ihr vor bzw. sind immer schon praktisch auf die Welt bezogen.[32] »Welt« ist dabei nicht ein Zusammenhang von Objekten oder die Gesamtheit dieser Objekte, nicht also, wie Heidegger sagt, das »All des Seienden«. »Welt« im existentialontologischen Sinn ist ein Zusammenhang, der im praktischen Umgang mit ihr oder aus diesem heraus – also in unseren praktischen Weltvollzügen – entsteht. Heidegger erläutert das für die uns umgebende »Umwelt« anhand seiner berühmten »Zeuganalyse«: Wir benutzen den Hammer zum Hämmern. Dieses Hämmern dient uns zum Verfertigen eines Stuhles, der uns oder einem anderen zum Sitzen dient. Als ein solcher Zusammenhang von Verweisen »spannt sich eine Welt auf« – in diesem Fall eine handwerklich geprägte Lebenswelt, in die wir eingelassen sind, sofern wir mit ihr umgehen (den Hammer zum Hämmern, den Stuhl zum Sitzen benutzen). Die so entstehende Welt ist eine der bedeutungsvollen Bezüge: Im Zusammenhang dieser Welt (und nur in diesem und aus diesem heraus verständlich) ist der Hammer etwas, das zum Hämmern da ist.
40Die für den Zusammenhang der Objektivierungs- und Entfremdungsproblematik entscheidende Heidegger’sche Unterscheidung zwischen dem Modus der Vorhandenheit einerseits, dem der Zuhandenheit andererseits lässt sich nun erläutern als Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Weisen des Weltbezugs. Dinge, wie sie uns im Zusammenhang einer Welt begegnen, sind uns zuhanden im oben beschriebenen Sinne ihrer Funktion und Bedeutung in Handlungsvollzügen. Etwas, das zuhanden ist, »ist zu etwas gut und wird dazu benutzt, um dies und das zu tun« (Rentsch 1989: 122). Als vorhanden dagegen stellen sich uns Dinge in der Welt dar, wenn wir sie aus diesen Handlungszusammenhängen herauslösen bzw. wenn wir Welt insgesamt als etwas betrachten, das von uns getrennt ist, uns scheinbar »objektiv« (als »gegeben«, von uns nicht beeinflusst) gegenübersteht.[33] Heidegger vertritt also die gewissermaßen »pragmatistische« These: Dinge sind nicht einfach Objekte, sie sind nicht einfach »da« im Sinne »purer Vorhandenheit«. Sie sind »zuhanden« in praktischen Lebensvollzügen, werden bedeutungsvoll durch ihren Gebrauch und im Kontext einer Welt. »Vorhandenheit« und »Zuhandenheit« sind nun weder Qualitäten, die unterschiedlichen Arten von Objekten zukommen, noch sind damit zwei alternativ mögliche Einstellungen zur Welt bzw. zu den Dingen in der Welt beschrieben. (Und es wäre auch ein Missverständnis, zu denken, dass etwa der Hammer, nur wenn ich ihn benutze, »zuhanden« ist, während er, in der Ecke liegend, zum nur noch »Vorhandenen« würde. Selbst wenn ich ihn nur passiv betrachte, verstehe ich ihn »aus seiner Zuhandenheit heraus«, als etwas, das mir so oder so zuhanden sein kann bzw. das ich so oder so verwenden kann.) Es ist eine falsche – nämlich verdinglichende – Vorstellung, »Zuhandenes« als »Vorhandenes« und die Welt als Zusammenhang von Vorhandenem aufzufassen. Und man kann mindestens »Sein und Zeit«, aber mit anderer Pointe auch das Spätwerk als Versuche lesen, diese (folgenreiche) Verkennung zu kritisieren.
Diese Vorstellung verkennt nämlich zweierlei. Erstens verkennt 41sie den Charakter der Gegenstände, mit denen wir umgehen, und den der »Welt«, in der wir leben (als wäre diese einfach gegeben, unabhängig davon, dass es »unsere« Welt ist, dass wir erst sie zu einer Welt machen[34]). Der praktische Charakter der Welt als »Ganzheit praktischer Handlungssituationen« (Ernst Tugendhat) wird durch diese objektivierende Verkennung »verdeckt«. Zweitens aber verkennt sie unser Verhältnis zur Welt und das, was man als unsere Verwicklung in diese bezeichnen könnte: Als könnten wir uns außerhalb der mit dieser gegebenen Handlungsvollzüge bewegen, als wären wir jemals in der Position, die Welt »von außen« zu betrachten, ohne dabei schon in sie involviert zu sein, als wären wir – als »nackte« Subjekte – aus der Struktur des »In-der-Welt-seins« herauszulösen. Wie Heidegger schreibt:
Der Mensch »ist« nicht und hat überdies noch ein Seinsverhältnis zur Welt, das er sich gelegentlich zulegt. Dasein ist nie »zunächst« ein gleichsam in sich freies Seiendes, das zuweilen die Laune hat, eine Beziehung zur Welt aufzunehmen. Solches Aufnehmen von Beziehungen zur Welt ist nur möglich, weil Dasein als In-der-Welt-sein ist, wie es ist.
Selbst- und Weltverhältnis sind damit gleichursprünglich.
Beide Aspekte, der Vorrang der Praxis einerseits, der Antidualismus dieser Konzeption andererseits, sind für die Entfremdungsdiagnose wichtig. Welt, in Heideggers Deutung, ist eine Subjekt und Objekt übergreifende Struktur (1984: §12; Zus. 57). Die Trennung beider Seiten ist – ontologisch betrachtet – Entfremdung, die Separierung von etwas, das zusammengehört.
Entfremdung als Uneigentlichkeit. Die zweite Dimension von Entfremdung, die sich auf dem Hintergrund der Heidegger’schen Existentialontologie thematisieren lässt, betrifft die Ebene des Selbstverhältnisses als des Verhältnisses zur eigenen »Existenz«. Auch hier geht es um eine Form der Verkennung, um falsch objektivierende Einstellungen. Sehr lax ausgedrückt: Wer sich nicht zu sich verhält als zu jemandem, der sein Leben selbst zu führen hat, verdinglicht sich selbst, sofern er den Praxis- und damit den Entscheidungscha42