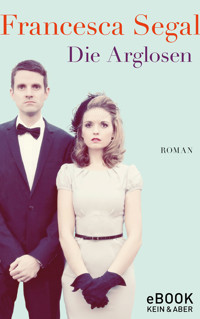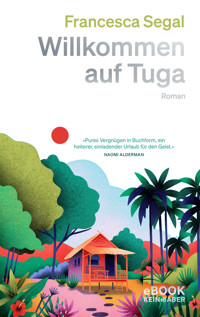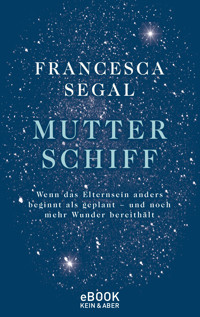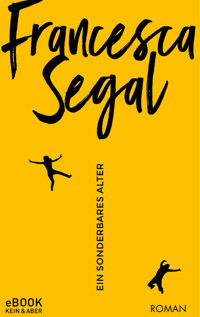18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Trotz der unerwarteten Offenbarung, wer Charlottes Vater ist, und trotz seines feindseligen Verhaltens ihr gegenüber, hat Charlotte ihren Aufenthalt auf der Insel Tuga verlängert. Sie liebt die wunderschöne Landschaft, hat die Inselbewohner in ihr Herz geschlossen, und ihre Beziehung mit Levi macht sie glücklich. Charlotte genießt die Freiheit, die die Insel im Gegensatz zu ihrem kontrollierten Leben in London bietet.
Doch London holt Charlotte wieder ein – in Form ihrer Mutter, Lucinda Compton-Neville. Als die Anwältin erfährt, dass ihre Tochter länger auf der einsamen Insel bleiben will, beschließt sie, Charlotte wieder auf Kurs zu bringen und in ihr echtes Leben zurückzuholen.
Lustig, bewegend und voller Hoffnung ist »Entscheidungen auf Tuga« ein Roman über Mütter und Töchter, über die Liebe und über das Festhalten und Loslassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Francesca Segal, 1980 in London geboren, ist Journalistin und Kritikerin. Sie veröffentlicht unter anderem im Granta Magazine, Guardian und Daily Telegraph, ist Kolumnistin für den Observer und Feuilletonistin für das Tatler Magazine. Bei Kein & Aber erschienen neben ihrem mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Debüt Die Arglosen (2013) auch Ein sonderbares Alter (2017) und Mutter Schiff (2019). Willkommen auf Tuga (2024) ist der Auftakt zur Tuga-Trilogie. Francesca Segal lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in London.
ÜBER DAS BUCH
Nachdem Charlotte herausgefunden hat, wer ihr leiblicher Vater ist, hat sie ihren Aufenthalt auf der Insel Tuga de Oro verlängert – seinem abweisenden Verhalten zum Trotz. Sie hat sich in die wunderschöne Landschaft verliebt, hat die Inselbewohner in ihr Herz geschlossen, und ihre Beziehung mit Levi macht sie glücklich. Charlotte genießt die Freiheit, die ihr die Insel im Gegensatz zu ihrem getakteten Leben in London bietet.
Doch London holt Charlotte schnell wieder ein. Als ihre Mutter Lucinda erfährt, dass ihre Tochter länger auf der abgelegenen Insel bleiben möchte, fasst sie den Entschluss, sie wieder nach London zurückzuholen. Damit steht die junge Schildkrötenforscherin vor einer Entscheidung, auf die sie nicht vorbereitet ist.
Für Miranda
Aus den Tiefen ihrer Seelehört sie eine Antwort:
»Dein Leben«, sagt die Stimme,»ist Teil des Lebens deines Volkes.
Du bist nicht davon losgelöst.«
– João Pinto Delgado,»DASGEDICHTVONKÖNIGINESTHER«
Handelnde Personen
Charlotte Walker
Gasttierärztin
Levi Mendoza
Barkeeper und Handwerker;
Charlottes Gastgeber
Dan Zekri
frisch ernannter Chief Medical Officer
Betsey »Coffee«
führt Betsey’s Café auf der Harbour Street
Elsie Smith
Zollbeamtin, Mechanikerin, Reptilienfan
Walter Lindo-Smith
Levis Schwager und guter Freund
Maia Lindo-Smith
Levis Schwester, verheiratet mit Walter, arbeitet derzeit in England
Rebecca Lindo-Smith
Maias und Walters siebenjährige Tochter, Levis Nichte
Annie Goss
zwölfjährige Inselbewohnerin
Marianne Goss
Annies Mutter, Inselbäckerin
Moz (Fermoza) Gabbai
Lehrerin der Dorfschule, Garrick Williams’ Schwester
Saul Gabbai
Moz’ Ehemann, pensionierter Chief Medical Officer
Garrick Williams
Inselgeistlicher, Moz’ Bruder
Joan Williams
Garricks Frau, kürzlich verstorben
Katie Salmon
Physiotherapeutin; erst seit Kurzem auf der Insel
Sylvester
führt den Gemischtwarenladen auf der Harbour Street
Taxi
Taxifahrer und Radiomoderator
Grand Mary
älteste (und mit Abstand
(Mary Philips)
reichste) Tuganerin
Martha Philips
Schildkröte
Weiteres Inselpersonal
Queenie Lindo-Smith
Reinigungskraft der Inselklinik
Calla & Winston
Pflegekräfte der Klinik
Nancy Gabbai
Saul und Moz’ Tochter, Teilzeit-Pflegekraft und -Barkeeperin
Vitali Mendoza
Levis Vater, Schreiner
Anwuli & Isadora
älteres Paar, betreiben eine
Davenport Schaffarm
Nicola Davenport
Inselbewohnerin
Chloe Ben-Ezra
Nicolas halbwüchsige Tochter
Natalie & Oscar Lindo
Besitzer einer kleinen Farm, Eltern von vier Kindern
Cecil Jacob Lindo
achtjähriger Sohn von Natalie & Oscar und sein dreijähriger Bruder
Lusi Zekri
Dans Mutter; Saul Gabbais Schwester
Johannes Zekri
Dans Vater, kam bei einem Bootsunfall ums Leben
Mac
besitzt einen kleinen Laden im Inselinneren
Rachel (Macs Rachel)
Inselhebamme, Kräuterkundlerin, Macs Ehefrau
Zimbul Fairclough
kürzlich gewähltes Mitglied des Inselrats
Oluchi Thomas
Radiomoderatorin; Mitglied des Inselrats
Ocean Rodrigues
Fischer
Sophie-Pearl Rodrigues
Oceans Frau
Sonstige, nicht auf der Insel beheimatet
Alex dos Santos
zwölfjähriger Inselbewohner, besucht neuerdings ein Internat in Kent
Caleb dos Santos
Alex’ deutlich älterer Bruder
Ruth dos Santos
Alex’ und Calebs Mutter, Mariannes geliebte Ziehmutter, kürzlich erfolgreich in London operiert
Lucinda Compton-Neville
Charlottes Mutter, in London praktizierende Kronanwältin
Evangeline
Lucindas persönliche Assistentin
Captain Lars
Teilnehmer an einer Charity-Regatta, Kapitän der Nussschale, die vor Tuga vor Anker geht
1
Auf der ganzen Insel waren die Mütter nervös. Die Bäume in den Zitrushainen trugen gleichzeitig Blüten und Früchte, trotz der hohen Luftfeuchtigkeit während Island Close. Wie passend war es da, dass ausgerechnet unter ihren Ästen die Lustbarkeiten des Abends inszeniert wurden. Es war Tu B’Av, das Fest der Liebe, das jedes Jahr im August stattfand, bei Vollmond, in dessen weißem Licht Liebesgeständnisse gemacht, gebrochene Herzen riskiert, vertraute Gesichter mit neuen Augen betrachtet wurden. Es gab Lagerfeuer, Musik und ein Festmahl, denn der frisch gefangene Schnapper des Tages war nicht für den bescheidenen Export eingefroren worden, sondern kam der Insel zugute und wurde über rauchenden Ölfässern gegrillt. In den Bäumen hingen Laternen, und auf dem Boden waren traditionelle tuganische Decken ausgebreitet. Dazu boten weitverzweigte Äste Verstecke, in denen man Fehler begehen konnte. Im vergangenen Jahr hatte sich die neu eingetroffene Charlotte Walker entschuldigt und war in ihrem Häuschen geblieben, weil die mit romantischen Möglichkeiten aufgeladene Atmosphäre sie nervös gemacht hatte. Sie hatte sich den Abend als einen Rausch aus Mondschein, Zitrusrauch und stillschweigendem Einverständnis vorgestellt – eine durchaus zutreffende Vision, wie sich jetzt herausstellte. Nur dass es in diesem Jahr keinen Ort gab, an dem sie lieber gewesen wäre.
An der improvisierten Bar goss Betsey Coffee kleine Mengen einer goldglänzenden Flüssigkeit in Marmeladengläser, die immer wieder ihren Weg von den Frühstücksbüffetts vorbeifahrender Kreuzfahrtschiffe auf die Insel zu finden schienen. Sie wurden überall neuen Verwendungsmöglichkeiten zugeführt, von Betseys Café bis zur Inselklinik. Etrog-Likör besaß die satte, grünlich goldene Farbe frischen Olivenöls und war dick wie Sirup. Er war stärker als Limoncello und wurde nicht aus den Früchten, sondern aus den berauschend duftenden Blättern hergestellt. Man trank ihn in einem Zug. Betsey drückte jedem, der vorbeikam, ein Gläschen in die Hand.
»Paz, Dr. Vet. Wissen Sie, was ich gerade gedacht habe? Wenn es ein Tier gibt, das Ihnen heute Nacht Probleme bereitet, dann die Moshaw-Eselin. Erfahrungsgemäß fohlen Eselstuten am liebsten bei Vollmond.«
»Danke«, sagte Charlotte und überlegte, ob sie den Likör heimlich hinter einen Baum kippen konnte. Betsey bemerkte ihr Zögern und schlug sich die Hand vor die Stirn.
»Grundgütiger, verzeihen Sie mir! Jetzt fällt mir wieder ein, dass Sie keinen Alkohol vertragen. Ich besorge Ihnen Fizzycan. Das war ein Abend neulich, was? Nach der Sause hätten Sie sicher keine fohlende Stute gebrauchen können. Sie hätten doppelt gesehen und dem Besitzer mitgeteilt, es seien Zwillinge!«
Charlotte musste sich peinlich berührt eingestehen, dass die Pensionierungsfeier des ehemaligen Inselarztes nicht gerade zu ihren Sternstunden zählte. Sie hatte an jenem Abend einen Schock erlitten und deshalb zu tief ins Glas geschaut, ein mildernder Umstand, den sie Betsey allerdings lieber nicht mitteilte. Die servierte in ihrem Café an der Harbour Street nämlich mit jedem Heißgetränk auch den neusten Klatsch und Tratsch, ein durchaus wohlmeinender Service für ihre Gäste. Charlotte wollte den Grund für ihren Schock unter keinen Umständen publik machen. Wenn sie gekonnt hätte, hätte sie auch ihre eigene Erinnerung daran ausgelöscht. Aber darüber wollte sie jetzt nicht nachdenken. Sie hoffte inständig, dass Betsey sich täuschte, was die Eselin anging. Heute Abend hatte sie frei.
Betsey nahm das Marmeladenglas zurück und gab ihr stattdessen eine Limonade. Charlotte war ihr dankbar dafür, dass sie das Thema wechselte und auf Dexter, ihren Corgi, zu sprechen kam. Er habe am Morgen auf dem rechten Hinterbein gehumpelt, später am Strand jedoch sämtliche Krabben verfolgt, es handle sich also bestimmt nur um Morgensteife, nicht wahr? Charlotte hörte zu und nickte mit einem Gesichtsausdruck, von dem sie hoffte, dass er professionell wirkte. Sie war die einzige Tierärztin auf der Insel – im Grunde hätte sie so oft über die Stränge schlagen können, wie sie wollte, die Inselbewohner hätten sie trotzdem weiter konsultieren müssen. Trotzdem, Charlottes Ansicht nach war einmal schon zu viel.
In diesem Moment sah sie Levi Mendoza durch die Dämmerung und den Lagerfeuerrauch auf sich zukommen, die dunklen Haare noch nass vom See, die Zähne strahlend weiß, als er sie erblickte und grinste. Charlotte war sich ihres eigenen Herzens noch nie so bewusst gewesen wie in diesen letzten Wochen mit Levi, hatte noch nie so sehr gespürt, wie kraftvoll und eigenständig dieser Muskel in ihrer Brust schlug, wie sehr er auf diesen charismatischen Mann reagierte, der sich ihr nun im Halbdunkel näherte. Levi schien sie verzaubert und in eine andere Frau verwandelt zu haben. Die verkrampfte, befangene Charlotte war von den Zwängen ihrer bisherigen Londoner Existenz befreit worden, hatte alles Theoretische, Defensive, Vorsichtige abgestreift. Wenn sie mit Levi zusammen war, sprach sie aus, was sie gerade dachte, kannte keinerlei Zurückhaltung, obwohl ebendiese Zurückhaltung bisher ihre Religion gewesen war. Sie erkannte sich in dieser neuen Charlotte kaum wieder, wusste eins jedoch genau: Ihr neues Ich war gefährlich, schwer aufrechtzuerhalten und vermutlich eine Verbesserung.
Nun lagen Levis Hände um ihre Taille, und er zog sie mit sich in den Schatten der Bäume, weg vom gedämpften, gelblichen Licht der Kerzen, die auf Betseys Klapptisch-Bar flackerten.
»Wie lange gedenkst du noch auf dieser Party zu bleiben?«
Er fragte es dicht an ihrem Ohr, und seine Finger hatten begonnen, hauchzart an der Innenseite ihres Oberschenkels hinaufzuwandern.
»Wir sind doch gerade erst gekommen! Ich dachte, ich muss für dich auf einer Wiese im Mondschein tanzen, während du ein Band durch die Luft schwingst. Oder so.«
Levi lachte, ihr Lieblingsgeräusch.
»Ich bin nicht hier, um bei einem uralten Balzritual eine Jungfrau auszuwählen, Dolittle. Ich weiß genau, mit wem ich nach Hause möchte und was ich dort vorhabe. Wenn dir nach Tanzen zumute ist, können wir das gern in den eigenen vier Wänden erledigen.«
Ihre Hand schlüpfte besitzergreifend unter sein T-Shirt und strich genüsslich über seinen Rücken. Für einen Moment hielt er sie fest, und sie wiegten sich hin und her, als würde gerade eine Ballade ertönen und nicht I Get Around von den Beach Boys, auf dem Akkordeon gespielt und gesungen von Taxi. Dann entdeckte Charlotte über Levis Schulter hinweg Dan Zekri, der mit einem Ausdruck irgendwo zwischen Abscheu und Neid in ihre Richtung starrte. Vielleicht war es aber auch nur Einbildung, und er hatte sie in Wirklichkeit überhaupt nicht bemerkt, sondern suchte den Zitrushain nach einem Freund oder einer Freundin ab. Sie vergrub ihr Gesicht in der Wärme von Levis Hals. Dann löste sie sich widerstrebend von ihm. So ging das nicht weiter – wenn Levi sie noch länger an sich presste, würde sie keine zehn Minuten auf diesem Fest überleben; dann würde sie keinen einheimischen Likör brauchen, um sich lächerlich zu machen. Sie verkündete, sie wolle auf die Suche nach Elsie gehen, und marschierte zielstrebig in die entgegengesetzte Richtung von Dan Zekri davon. Sicher war sicher.
Auf Tuga verwendete man getrocknete Zitrusschalen als Anzünder, daher roch es um die Lagerfeuer herum scharf und süßlich. Charlotte hatte bereits den Himmel abgesucht, aber keine herumflatternden Fledermäuse entdeckt. Da es anderswo genügend reife Früchte gab, ließen sie die Zitrushaine links liegen und machten sich stattdessen über die alten Jackfrucht- und Mangobäume weiter unten im Tal her. Sie hatte beobachtet, wie sie vor etwa einer Stunde aus ihren Unterschlüpfen gekommen und lautlos am wolkenlosen Himmel vorbeigeflattert waren. Reptilien und Amphibien würden für immer ihre große Liebe bleiben, doch die tuganischen Fledermäuse bereiteten ihr unerwartet viel Vergnügen. Als dämmerungsaktive Tiere war genau jetzt ihre Zeit.
Hoch an einer Flanke der montaña gelegen, war der Zitrushain der trockenste Punkt dieser üppig grünen, feuchten tropischen Insel, auf der die Etrogbäume wider Erwarten Wurzeln geschlagen hatten. Sie waren hier weit weg von den trockenen, sandigen Böden ihrer Heimat am Mittelmeer, gediehen aber dennoch recht passabel. Darin glichen sie den ersten tuganischen Siedlern, die mit Taschen voller Saatgut zunächst von Europa nach Recife und später vor erneuter Verfolgung von Recife in die Sicherheit, Selbstbestimmung und mondähnliche Isolation dieser winzigen, unbewohnten Insel geflohen waren, die sie Tuga de Oro genannt hatten. Sie war nun ihre Heimat, und mehr brauchten sie nicht.
2
Charlotte hatte die sanftmütige, ernsthafte Elsie noch nie in einer anderen Aufmachung als ihren wechselnden Arbeitsoveralls gesehen und stellte fest, dass sie in ihrem heutigen weißen Baumwollkleid eigenartig anrührend wirkte, auch wenn sie es mit ihren üblichen staubigen, zuverlässigen Arbeitsstiefeln kombinierte. Anstelle ihrer geliebten Baseballkappe trug Elsie einen aus frischen Mintberry-Zweigen geflochtenen Kranz. Über ihrem Arm hingen zwei weitere Kränze, als wollte sie damit beim Ringwerfen mitmachen. Sie sah verletzlich aus, ihrer Rüstung beraubt, obwohl sie Charlotte noch größer vorkam als sonst. Das weite weiße Trägerkleid entblößte die muskulösen Schultern und Arme, mit denen Elsie in ihrer Werkstatt Traktorreifen hin und her wuchtete oder im Dschungel Schildkröten für Charlotte hochhob, und gab den Blick auf eine bisher verborgene Tätowierung frei, einen rudimentären Gecko, der ihren linken Bizeps zierte. Elsie sah, dass Charlottes Blick an dem Tattoo hängen geblieben war.
»Eine Jugendsünde«, erklärte sie zärtlich und strich mit den Fingern über die verschwommenen Umrisse der Echse. »Maia hat es mir am Out the Way Beach gestochen, als wir dreizehn waren. In der Schule hatten wir ein Buch über Gefängnisse gelesen, und darin stand, die Häftlinge hätten sich früher mit Batteriesäure und einer Sicherheitsnadel tätowiert. Hat tatsächlich eins a funktioniert.«
»Mir gefällt vor allem das freundliche Gesicht«, sagte Charlotte mit gespielter Begeisterung, während ihr medizinisch geschulter Verstand schrie: Hepatitis! Sepsis! Säurevergiftung! Obwohl die längst erwachsene Elsie gesund und munter vor ihr stand, nahm sich Charlotte vor, dem Klinikpersonal zu sagen, dass Dan den sicheren Umgang mit Tätowierungen auf die Liste seiner Public-Health-Themen setzen sollte. Sie hätte es ihm selbst mitgeteilt, wenn sie derzeit miteinander gesprochen hätten.
»Du hast nicht zufällig Little Doc irgendwo gesehen? Oder Walter?«, fragte Elsie plötzlich, als hätte sie Charlottes Gedanken gelesen.
»Walter nicht. Dan stand vorhin irgendwo dahinten. Gibt es Probleme?«
»Heute Nacht nicht. Aber sie sind im Anmarsch.« Elsie runzelte sorgenvoll die Stirn. »Wenn ich nicht den Nachmittag damit verbracht hätte, mit meinem Kollegen ZD9ZS zu funken, hätte ich das Signal glatt verpasst. Hier, nimm dir einen Kranz. Du trägst ja gar kein weißes Kleid«, sagte sie, als ihr Charlottes Kleidung auffiel.
An Tu B’Av waren die Singles der Insel traditionell in Weiß gekleidet. Schon bald würden die unverheirateten Frauen der Insel mit Bändern um einen langen Maibaum tanzen, mal unter und mal über den Bändern ihrer Konkurrentinnen hindurchschlüpfen und auf diese Weise immer engere Kreise beschreiben. Wenn es nicht mehr enger ging, traten die ledigen Männer vor, griffen die ausgefransten Enden der Bänder und führten den Tanz in umgekehrter Richtung aus, hüpften in immer größer und wilder werdenden Kreisen um den Baum und befreiten ihn wieder von seinen Fesseln. Auch wenn Charlotte in letzter Zeit mehr aus sich herausgekommen war, konnte sie ihre Angst vor öffentlichen Spektakeln nicht gänzlich abstreifen. Sie sah sich beim besten Willen nicht bei diesem Ritual. Beschämt senkte sie den Blick auf ihre Jeansshorts und das weiße T-Shirt, das ihr vorhin noch als annehmbarer Kompromiss erschienen war. Ihre Turnschuhe waren ebenfalls weiß – zumindest waren sie es gewesen, bevor sie damit ein Jahr lang durch den tuganischen Dschungel gestreift war. Wenn sie ehrlich war, hatte es sie reichlich nervös gemacht, sich für Tu B’Av zurechtzumachen, ein Fest, das nur selten von LVAs (Leuten von außerhalb) besucht wurde, da es mitten in der Island-Close-Saison stattfand, wenn die Gewässer um die Insel fünf Monate lang unpassierbar waren. Es gab keinen Flughafen auf Tuga, und selbst die größten Schiffe machten um diese Zeit einen großen Bogen um die Region. Island Close war Hurrikan-Saison.
Sie hatte ohnehin keine Definition für das, was sich zwischen ihr und Levi abspielte. Ob sie Single war oder nicht, war eine schwer zu beantwortende Frage. Aber Elsie hielt ihr den Mintberry-Kranz nun schon so lange hin, dass klar war: Sie würde ihren Arm erst zurückziehen, wenn Charlotte danach gegriffen hatte.
»Du kannst ja morgen deine Schildkröten damit füttern«, sagte die praktisch veranlagte Elsie. »Ich geh dann mal weiter. Wenn du an Dan vorbeikommst, sag ihm, dass ich ihn suche.«
Charlotte versprach, das werde sie tun, auch wenn sie ganz sicher nicht vorhatte, ihm über den Weg zu laufen. Erleichtert darüber, dass ihr ein Vortrag über Amateurfunk erspart geblieben war, machte sie sich ganz im Sinne von Tu B’Av auf die Suche nach ihrem Liebsten. Sie würde ihm mitteilen, dass sie bereit war, nach Hause zu gehen.
Charlotte Walker war nun schon seit vierzehn Monaten auf Tuga de Oro. Sie hatte ihren Aufenthalt nach dem einjährigen Stipendium, das sie ursprünglich auf die Insel geführt hatte – zur Erforschung der hiesigen Reliktpopulation seltener Goldmünzschildkröten –, kurzerhand verlängert. Eigentlich hätte sie längst wieder zurück in der ordentlichen Souterrain-Wohnung im Haus ihrer Mutter sein sollen, ihrem Refugium drei Etagen unterhalb ihres ehemaligen Kinderzimmers, in dem der Küchentisch gleichzeitig als Schreibtisch diente und das einmal die Woche diskret von der Haushälterin ihrer Mutter mitgeputzt wurde. Sie hätte wieder ihre einträgliche Anstellung als Postdoc-Herpetologin in einem hellen, freundlichen Labor der Zoological Society of London aufnehmen, ihre Karriere vorantreiben, Publikationen in den richtigen Fachzeitschriften anhäufen und zielstrebig auf eine Professorinnenstelle oder ein eigenes Labor hinarbeiten sollen, oder beides. Stattdessen betreute sie als Ad-hoc-Tierärztin die Nutztiere einer exzentrischen, kollektivistischen Gemeinde, noch dazu auf der isoliertesten Insel der Welt, wohnte in einem winzigen Haus mit Palmstrohdach und schlief mit dem Mann, der es gebaut hatte.
Und es war noch so viel mehr Unvorhergesehenes passiert in letzter Zeit. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass die Suche nach ihrem Erzeuger in der Erkenntnis münden würde, dass ihr Vater Garrick Williams war, der Inselgeistliche, der nichts von ihrer Existenz geahnt und mit unmissverständlichem Entsetzen reagiert hatte, als er von ihr erfahren hatte. Der geordnete Satz Spielkarten ihres bisherigen Lebens war in die Luft geschleudert worden. Bis das Kuddelmuddel aus Karten wieder auf dem Boden gelandet war, würde sie in der Schwebe bleiben, und es war buchstäblich alles möglich.
Charlotte war als inoffizielle Inseltierärztin auf Tuga geblieben, obwohl Garrick mehr als deutlich gemacht hatte, dass er nichts mit ihr zu tun haben wollte. Es war ihr nicht richtig, ja nicht einmal möglich erschienen, einfach so nach England zurückzukehren. Die letzten Wochen waren eigenartig beständig und normal verlaufen, mit Hausbesuchen auf den hiesigen Farmen, Sprechstunden in ihrer Tierarztpraxis, Dschungelwanderungen und Schildkrötenforschung. Natürlich war die anhaltende Ablehnung durch einen Vater, nach dem sie sich ein Leben lang gesehnt hatte, alles andere als – optimal. Emotionales Chaos sorgte für gewöhnlich dafür, dass Charlotte sich schildkrötenartig in sich zurückzog und nervös in die Defensive ging. Sie hätte sich also eigentlich deutlich schlimmer fühlen müssen, als sie sich tatsächlich fühlte. Vielleicht war das Chaos noch nicht vollends zu ihr durchgedrungen. Aber es kam ihr so vor, als hätte sie durch eine Pforte ein anderes Universum betreten. Sie hatte es keineswegs eilig, in ihr bisheriges zurückzukehren. Es war schwer, traurig zu sein, wenn rosa Hibiskusblüten auf einen herabrieselten, während man im feinen, weißen Sand eines sonnendurchfluteten Strands lag und dem hemdlosen Levi dabei zusah, wie er frisch gefangenen Tintenfisch grillte. Wenn er dabei den Kopf hob und sie anlächelte, ging ein Stromstoß durch ihren Körper. Dann fühlte sie sich unsterblich. London war die Realität, aber hier auf Tuga genoss sie – wenn auch nur vorübergehend – eine hochwillkommene Pause von sich selbst.
3
Als Elsie Walter aufstöberte, stand er vor der Band und hörte zu, in der Hand die Überreste einer gebackenen Banane, die ihm gerade seine Tochter Rebecca gegeben hatte.
»Zwei Tagesreisen entfernt, hieß es, vielleicht auch drei«, sagte Elsie leise, weil sie das kleine Mädchen nicht beunruhigen wollte. Es stand dicht neben seinem Vater und hatte einen Finger in dessen Gürtelschlaufe gehakt.
»Und der Zustand des Patienten ist wirklich so schlimm, dass er es nicht dahin zurückschafft, wo er in See gestochen ist?«
»Vermutlich Herzinfarkt. Oder zumindest Herzprobleme. Lebensgefährlich, meint der Captain. Ist keine schicke Jacht, sondern eine dieser Nussschalen, die an Challenges teilnehmen, um Spendengelder zu sammeln.«
Walter zog am Schild seiner Kappe, rückte sie zurecht und dachte nach. Wer ihn kannte, wusste, wie seine Antwort ausfallen würde. Trotzdem wartete Elsie respektvoll, bis er es aussprach.
»Tja, dann müssen wir es wohl versuchen, nicht wahr?«
Es war keine Frage, sondern ein Beschluss. Walter war der Chef der Küstenwache, und als solcher traf er nach Beratung mit dem Chief Medical Officer sämtliche Entscheidungen, was Evakuierungen aus medizinischen Gründen anging. Die Inselbewohner waren in Sachen Handel und Fortbewegung von Beginn an vom vorbeifahrenden Schiffsverkehr abhängig gewesen, und wenn sich die seltene Gelegenheit bot, sich zu revanchieren, zögerten sie nicht lange. Im letzten Jahr hatte beispielsweise ein Crewmitglied eines Frachtschiffs mit Ziel Walvis Bay eine Blinddarmentzündung erlitten; außerdem kam es trotz Satellitentechnik und verbesserter Wettervorhersagen auch heute noch manchmal zu verheerenden Schiffbrüchen. Tuga selbst hatte mehrere Männer verloren, als vor sechs Jahren ein Fischerboot verunglückt war, eine Tragödie, die bis heute viele Inselfamilien erschütterte. Es war Walters Boot gewesen, auch wenn er selbst durch einen Zufall nicht an Bord gewesen war.
Während Island Close hätte eigentlich kein Schiff nah genug an Tuga sein dürfen, um die hiesigen Seeleute durch einen Notruf in Gefahr zu bringen, aber wenn die durchgegebenen Koordinaten des Segelboots stimmten, würde es Wochen benötigen, um zu seinem Ursprungshafen zurückzukehren. Man brauchte keinen Chief Medical Officer, um zu wissen, dass ein Patient mit Herzproblemen schnellstmöglich an Land musste.
»Ich kenne das Boot natürlich nicht, aber wir lotsen es besser nicht bis direkt an die Tangwälder heran, für den Fall, dass das Wetter umschlägt. Falls die Crew ein Beiboot hat, soll sie es auf keinen Fall zu Wasser lassen – damit käme der Tod schneller als mit jedem Herzinfarkt. Nein, ich fahre raus.«
Walters Tochter Rebecca stand fest an ihn gedrückt da, wie sie es schon fast den ganzen Abend tat. Sie drehte den Kopf und schmierte Schokolade von ihrer Wange auf sein Hemd. Als Kind eines Fischers kannte sie die Gefahren des Meers während Island Close, genauso wie sie die Geschichte des unglückseligen Fischerboots von vor sechs Jahren kannte, in dem ihr Vater mitgefahren wäre, wenn er sich nicht am Vorabend einen Nagel in den Fuß gerammt hätte. Im Südatlantik konnte fallender Luftdruck ohne jede Vorwarnung Stürme von achtzig Knoten aufpeitschen, und die Strömungen waren selbst bei ruhiger See tückisch. Strömte das Wasser eben noch aufgewühlt dahin, konnten sich im nächsten Moment schon hohe, wütende Wellen türmen, hinter denen sich schwindelerregende Täler entfalteten. Rebeccas Vater legte ihr seine große, beruhigende Hand auf den Rücken und zog sie näher an sich heran.
»Alles gut, mi vida«, sagte er leise. »Es muss nun mal sein. Mir wird schon nichts passieren.« Um das Gespräch auf sichereres Terrain zu lenken, erklärte er an Elsie gewandt: »Falls wir den Patienten erfolgreich an Land bekommen und er seine Herzprobleme überlebt, haben wir ihn allerdings bis Island Open an der Backe.«
»Bis dahin sind es noch circa neun Wochen. Na ja, könnte schlimmer sein. Wir haben leerstehende Häuser, die Unterbringung ist also kein Problem. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Häuschen von Ruth dos Santos?«
»Der Inselrat müsste zahlen, und Marianne hätte finanzielle Unterstützung durch die Miete.«
»Sehr gut. Sie kann ein bisschen Glück gebrauchen«, gab ihm Elsie recht. »Ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, dass Annie das mit Alex’ Abreise so schwernimmt.«
»Selbst wenn, ihr blieb ja nichts anderes übrig«, antwortete Walter, der besser als die meisten wusste, welche Opfer die Inselmütter bisweilen bringen mussten, um die Zukunft ihrer Kinder zu sichern. Seine eigene Frau arbeitete nun schon seit über einem Jahr in England. Seit sie weg war, war Rebecca fünf Zentimeter gewachsen und hatte drei Zähne verloren.
Elsie nickte. »Wir bringen die evakuierte Person also bis Island Open in Ruths Haus unter. Falls wir es schaffen, sie an Land zu bringen. Und falls sie nicht bis dahin schon tot ist.« Sie setzte Rebecca ihren letzten Mintberry-Kranz auf und trat zurück, um das Mädchen zu bewundern.
»Wir treffen uns morgen früh an der Werft und bereiten alles vor«, sagte Walter. »Gib doch bitte Dan Bescheid, wenn du ihn siehst. Und jetzt ist es Zeit für Marshmallows!«, verkündete er und wuchtete sich Rebecca mit plötzlicher Entschiedenheit auf die Schultern. Ihr finsteres Gesicht verzog sich zu einem Lachen. Als sie sich vorbeugte, spürte er durch seine Baseballkappe hindurch ihr kleines, spitzes Kinn. Nachdem er mit jeder Hand ein Fußgelenk umfasst hatte, nickte er Elsie noch einmal zu und stapfte zu einem der Lagerfeuer davon. Morgen würden sie die Planung konkretisieren, auch wenn sie beide wussten, dass die Rettungsaktion am Ende vielleicht gar nicht mehr nötig sein würde. Der Herzpatient musste noch zwei, vielleicht sogar drei Tage auf hoher See überleben, und – was noch wichtiger war – eine von Walter geleitete tuganische Crew musste mit dem Schlauchboot der Insel auf das feindliche, erbarmungslose Meer hinausfahren.
»Sind die immer noch nicht fertig?« Annie Goss trat mit dem nackten Fuß gegen die in Alufolie gewickelten Bananen, die am Rand des Lagerfeuers in der Glut lagen, eine Reihe dicker, silberner Stangen. Sie waren heißer als gedacht, und Miss Moz beobachtete, wie sich Annies Gesicht vor Schreck und Schmerz verzog. Das Mädchen gab keinen Laut von sich, wich nur einen Schritt zurück und verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. Moz drehte sich zu den anderen Kindern um und schwang ihre Grillgabel durch die Luft.
»Ihr verzieht euch jetzt alle von hier. Weg mit euch!«
Mit der freien Hand schob sie Annie noch ein Stück vom Feuer weg, drückte dann tröstend ihre Schulter und fuhr ihr durch die zerzausten blonden Haare. Dieses Kind könnte auch über glühende Kohlen laufen, ohne mit der Wimper zu zucken, dachte sie, und diese Erkenntnis versetzte ihr einen Stich. Sie hatte es noch nie erlebt, dass Annie Schwäche zeigte. In all den vielen Jahren als Insellehrerin war ihr nie eine Wildheit begegnet, wie Annie sie besaß. Aber zauberhaft war es auch, dieses Mädchen, denn hinter ihrer draufgängerischen Art verbargen sich bedingungslose Loyalität und ein weiches Herz. Miss Moz hatte grundsätzlich keine Lieblingsschüler. Es fiel ihr dennoch schwer, ernst zu bleiben, wenn Annie während des Unterrichts für Alex dos Santos herumkasperte. Oder vielmehr herumgekaspert hatte. »Geht noch fünf Minuten spielen«, sagte sie nun zu den Kindern. »Wenn ihr die Bananen anstarrt, werden sie auch nicht schneller gar. Ich rufe euch dann.«
Ihre Schützlinge murmelten missmutig vor sich hin und verschwanden in der Dunkelheit. Sie würden nicht weit weggehen, schließlich hatte sich jedes Kind bereits seine persönliche Banane reserviert.
Annie rieb sich die Seite ihres schmutzigen Fußes am Knöchel des anderen. Sie schien sich tatsächlich verbrannt zu haben – Moz konnte es in der Dunkelheit nicht genau erkennen. Unter normalen Umständen hätte sie die Sache auf sich beruhen lassen, wohl wissend, dass Annies Mutter Marianne nichts entging. Doch seit Alex aufs Internat in England geschickt worden war, blieb Annie bis spät in die Nacht fort und kam auch nicht mehr zu den Mahlzeiten nach Hause. Sie trauerte, und Miss Moz litt mit ihr mit. Es war, als wäre dem Mädchen der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Annie war mit Alex aufgewachsen, die beiden waren Hand in Hand durchs Leben gegangen. Schon als Babys waren sie gemeinsam durchs Haus gekrabbelt wie zwei tollpatschige Welpen, hatten nachts aneinandergeschmiegt geschlafen und den warmen Atem des jeweils anderen eingesogen. Alex war Annies Heimat gewesen – das einzige Leben, das sie kannte, war an seiner Seite. Zusammen waren sie jeden Tag über die Insel gestreift, bis die erste lautlose Fledermaus über den bleichen Abendhimmel geflattert war. Aber Alex war fort, und heute, sechs Wochen nach dem zwölften Geburtstag der beiden Kinder, war für alle offensichtlich, dass seine Abwesenheit Annie vollkommen aus dem Gleichgewicht gerissen hatte. Die Entscheidung, ihn nach England zu schicken, war so plötzlich getroffen worden, dass sein Verschwinden sie wie ein Todesfall getroffen hatte. Seit das Schiff mit Alex davongefahren war, hatte sie kein einziges Wort mehr mit Marianne geredet.
»Wo ist deine Mutter?«, fragte Moz.
Annie zuckte mit den Schultern und senkte den Blick. »Wahrscheinlich backt sie mal wieder.«
»Was meinst du mit ›wahrscheinlich‹? Wenn sie arbeitet, solltest du ihr helfen! Zeig mir mal deinen Fuß.«
»Sie braucht meine Hilfe nicht«, antwortete Annie mürrisch. Sie hakte ihre Zehen hinter der Wade des anderen Beins ein. »Meinem Fuß gehts gut.«
Moz beschloss, das Thema auf sich beruhen zu lassen. Mit der Grillgabel rollte sie eine Banane auf das struppige Gras, hob sie mit einer Zange auf und legte sie auf einen Teller. Anschließend zog sie mit den Fingernägeln behutsam die Alufolie auseinander, woraufhin der Duft von frischer Vanille aufstieg, von Kokoszucker, reifer Banane und schmelzender Schokolade. Annies Augen wurden rund und gierig. Moz wusste, dass das Mädchen bei ihr bleiben würde, solange sie den begehrten Schatz als Pfand in der Hand behielt, also beeilte sie sich zu sagen: »Im Gegenteil, kerida, sie braucht dich jetzt mehr, nicht weniger. Ich weiß, wie sehr dich das alles mitnimmt, glaub mir. Ich sehe doch, wie schlecht es dir geht. Du hast nicht nur deinen Ziehbruder verloren, sondern all eure Pläne, all eure Vorstellungen von der Zukunft. Dir wurde eine Hälfte deines Herzens genommen. Aber deine Mama hat Alex aus Liebe nach England geschickt, das musst du verstehen. Sie hatte nur diese eine Chance, den Jungen loszulassen und ihm eine bessere Zukunft zu schenken, und die hat sie genutzt. Trotzdem: Sie hat ihn von klein auf großgezogen und leidet genauso sehr wie du.«
»Jemanden wegzuschicken, ist doch keine Liebe!«
Moz zermanschte das Innere der Banane mit einer Gabel. Sie ließ sich Zeit damit, wohingegen sie ihre Worte eilig hervorbrachte.
»Du hast bestimmt schon öfter gehört, wie jemand gesagt hat, er hätte endlich nach vielen Jahren verstanden, warum ein anderer Mensch etwas Bestimmtes getan hat. Bei dir wird es ebenso sein, auch wenn du dir das jetzt noch nicht vorstellen kannst. Deine Mama würde für dich sterben.« Sie hielt Annie den Teller hin, jedoch ohne ihn loszulassen. Für einen Moment standen sie sich gegenüber, Frau und Mädchen, den Teller in der Mitte. Moz betrachtete Annies abgeknabberte, entzündete Nägel, ihre Fingerknöchel, die rot waren, weil sie den Teller so fest umklammerte.
»Ich hasse sie!«, stieß Annie leise hervor.
4
Charlotte hatte gerade konzentriert die drei Flaschen Schuppenshampoo für Herren im Regal von Sylvesters Gemischtwarenladen angestarrt und sich gewünscht, eine davon würde sich in 300 Milliliter Shue Uemura verwandeln, als Anwuli Davenport sie auf die Schulter tippte, um mit ihr über ihren Border Collie zu sprechen. Die Hündin fühle sich offenbar äußerst unwohl und rutsche auf dem Hinterteil über den Hof. Charlotte hatte sie zu ihrer heutigen Vormittagssprechstunde einbestellt und beugte sich nun in ihrem Behandlungsraum über den Computer, begierig darauf, dass endlich die Website lud und sie noch einmal die genaue Position der Perianaldrüsen bei Hunden nachlesen konnte. Die Klinik besaß zwar die schnellste Internetverbindung der Insel, aber sie war immer noch schrecklich langsam.
Es klopfte an der Tür, und Elsie kam auf Socken herein, die Arbeitsstiefel in der Hand. Die Zollbeamtin trug wieder ihren abgewetzten dunkelblauen Overall, der an Knien und Ellbogen mit Stonewashed-Flicken verstärkt und am Revers von Hand mit Elsie Mechanikerin bestickt war, in zitronengelbem Garn. Auf ihrer verwaschenen grünen Baseballkappe stand Küss mich, ich bin aus Irland, was möglicherweise auf die Kappe, jedoch ganz sicher nicht auf Elsie zutraf. Heute war sie Mechanikerin, und an Schiffstagen mutierte sie zur offiziellen Zollbeamtin Tuga de Oros. An wieder anderen Tagen engagierte sie sich als begeisterte Amateurfunkerin im Kommunikationswesen und lotste vorbeifahrende Schiffe mithilfe eines UKW-Funkgeräts durch die tückischen Gewässer. Wenn sie doch einmal freihatte, was selten vorkam, assistierte sie Charlotte bei ihrer Forschungsarbeit im Dschungel, und als Mitglied der Feuerwehr von Tuga de Oro stand sie immer dann parat, wenn sie gebraucht wurde. Doch Elsies größte Leidenschaft waren neben Dampfzügen, Uhren und Elektrogeräten Reptilien, worin Charlotte und sie wider Erwarten eine Gemeinsamkeit entdeckt hatten.
»Paz, Dr. Vet. Darf ich reinkommen?«
»Natürlich. Ich hab Zeit, bis mein nächster Patient auftaucht. Die Schuhe kannst du gern anlassen, ich weiß nicht, wie sauber der Boden ist.«
»Du wartest auf Anwuli«, teilte ihr Elsie hilfsbereit mit, als könne es Charlotte entfallen sein. »Sie müsste in zehn Minuten hier sein – hat noch einen Zwischenstopp bei Betsey eingelegt, um dir was mitzubringen.«
Wie immer staunte Charlotte darüber, dass die Einheimischen jederzeit zu wissen schienen, wo sich ihre Mitinsulaner gerade aufhielten. Und dennoch gibt es auf Tuga jede Menge unentdeckte Geheimnisse, dachte sie und schüttelte den Kopf, um die störenden Gedanken an Garrick zu vertreiben. Sie betrachtete Elsie genauer.
»Alles okay bei dir?«, fragte sie.
Elsie zuckte mit den Schultern. »Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt nicht mit Hilary, sie wirkt so kraftlos. Und sie ist in letzter Zeit ein bisschen … dicker geworden.« Die letzten beiden Wörter flüsterte sie, als ob die Echse sie hören und beleidigt reagieren könnte. »Aber sie frisst kaum was, also verstehe ich nicht, warum.«
»Vertrau deinem Gefühl. Wenn du meinst, dass etwas nicht stimmt, müssen wir Hilary untersuchen.«
Elsie hatte sich inzwischen an Charlottes Schreibtisch gesetzt, um ihre Stiefel wieder zuzuschnüren. Als sie aufblickte, schien sie den Tränen nahe zu sein.
»Heute Morgen wollte sie noch nicht mal ein Tölpel-Ei fressen! Wer sie kennt, weiß, dass das total untypisch für sie ist.«
»Sobald meine Sprechstunde vorbei ist, komme ich zu dir und untersuche Hilary gründlich«, versprach Charlotte, und Elsie lächelte sie dankbar an.
Hilary war ein großer Roter Teju mittleren Alters, den Elsie als Schlüpfling bekommen und aufgezogen hatte. Als Zollbeamtin hatte sie zwei dieser Jungtiere von Segeltouristen beschlagnahmt, die die Echsen aus Argentinien mitgebracht hatten, jedoch keine Exportgenehmigung dafür vorweisen konnten, geschweige denn eine Erlaubnis, sie für ihren einmonatigen Aufenthalt auf Tuga an Land zu bringen. Die Segler hatten die beiden Teju-Babys weitgehend klaglos herausgerückt, waren sie mit den speziellen Haltungsbedingungen doch schon jetzt restlos überfordert, zumal auf See. Eine der Jungechsen war innerhalb weniger Tage verstorben, wie Elsie Charlotte erzählt hatte, vermutlich aufgrund mangelnder Pflege. Die andere war Hilary. Offenbar hatte Elsie damals beschlossen, dass ein einzelnes Teju-Weibchen ohne dazugehöriges Männchen keine Gefahr für die Biosicherheit der Insel darstellte, und Charlotte brachte es nicht übers Herz, sie darauf hinzuweisen, dass der Schutz vor eingeschleppten Krankheiten mindestens ebenso wichtig war wie das Verbot von Zucht und Haltung invasiver Arten. Das Tier hätte eingeschläfert werden müssen. Aber der Vorfall hatte lange vor Charlottes Amtszeit als Inselveterinärin stattgefunden, und so ging sie das Ganze im Grunde nichts an. Hilary war inzwischen zwölf Jahre alt und eine imposante Echse mit gehobenen Ansprüchen. Wenn sie in der richtigen Stimmung war, konnte sie so anschmiegsam und zugänglich sein wie ein junger Hund. Und sie war ein bildschönes Tier – geschmeidig und wohlgerundet, höchstwahrscheinlich sogar überfüttert. Aber Charlotte hütete sich davor, Ernährungsratschläge zu erteilen, wenn sie nicht danach gefragt wurde. Sie würde Hilary am Nachmittag untersuchen und bei dieser Gelegenheit vorsichtig nachhaken, wie es um den Speiseplan des Teju bestellt war.
Elsie verabschiedete sich genau in dem Moment, als draußen das Scharren von Hundekrallen zu hören war. Kurz darauf schob eine Hundeschnauze die Praxistür auf. Sie gehörte einem hübschen Border Collie in der Farbe Blue Merle, der eine Frau von Anfang achtzig hereinzog. Anwulis kurze weiße Haare waren unsichtbar unter ihrem großen geflochtenen Strohhut, ihre Jeanslatzhose war bis unters Knie hochgerollt, und um die Taille trug sie eine prall gefüllte Bauchtasche, die, wie der abblätternde Aufdruck verriet, von einer Pharmakonferenz stammte, die 1986 in Boston stattgefunden hatte. Anwuli lächelte zur Begrüßung und hielt Charlotte ein Glas mit Eiskaffee hin. Sie hatte eine nicht unerhebliche Strecke über holprigen Boden damit zurückgelegt, und Charlotte hastete herbei, um es ihr abzunehmen, dankbar dafür, dass Elsie sie vorgewarnt hatte. So hatte sie ihren eigenen Kaffee vor einer Minute in den Ausguss kippen können. Auch wenn die meisten Inselbewohner nur wenig Geld hatten, fanden sie immer einen Weg, Charlotte für ihre Dienste zu entlohnen.
»Oh, lecker«, bedankte sie sich. »Genau das, was ich jetzt brauche!«
»Aus Betseys Café. Sie hat mir gesagt, dass Sie ihn so am liebsten mögen. Das Eis ist auf dem Weg hierher leider geschmolzen, aber er ist trotzdem noch kalt.«
Anwuli setzte sich auf den Drehstuhl, auf dem eben noch Elsie gesessen hatte. »Außerdem hat mir Isa noch die hier mitgegeben. Nach der Behandlung können Sie sicher was Süßes zur Aufmunterung gebrauchen.« Aus einer verblichenen Teppichstofftasche zog sie drei unbeschriftete Gläser Marmelade in Bernstein, Orangerot und Safrangelb und reihte sie auf dem Schreibtisch auf. »Ananas, Papaya und Mango.«
Zu ihren Füßen stand der Border Collie aufrecht da, den Kopf zur Seite gelegt, und betrachtete Charlotte mit einem braunen Auge und einem eisblauen. Charlotte legte ihrerseits den Kopf schräg. Dann streichelte sie das seidige Ohr des Tiers.
»Ach, schon in Ordnung, das gehört dazu. Das mit der Marmelade ist wirklich sehr großzügig von Isadora. Vielen Dank an Sie beide.«
»Wir hatten die Hoffnung, dass Cilla die Sache schon selbst geregelt hat – nachdem sie mit dem Hintern über den ganzen Hof gerutscht ist. Früher habe ich mich immer darum gekümmert, aber mit meiner Arthritis geht das nicht mehr so leicht. Und Isa sieht nicht gut genug mit ihren Katarakten. Wir müssten eigentlich längst im Ruhestand sein. Die arme Cilla, sie hat es schon schwer mit uns.«
»Cilla wird sich sofort besser fühlen nach der Behandlung. Ich untersuche sie noch schnell, und dann fangen wir an.«
Charlotte band sich die Haare zurück und schlüpfte in violette OP-Handschuhe aus Gummi. Die OP-Masken waren ihr ausgegangen, aber sie wollte keine Zeit damit vergeuden, ihren kleinen Tierarztbereich zu verlassen und in die Klinik hinüberzugehen, wo sie sich mit Dan Zekris eigenwilligem Aufbewahrungssystem herumschlagen musste – und mit der Tatsache, dass er die medizinischen Vorräte für den Humanbereich nur höchst ungern herausrückte. Cilla, die Hütehündin, arbeitete hart für Anwuli und Isadora, nicht nur, indem sie deren kleine Schafherde bewachte, sondern auch im Haus, wo sie Türen öffnete und schloss, Haushaltsgegenstände aufhob, die zu Boden gefallen waren, und die Eier in dem kleinen Hühnerhaus der Farm einsammelte, um sie anschließend vorsichtig in einem Korb auf einer niedrigen Bank im Hof abzulegen. Sie ersparte ihren betagten Besitzerinnen viel Mühe und war ein hochgeschätztes Familienmitglied, das es verdient hatte, von seinem Unbehagen erlöst zu werden.
Charlotte schob eine Trittleiter an ihren Untersuchungstisch heran, und Anwuli zeigte darauf. Cilla sprang die Stufen hoch und baute sich so stolz auf dem Tisch auf, als wäre sie bei einer Hundeshow. Sie besaß keine Leine und hatte auch noch nie ein Halsband getragen, aber ihre Disziplin war vollkommen. Das Fell um ihre Augen war silbergrau, und ihre lange Schnauze schwarz-grau gefleckt, ein Gepardenmuster in gedeckten Tönen. Charlotte beugte sich hinunter, um die Hündin zu untersuchen. Sie musste sich eingestehen, dass sie allmählich Gefallen an Säugetieren fand, und ließ es zu, dass Cilla im Gegenzug auch sie mit der Nase erkundete. Die intimeren Beziehungen, die man zu Säugetieren einging, mochten gewisse Risiken bergen, aber man wurde hundertfach entschädigt.
»Kein Wunder, dass sie ihr Hinterteil über den Hof gezogen hat, sie hat verzweifelt versucht, den Druck zu lindern. Ansonsten ist sie in sehr guter Verfassung.«
Die Tür des Klinikflurs, von dem auch der Tierarztraum abzweigte, ging auf, dann waren Stimmen zu hören. Charlotte fuhr unbeirrt fort, denn sie wollte die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen. Als Studentin hatte sie den Eingriff zwar an einem Modell geübt, aber die Umsetzung an lebenden Tieren konnte sie an einer Hand abzählen. Erst legte sie Cilla einen Maulkorb an. Die fügsame Hündin senkte ein wenig gedemütigt den Kopf und warf Charlotte mit einem eisblauen und einem hellbraunen Auge einen Mitleid heischenden Blick zu.
Anwuli hielt Cilla am Riemen des Maulkorbs und beugte sich vor, um auf sie einzureden.
»Jetzt sei nicht albern, kerida. Es ist gleich vorbei, und danach bist du wieder ein glückliches und zufriedenes Mädchen.« An Charlotte gewandt, sagte sie: »Wir hatten die letzten Jahre keinerlei Probleme, was dieses Thema angeht.«
»Sie ist inzwischen mehr im Haus als früher, oder?«
»Ja. Ist auf ihre alten Tage ein bisschen bequem geworden. Wem geht es nicht so?«
»Ich könnte mir vorstellen, dass ihre Ernährung sich verändert hat, seitdem sie weniger draußen ist, und dass ihr Stuhl nicht mehr hart genug ist, um die Drüsen effektiv zu leeren.« Um möglichst viel Zuversicht auszustrahlen, redete Charlotte unbekümmert vor sich hin, während sie Gleitmittel aus einer Tube drückte. »Im Prinzip ist nicht sie selbst bequem geworden, sondern ihre Verdauung. Ihr Kot ist einfach weicher als früher.«
Sie hob den wedelnden Schwanz der Hündin an und führte einen Finger in ihren Anus ein. Cilla reagierte kaum. Charlotte starrte konzentriert in die Ferne und versuchte, sich ihre tiermedizinischen Lehrbücher vor Augen zu führen. Ihrer Erinnerung nach befanden sich die Analbeutel auf vier und acht Uhr, was bedeutete, dass sie am besten mit dem rechten anfing.
Auf dem Flur wurde es plötzlich laut, Dan erhob aus irgendeinem Grund ungehalten die Stimme. Charlotte runzelte die Stirn. Sie ertastete die rechte Perianaldrüse, die stark angeschwollen war, und begann, den Druck zwischen Daumen und Zeigefinger zu erhöhen. Die Drüse entließ problemlos eine überraschend große Menge wässrig schwarzen Ausflusses, der an Teer erinnerte und ekelerregend stank – nach Höllensümpfen, Hundekot und vergammeltem Fisch, wie Charlotte insgeheim dachte. Der dicke Wattebausch, den sie mit der anderen Hand darunter hielt, war sofort durchtränkt. Als sie überzeugt war, dass die Drüse leer war, warf sie ihn in einen Edelstahlbehälter, griff nach einem neuen Bausch und bewegte ihr Handgelenk so, dass sie die linke Drüse in Angriff nehmen konnte. Der Winkel war nun sehr viel unangenehmer.
Der Tumult auf dem Flur nahm weiter zu. Dan Zekri schien sich über irgendetwas furchtbar aufzuregen. Er konnte überraschend cholerisch sein, zumal er es in letzter Zeit nicht leicht gehabt hatte. Trotzdem wäre es Charlottes Ansicht nach schlauer gewesen, wenn er ein paar Mal tief durchgeatmet hätte. Jetzt hörte sie eine Stimme, die nach Walter Lindo-Smith klang. Im Wartezimmer der Klinik schien ein regelrechtes Wortgefecht stattzufinden.
»Sie haben Menschenleben aufs Spiel gesetzt!« Das kam von Walter.
»Und unsere knappen Ressourcen vergeudet!«, sagte Dan.
Und dann ergänzte überraschenderweise Elsies Stimme das Trio. Mit untypischer Bestimmtheit erklärte sie: »Das ist illegale Einwanderung, nichts anderes.«
Da war die Drüse, Charlotte hatte sie ertastet. Fest wie eine Weintraube und fast genau mittig zwischen Zeigefinger und Daumen, trotz des unangenehm verdrehten Handgelenks. Die Diskussion vor der Tür wurde unterdessen noch hitziger, und Charlotte vernahm eine zweite Frauenstimme, herrisch, schneidend und laut.
»Was für ein sinnloses Affentheater. Ich habe Ihnen doch gesagt, warum ich hier bin.« Ungerührt, kompromisslos. Alle weiteren Einwände im Keim erstickend.
Charlottes Hand krampfte sich zusammen, und Eiter schoss zäh und stinkend aus dem Anus der Hündin und spritzte auf ihren Arm, ihr T-Shirt und ihr Gesicht. Genau in diesem Moment flog die Tür auf, und herein trat in einer Wolke aus Dior und Missbilligung ihre Mutter.
5
Auf irgendeine Weise – durch welchen teuflischen Akt auch immer – war Lucinda Compton-Neville nach Tuga de Oro gelangt. Es war, als wäre es der Moment an sich, der Charlotte mit Horror vollspritzte, eine Angstreaktion wie bei einem Tintenfisch. Nicht nur der Gestank von Eiter verstopfte ihre Nasenlöcher, sondern der Eiter selbst. Mit weit aufgerissenen Augen und triefenden Wangen stand sie da und starrte ihre Mutter an. Dann drehte sie sich um und erbrach sich in die Nierenschale.
»Meine Güte!« Lucinda zog ihren hauchdünnen, zartlila Paschminaschal vor Nase und Mund. »Was für eine Begrüßung, Darling!«
Charlotte sah sich panisch im Raum um. Ihr Blick blieb an Dan hängen. Er schnappte sich eine Handvoll Papiertücher und stürzte auf sie zu, wobei er seine Nase in der Armbeuge vergrub.
»Guay de mi, das ist ja … Ich wollte vorausgehen und dich warnen, aber …«
»Mummy? Was ist hier los? Wie bist du …«
»Der Notruf von dem Segelboot«, erklärte Dan und legte ihr aufmunternd die Hand auf den Rücken, während sie sich verzweifelt sauber zu wischen versuchte. Er blieb neben ihr stehen, eine beruhigende Präsenz, wenn auch eine, die hörbar durch den Mund atmete. »Uns wurde gesagt, es sei ein Passagier mit lebensbedrohlichen Herzproblemen an Bord. Und wie sich herausgestellt hat, war dieser Patient deine Mutter.«
»Ich stehe direkt hier, junger Mann, und kann hervorragend für mich selbst sprechen«, sagte Lucinda und bedachte Dan mit einem Blick, unter dem er sichtlich in sich zusammenschrumpfte.
Charlotte verstand überhaupt nichts mehr.
»Geht es dir gut?«, stammelte sie besorgt und hörte auf, an ihrem Gesicht herumzuschrubben, um näher an ihre Mutter heranzutreten, die warnend eine Hand hob und zurückwich. Anwuli ließ Cillas Maulkorb los, und die Hündin stupste mit der Nase zärtlich Charlottes Arm an. Für sie war die Welt wieder in Ordnung, nun, da ihr Unbehagen ein Ende hatte. Das Unbehagen der Menschen im Raum fing hingegen gerade erst an.
»Hast du lebensbedrohliche Herzprobleme?«, fragte Charlotte ihre Mutter krächzend.
»Ach, das …« Lucinda wedelte mit der Hand, in der sie den Schal hielt, drückte den Stoff jedoch schnell wieder über Nase und Mund. »Ich erinnere mich, dass ich von einer Herzensangelegenheit gesprochen habe, und vielleicht habe ich auch gesagt, dass es dabei um Leben und Tod gehe. Diese kleinen Funkgeräte haben nicht gerade die klarste Wiedergabe, weißt du, schon gar nicht auf hoher See. Wenn meine Aussagen wörtlich genommen wurden, ist das wohl kaum meine Schuld.«
»Walter ist mit dem Motorboot rausgefahren«, stieß Dan hervor, dessen Wut wiederaufflammte. »Er und Elsie haben ihr Leben dabei riskiert, die Krankentrage zum Segelboot zu bringen. Das Meer ist lebensgefährlich um diese Jahreszeit, und der heutige Tag war keine Ausnahme. Warum um alles in der Welt mussten Sie auf eine Trage geschnallt und per Rettungsboot an Land gebracht werden?«
»Weil ich unter Schock stand. Davon habe ich mich inzwischen vollständig erholt«, antwortete Lucinda leichthin. »Allerdings brauche ich dringend eine Tasse Tee. In diesem Raum kann ich jedenfalls nicht länger bleiben, hier stinkt es buchstäblich zum Himmel. Charlotte, ich verstehe wirklich nicht, wie du mit diesen unsäglichen Arbeitsbedingungen zurechtkommst.«
»Verstopfte Analdrüsen«, murmelte ihre Tochter wie aus den Tiefen eines Albtraums.
»Ist der Eingriff beendet?«, fragte Anwuli zaghaft. Genau wie alle anderen hatte sie Charlottes Mutter angestarrt wie eine Erscheinung. Jetzt schüttelte sie ihre Schockstarre ab und wurde aktiv. »Soll ich Cilla wieder mit nach Hause nehmen, Dr. Vet, was meinen Sie? Ist sie fertig? Sie scheinen jetzt erst mal mit anderen Sachen beschäftigt zu sein.«
»Was? Oh, ja, sie ist fertig. Allerdings bräuchte sie vielleicht ein Schaumbad.«
»Könnte sein, dass du diejenige bist, die ein Schaumbad braucht«, sagte Dan leise in ihr Ohr, und Charlotte musste trotz der widrigen Umstände lachen. Lucinda sah Dan mit hochgezogenen Augenbrauen an, und sein Grinsen erstarb. Einzig Elsie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, ihre Professionalität war unerschütterlich. Sie trat einen Schritt nach vorn und wandte sich an Charlotte.
»Diese Frau behauptet, sie wäre deine Mutter. Wir müssen feststellen, ob das der Wahrheit entspricht, damit die Einwanderungsbehörde weiß, wie sie weiter verfahren soll.«
Dan nickte und knurrte etwas von »Straftatbestand«. Er versuchte, Lucinda beim Arm zu nehmen, aber sie schüttelte ihn ab.
»Könnt ihr endlich aufhören, so einen Zirkus zu veranstalten? Natürlich bin ich Charlottes Mutter! Im Übrigen macht mich das zur Angehörigen eines gebürtigen Insulaners. Dadurch habe ich doch sicherlich Anspruch auf ein Touristenvisum, oder welches Dokument ihr auch immer von mir verlangt, bis Lars wiederkommt, um uns abzuholen. Wenn jetzt bitte alle zurücktreten und uns in Ruhe lassen würden? Sie sind uns im Handumdrehen wieder los, versprochen. Ich bin nur hier, um meine Tochter nach Hause zu holen. Warum glotzen Sie denn alle so, in drei Teufels Namen?«
»Es darf niemand auf der Insel bleiben, der keine Schiffspassage zur Abreise vorweisen kann«, beharrte Elsie stur auf den Vorschriften.
Lucinda lachte entnervt auf.
»Oh, keine Sorge, abreisen werden wir, so viel ist sicher. Und bis dahin: Wo ist Charlottes verfluchter Vater?«
Sämtliche Blicke richteten sich auf Charlotte, die mit dem Saum ihres ruinierten T-Shirts hektisch an sich herumgewischt hatte und nun mitten in der Bewegung innehielt. Sie spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht stieg, denn sie hatte den Tuganern das erzählt, was sie selbst bis vor sechs Wochen geglaubt hatte: dass sie keinen Vater habe, ihm nie begegnet sei, keine Ahnung habe, was dessen Identität anging. Von der schockierenden Entdeckung, dass Garrick ihr Vater war, wusste nur Levi.
In diesem Moment erschien Garrick Williams höchstselbst in der Tür, und alle drehten sich zu ihm um. Dan verspürte Erleichterung – hier war der Inselgeistliche, genau der Richtige, um diesen Streit zu schlichten.
Garrick wirkte verwahrlost. Vierzig Jahre lang hatte sich seine Frau Joan um alle praktischen Belange seines Lebens gekümmert, um den Terminkalender, den Haushalt, sein Äußeres. Und dann war sie vor fünf Monaten gestorben, und er hatte es noch nicht geschafft, sich wieder in den Griff zu bekommen. Seine stahlgrauen Locken waren zu lang geworden und wucherten unter einer rosa Baseballkappe hervor, und seine schweren Brauen waren gerunzelt, ein Ausdruck, der ihm inzwischen zur ständigen Gewohnheit geworden war. Wie immer mied er es, Charlotte anzusehen, auch wenn der Gestank, der eindeutig von ihrer Ecke des Behandlungszimmers ausging, bewirkte, dass er einen irritierten Blick in ihre Richtung warf. An Dan gewandt, sagte er: »Moz meinte, ich solle herkommen, es gäbe einen Notfall. Werde ich gebraucht? Kann ich bei irgendetwas helfen?«
»Ha!«, stieß Lucinda triumphierend hervor. »Da ist er ja. Meine Güte, Garrick, vor dreißig Jahren in London hattest du auch schon so eine hässliche Kappe auf. Seis drum. Wie ihr seht, habe ich die Wahrheit gesagt: Charlottes Vater ist da und kann alles aufklären. Los, Garrick. Mach dich nützlich und bürge für mich.«
Wie in Zeitlupe drehten sich alle von Lucinda zu Garrick Williams um, den seit Urzeiten verheirateten Geistlichen, die unanfechtbare moralische Instanz der Insel. Ihren Prediger, der über jegliches noch so geheimes Handeln der Mitglieder seiner Gemeinde sein Urteil fällte. Garricks Gesicht durchlief für alle sichtbar ein erstaunliches Spektrum an Farben: orangebraun, aschgrau, leuchtend rot, gespenstisch weiß. Sein Mund öffnete und schloss sich. Er kniff die Augen zu, als wollte er aussperren, was er vor sich sah, dann hob er zitternd die Hand, um sein Gesicht dahinter zu verbergen, als wäre er beim Versteckspiel mit dem Zählen dran. In dieser Haltung verharrte er, vollkommen reglos, vollkommen still. Während Dan und Elsie ihn anstarrten, wurde Charlotte erneut von Übelkeit überwältigt. Sie fuhr herum und übergab sich lautlos ins Waschbecken.
6
Als Charlotte aus der Dusche kam, hatte sich ihre Mutter eine Tasse Tee aufgegossen und ihren in kaum erkennbare Unordnung geratenen blonden Chignon wieder zur Perfektion gebracht. Wenige Stunden zuvor war Lucinda – auf eine wacklige Trage geschnallt – über die Reling einer kleinen Segeljacht in ein Motorboot hinuntergelassen worden, während um sie herum die stürmische See toste. Und dennoch deutete nichts darauf hin, dass sie eine abenteuerliche Anreise hinter sich hatte, sie sah absolut makellos aus. Ihr einziges Zugeständnis an die hohe Luftfeuchtigkeit war, dass sie ihren Blazer und ihren Schal ausgezogen hatte. Diese vertrauten Londoner Kleidungsstücke hingen nun am Treppengeländer, auf Charlottes einzigem guten Kleiderbügel. Es kam ihr völlig undenkbar vor, dass ihre Mutter auf Tuga de Oro war, und doch stand sie hier und trank Earl Grey aus einer eleganten kleinen Tasse mit Untertasse, die Charlotte noch nie in der Küche gesehen hatte, obwohl sie seit über einem Jahr in diesem Häuschen lebte. Lucinda sah sich demonstrativ um, als nähme sie den Raum zum ersten Mal zur Kenntnis.
»Was für ein niedliches kleines Mäuseloch. Sagtest du nicht, dein Bett stünde in der Küche? Ich kann mir nicht vorstellen, wie es hier hineinpassen sollte.«
»Es stand aber wirklich hier. Levi, mein Gastgeber, hat es endlich ab- und im ersten Stock wieder aufgebaut.« Damit wir ungestört sind, wenn wir zusammen darin liegen, fügte sie in Gedanken hinzu und wandte sich rasch ab. Ihre Mutter hatte schon immer die unheimliche Fähigkeit besessen, in ihrem Gesicht zu lesen. »Hast du Hunger? Möchtest du irgendetwas essen?«
»Ich wurde länger von wütenden Ozeanen durchgerüttelt als Odysseus, im Moment mag ich an Essen nicht mal denken. Diese Tasse Tee ist genau das, was ich jetzt brauche, und vielleicht einen Chiropraktiker.«
Charlotte kam näher und rubbelte sich mit einem Handtuch die Haare trocken, woraufhin Lucinda wie eine Verkehrspolizistin die Hand hob und die Nase rümpfte. »Ich würde sagen, du bist noch nicht ganz aus dem Schneider, was den Gestank angeht. Was in Gottes Namen hast du eigentlich mit dem armen Tier gemacht? Ach, erzähl es mir lieber nicht. Schwamm drüber. Es gibt wichtigere Dinge, über die wir uns unterhalten müssen.«
Charlotte wich unsicher einen Schritt zurück und schnüffelte an sich selbst.
»Ich werde einen olfaktorisch geeigneteren Moment abwarten, um mein Anliegen in aller Ausführlichkeit darzulegen, aber wenn du gern die Kurzfassung hören möchtest, hier ist sie: Ich habe allmählich die Nase voll. Du hast deinen Standpunkt klargemacht – ja, du bist wirklich sehr mutig, beeindruckend und unabhängig –, und jetzt ist es an der Zeit, nach London zurückzukommen und dein echtes Leben weiterzuführen.«
Charlotte wartete, wohl wissend, dass noch mehr folgen würde. Wenn Lucinda in Fahrt war, blieb einem nichts anderes übrig, als stillzuhalten, während der Tsunami anschwoll, über einen hereinbrach und alles zerstörte, bevor er irgendwann wieder abebbte.