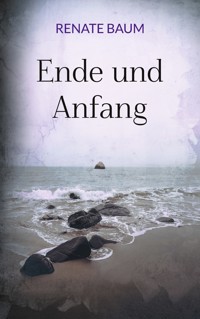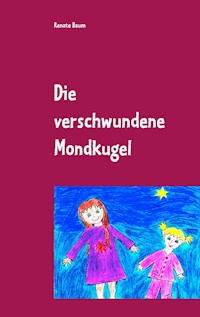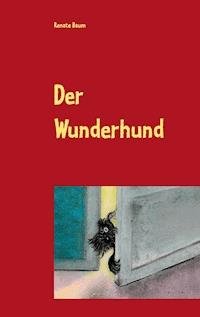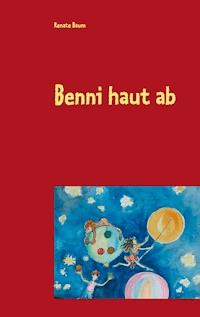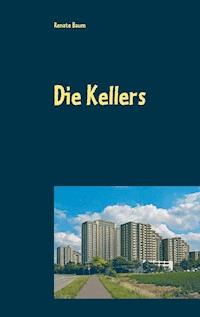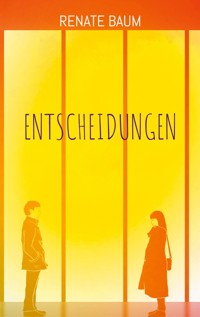
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Reise nach Köln In den 1980ern reist eine Frau von Berlin zu ihrer Freundin nach Köln, um in Ruhe und Gesprächen mit ihr zu entscheiden, ob sie sich von ihrem Mann trennt oder bei ihm bleibt. Im Zug überdenkt sie ihr bisheriges Leben und lernt unter anderen einen Mann kennen, mit dem sie in Köln einige wunderbare Tage verbringt. Ein Unfall ihres Sohnes ruft sie zurück nach Berlin. Der Zweck der Reise ist noch nicht erreicht. Aber irgendwann wird sie sich entscheiden müssen. Sprachlose Beziehung Die Erzählung beschreibt die lange, schwierige, verkantete Beziehung eines Priesters zu einer Frau aus seiner Gemeinde. Schließlich trifft er eine Entscheidung. Es gibt zwei Enden - Die Leserin oder der Leser darf die Lösung wählen, die ihr/ ihm besser gefällt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Reise nach Köln
Sprachlose Beziehung
Die Reise nach Köln
1
Obwohl die frühe Sonne einen warmen Sommertag versprach, war der Morgen noch kühl.
– Ich hätte meine Jacke nicht in die Tasche packen sollen, dachte Anne, morgens ist es eben doch immer noch nicht warm genug für kurze Ärmel. Hoffentlich komm ich nicht gleich mit einer Erkältung bei Charlotte an.
Sie fröstelte, als sie hinter ihrem Mann und ihrem Sohn, diesem hochaufgeschossenen Sechzehnjährigen, auf den sie stolz war wie auf einen ersten Geliebten, die Bahnhofshalle betrat. Als beinahe angenehm empfand sie die schwüle, verbrauchte Luft, die ihr lau entgegenschlug aus der Pfeilerhalle in Uringelb und Schmutziggrau, die so gar nichts an sich hatte von einer urbanen Bahnhofshalle. Nicht das von Ankunft- und Abfahrtzeiten diktierte bunte Wogen, nicht die erregende Symphonie menschlicher Stimmen, nicht das verheißungsvolle Überangebot an Zielen aus den Lautsprechern, das in nicht gekannte, längst geträumte Fernen lockte und dem Wartenden bis zuletzt eine Freiheit vorgaukelte, die er in Wirklichkeit mit der gelösten Fahrkarte nicht besaß: die Freiheit, in jede gewünschte Richtung aufzubrechen.
– Habe ich eigentlich meine Fahrkarte eingesteckt? Ach ja, sie liegt als Lesezeichen im Buch. Und der Personalausweis? Der müsste in der roten Brieftasche sein. Wenn ich den nicht dabei habe, gibt’s Probleme mit den VoPos.
Und doch war auch dies einmal ein »richtiger« Bahnhof gewesen, ehe man die Stadt in vier ungleich große Tortenstücke geteilt hatte. Das alte, noch aus jenen Tagen stammende Gemäuer, das von Ruß, von Straßenstaub und den Abgasen der endlosen Fahrzeug-Karawane fast schwarz geworden war und nicht mehr gereinigt wurde, seit das Bahngelände zwar in diesem Teil der Stadt stand, aber jenem Teil gehörte, das Gemäuer und der gedrungene Glastunnel, der den mageren Gleiskörper kraftvoll umspannte und dessen einstige Schönheit sich trotz der erblindeten Scheiben noch erahnen ließ, hätten Zeugnis ablegen können von der verschollenen Zeit.
Heute war der Bahnhof ein Ort der Hoffnungslosen. Hier erschlug man das Zuviel an Zeit, suchte die trügerische Wärme einer Wohnung, die man nicht besaß, verkaufte alles, einschließlich den eigenen Körper, wähnte sich für kurze Zeit in der fernen Weite Anatoliens. Ein Zufluchtsort für Menschen ohne Menschen. Ziellos schlendernd konnte man die Halle kaum mehr betreten, ohne Gefahr zu laufen, missverstanden zu werden, eindeutige oder verschlüsselte Angebote zu erhalten. Ihren ohnehin raschen Schritt hatte sie immer noch ein wenig beschleunigt, wenn sie spätabends oder an Feiertagen zu lange hinausgezögerte Geburtstags- oder Weihnachtssendungen im durchgehend geöffneten Bahnpostamt hatte aufgeben wollen und dazu die Halle durchqueren musste.
An diesem Morgen hätte sie sich Zeit lassen können, denn sie war in Begleitung. Aber heute drängte der Fahrplan, der zwar nicht mit Sicherheit eingehalten wurde, dessen pünktliche Erfüllung auch nicht mit Sicherheit auszuschließen war.
– So spät schon! Immer dasselbe. Nie schaffen wir es, pünktlich zu sein. Warum eigentlich nicht? Anderen gelingt das doch auch. Aber bei uns wird getrödelt und getrödelt. Und niemand kommt auf die Idee, mir ein bisschen zu helfen.
Wie immer bei Terminen in den frühen Morgenstunden waren sie zuletzt ins Stolpern geraten mit der Zeit. Das schwerfällige Wachwerden, das mühsame Wecken der Familie, die nur zögernd in die übliche Behändigkeit gleitenden Bewegungen, dieses aufwändige Anlassen dreier Motoren, die ohnehin unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten besaßen, hatten Zeit gekostet, die nun fehlte. Der Blick musste geradeaus in Zielrichtung gehen, durfte nicht beliebig umherschweifen.
Und doch konnte sie nicht umhin, den in die Ecke geworfenen, noch oder schon neben seiner Flasche liegenden alten Mann wahrzunehmen – ein ganz normales Bild auf diesem Bahnhof, an dem kaum jemand noch Anstoß nahm, ausgenommen die Touristen, die an andere Bahnhöfe und andere Anblicke gewöhnt waren.
Wie jedes Mal von solchen Bildern war sie auch vom Anblick des hilflosen Alten schockiert, fühlte Beschämung. Nicht, weil »solcher Abschaum den Fernbahnhof verschandelte«, wie eine Boulevardzeitung jüngst geschlagzeilt hatte, sondern weil sie ein diffuses Schuldgefühl verspürte. Schuldig, an einem hilflosen Menschen vorbei zu hasten, ohne innezuhalten, ohne sich ihm zuzuwenden. Dieser Alte lag hier und war vermutlich am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Und sie war im Begriff, den D-Zug von Moskau nach Paris zu besteigen, um aus der Distanz von Köln zu Berlin höchst komfortabel die eigenen Probleme zu betrachten.
Das Bild des liegen gebliebenen Alten begleitete sie die Treppe hinauf und wollte auch nicht weichen, als sie sich bereits auf dem zugigen Bahnsteig aufs Warten einrichteten.
Alexander bemerkte die zurückgezogene Stille der Mutter als Erster, deutete sie aber dieses Mal völlig falsch.
In dem Maße, in dem sich das Verhältnis seiner Eltern zueinander zerklüftet hatte, sich ungehalten sperrte oder in Gleichgültigkeit erstickte, hatte die Beziehung zwischen Sohn und Mutter an Nähe gewonnen, so dass der Sohn mit seiner beobachtenden Anteilnahme häufig Schwingungen in den Stimmungslagen der Mutter wahrnahm, die anderen entgingen. Da er bemüht war, die brisante Atmosphäre in der Beziehung der Eltern zu entschärfen, ein Bestreben, das oft sogar erfolgreich war und das seiner um drei Jahre jüngeren Schwester noch völlig abging, versuchte er auch jetzt, die Mutter mit einer lässig-flapsigen Bemerkung wieder einzufangen, dabei aber den Vater nicht auszuschließen.
»Sieh mal, Papa, Mama hat jetzt schon Heimweh!«
Der Vater erwiderte nichts, warf nur einen kurzen Blick auf das Gesicht der Mutter wie auf etwas Unerlaubtes, Unschickliches. Aber die Mutter hatte Alexander erreicht, das war ihm gelungen. Sie holte ihren Blick aus der Ferne zurück und sah den Sohn lächelnd an.
»Ja, ja, Familienbande«, sagte sie ernsthaft, »jede Trennung – ein halber Weltuntergang«, aber Alexander bemerkte in ihren Augen jenes Glimmen, das ihm sagte: Es ist alles in Ordnung mit ihr. Der Widerspruch zwischen dem gleichmütigen Gesichtsausdruck und diesem Glimmen in den Augen, der Widerspruch zwischen Gesagtem und Gemeintem, verwirrte oft sogar Freunde der Mutter. Alexander jedoch entdeckte das Funkeln in ihren Augen immer sofort, und er liebte die Mutter auch um dieses Funkelns willen. Ihre ironisch-distanzierte Art, ihre trockene Schlagfertigkeit beeindruckten den Sechzehnjährigen, der sich seinerseits tapfer, aber nicht immer erfolgreich um Distanz und Gelassenheit bemühte und sie hier so mühelos, fast spielerisch vorgeführt bekam.
Anne vermied es, ihrem Mann Peter ins Gesicht zu sehen, in diese beleidigt-indignierte Maske, die er angelegt hatte an dem Abend, als sie ihm mitgeteilt hatte, sie werde zur Klärung der Verhältnisse für zehn oder vierzehn Tage zu Charlotte nach Köln fahren, und seitdem nicht wieder abgesetzt hatte. Nur zu gut kannte sie diesen Blick, der mehr den Zorn eines zurückgewiesenen Kindes als die Trauer eines verletzten Erwachsenen ausdrückte, kannte ihn von Anbeginn ihrer Ehe an, hatte in den ersten Jahren darunter gelitten, konnte nun damit leben, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten. So lange allerdings wie dieses Mal hatte er seine Jetzt-bin-ich-aber-böse-Miene noch nie gepflegt, hatte sie sonst nach ein bis drei Tagen unvermittelt wieder abgenommen oder nach widerwilligen Bemühungen von ihrer Seite – Einlenken, Entgegenkommen – aufatmend beiseite gelegt.
Seit acht Tagen trug er dieses Leiden zur Schau, das Schuldgefühle, Rücksicht, zumindest fragende Anteilnahme wecken sollte, was diesmal bei ihr jedoch nicht verfing. Ihren Entschluss zu reisen hatte sie nicht wieder verworfen, obwohl oder gerade weil sie wusste, dass er, Peter, fest damit gerechnet hatte.
Ihr Vorhaben ließ sich um so reibungsloser verwirklichen, als die Kinder, »Alexander der Große«, wie sie ihn manchmal in zärtlichem Scherz nannte, und Barbara, ihre lustige, oft unvermutet und unverständlich ängstliche Barbara, die trotz ihrer 13 Jahre noch so fern von der Halb-Erwachsenheit des Bruders war, Ferien hatten. Barbara war gleich nach der Zeugnisverteilung, die wie jedes Jahr bei keinem der Kinder Überraschungen gebracht hatte, zur Großmutter gefahren, zu ihrer, Annes, Mutter, die ihren Liebling, die Enkelin, in einer Weise verwöhnte, dass man befürchten musste, sie wolle in der Enkelin die ferne Tochter zurückholen, Zeit zurückdrehen, Familiengeschichte wiederholen. Noch fühlte sich Barbara in der großmütterlichen Behütung offenbar wohl; nur selten regten sich zaghafte Ansätze erster Kritik.
Peter hatte sie empfohlen, mit Alexander während ihrer Abwesenheit ebenfalls ein paar Tage zu verreisen, obwohl dies ursprünglich nicht vorgesehen war. Zu Beginn des Jahres hatten sie im Süden der Stadt, nicht weit von der Mauer, ein Häuschen erworben, sehr bescheiden zwar und zu einem äußerst günstigen Preis, doch trotzdem strapaziös für die Einkommensverhältnisse der Familie. So waren sie übereingekommen, in diesen Ferien die Stadt nicht zu verlassen und statt dessen einiges an der neuen Immobilie zu richten, auszubessern, zu verändern, zu vervollständigen. Bis sich dann die ehelichen Verstimmungen zugespitzt hatten und eine Entscheidung, ganz gleich welcher Art, erforderlich machten.
Nachdem Peter – halb ungläubig, halb beleidigt – hatte zur Kenntnis nehmen müssen, dass Anne ihren Entschluss, nach Köln zu fahren, auf keinen Fall ändern würde, hatte er seinen und Alex’ Besuch mit Grabesstimme bei seinen Eltern angekündigt, die im Fichtelgebirge lebten. Da er ihnen am Telefon Details aus seinem Eheleben weder erzählen konnte noch wollte, hatten sie seine schwunglose Sprechweise offenbar falsch interpretiert oder – noch schlimmer – überhaupt nicht wahrgenommen, sondern einfach nur ihre Freude über das unerwartete Wiedersehen mit Sohn und Enkel und ihr Bedauern über das Fehlen der restlichen Familie zum Ausdruck gebracht.
Anne wusste also alle wohl versorgt. Ein Anliegen, das sie selbst im Zorn und trotz aller vernünftigen Überlegungen über die voraussetzbare Selbständigkeit der Familienmitglieder immer wieder anfallartig überfiel. Die Bitte an Charlotte, sie für zehn bis vierzehn Tage bei sich zu dulden, war von der Freundin begeistert aufgenommen worden, und der Hinweis, dass Charlottes Urlaub leider erst eine Woche nach ihrem Eintreffen beginnen würde, hatte Anne eher erleichtert als enttäuscht, denn sie rechnete damit, dass sie für ihre Entscheidung außer dem Gespräch mit der Freundin ein ausreichendes Maß an Ruhe brauchen würde.
2
Eine Stimme mit unverkennbar südostdeutschem Dialekt kündigte den Schnellzug aus Moskau über Brest, Minsk, Warschau an, planmäßige Ankunft 7.18 Uhr, Weiterfahrt 7.34 Uhr in Richtung Paris-Nord über Hannover, Köln, Aachen, Lüttich.
Annes Herz begann heftig zu schlagen. Nicht wegen des bevorstehenden Abschieds, sondern weil die Durchsage urplötzlich Erinnerungen heraufbeschwor. Zweimal war sie, vor langer Zeit, mit diesem Zug nach Paris gefahren, damals allerdings nicht von Berlin, sondern von Hannover aus. Dort war sie aufgewachsen, in dieser gesichtslosen Öde unverbindlicher Bürgerlichkeit, die einzig dadurch Beachtung gefunden hat, dass man in dieser Stadt die reinste Form der Hochsprache im Munde führt und einmal im Jahr die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft aufwendig zur Schau stellt. Ohne Begeisterung hatte sie in dieser Umgebung gelebt, sich einfach in das Unvermeidliche gefügt. Brav, zuverlässig und wohlerzogen, wie sie war, hatte sie eigentlich recht gut in diese Stadt ohne Eigenschaften gepasst.
Dann plötzlich, an einem verregneten Tag, war Lucienne in ihr artiges Milieu eingebrochen, Lucienne, die Bilderbuch-Französin, die sie kurz, nachdem sie sich angefreundet hatten, mit nach Paris in ihre Familie genommen und im Jahr darauf erneut eingeladen hatte. Luciennes Großfamilie war in heller Begeisterung über sie hergefallen, mit einem derartigen französischen Wortschwall, dass Annes Kreislauf zum Erliegen kam. Alle hatten nur das Eine im Sinn: dass la petite Allemande sich wohlfühlte. Luciennes Bruder hatte noch ein bisschen mehr gewollt, aber sie hatte es ihm abgeschlagen. Sie hätte es nicht gekonnt und nicht gewollt, das erste Mal, im Bett neben dem des schlafenden Großvaters! Die Tage mit Jean-Pierre hatte sie als heiteren Flirt genossen, bis sie – längst wieder in Hannover – mit Erschrecken begriff, dass Jean-Pierre es ernst meinte. Einen kurzen Augenblick hatte sie überlegt, ob sie Paris zuliebe Jean-Pierre in Kauf nehmen sollte, den sie nicht liebte; denn der Stadt mit ihrem lichtgrauen, schwermütigen Charme und ihrem freien Geist war sie bei der ersten Begegnung verfallen, und die ungezwungene Lebensweise der Franzosen beeindruckte das kleine Mädchen aus der deutschen Provinz und weckte Neigungen, Wünsche und Phantasien, von deren Existenz sie keine Ahnung gehabt hatte, die sie erstaunten und auch ängstigten. Aber letzten Endes hatte für Jean-Pierre lediglich die Tatsache gesprochen, dass er Franzose war. Im nüchternen Hannoveraner Umfeld war ihr dies denn doch zu wenig gewesen. Seither aber verspürte sie jedes Mal eine Beschleunigung des Herzschlags, wenn sie Bilder von Paris sah, Berichte darüber hörte oder nur den Namen dieser Stadt vernahm.
Immer wieder hatte sie sich vorgenommen, ganz fest vorgenommen, in diese faszinierende Atmosphäre zurückzukehren, wieder einzutauchen in diese ehrwürdige Heiterkeit. Aber während der Studienjahre, in der ersten Zeit ihrer Ehe und später bei der Urlaubsplanung mit den Kindern – stets war das Reiseziel am Ende doch ein anderes gewesen.
Mit dem Gegenzug war sie einmal nach Moskau gefahren – Moskau, das so anders war, ein Mosaik aus vielen Teilen, die alle nicht zueinander passten.
Paris hatte sie nicht wiedergesehen.
Nun, die Richtung, in die sie gleich fahren würde, stimmte schon einmal. Für einen flüchtigen Augenblick erheiterte sie die Vorstellung, nicht in Köln auszusteigen, sondern durchzufahren bis Paris. Vermutlich würde es Wochen dauern, bis man sie dort fand, wenn nicht länger, denn die Familie würde in der ganzen Republik nach ihr fahnden, ehe sie auf die Idee käme, dass sie ja auch in das benachbarte Ausland entschwunden sein könnte. Dann aber: in welches? Und während dieser Zeit würde sie unbekannt und unerkannt in Paris ein Leben führen, das zwar nicht das ihre war, aber durchaus das ihre hätte sein können – wenn man davon ausging, dass für jeden Menschen noch ein paar weitere Lebensmöglichkeiten vorstellbar waren außer der, in der er sich gerade befand.
Einen Haken hatte die Geschichte allerdings – ein erstaunter, prüfender Blick ihres Mannes traf sie, sie musste geradezu aufreizend amüsiert das Gesicht verzogen haben –: Ein bisschen mehr Geld hätte sie schon bei sich haben müssen, als jetzt in ihrer Tasche steckte und als auf dem Konto überhaupt zur Verfügung stand, um sich in einer fremden Stadt unter fremden Menschen zu fremden Bedingungen ein neues Leben einzurichten. Luciennes Familie kam nach dem Unglück von Jean-Pierre mit dieser Deutschen als Rettungsseil nicht in Betracht. La petite Allemande hatte sich als leichtfertiges Mädchen erwiesen, das einem armen französischen Jungen den Kopf verdreht und ihn dann sitzengelassen hatte. Längst war diese unangenehme Episode vergessen, und Jean-Pierre hatte sich garantiert mit einer petite Française getröstet, die ihm viele Kinder, eine ordentliche Küche und ansonsten nicht viel Ärger beschert hatte. Das leichtfertige Frauenzimmer dagegen stand heute auf einem Bahnhof der einstigen Reichshauptstadt und hatte Probleme mit seinem Mann.
Den immer noch fragenden Blick ihres Mannes beantwortete Anne jetzt mit einem offenen Lächeln, aber mit keinem Wort. Zu weit hätte sie ausholen müssen, um ihre Belustigung zu erklären; zudem ermunterte der humorlose Verkehrston, der seit einiger Zeit zwischen ihnen herrschte, keineswegs zu derlei Bekenntnissen.
Nein, nach Paris würde sie nicht reisen. Nicht das fehlende Geld hinderte sie letzten Endes daran, nicht die zwiespältige Erinnerung an das Kapitel Jean-Pierre und nicht die bürgerliche Vernunft, sondern die Tatsache, dass sich seit jenen Tagen in Paris vieles verändert hatte. Die jüngsten Anschläge islamistischer Terroristen luden nicht gerade zum Besuch der Stadt ein.
3
Das »Vorsicht an der Bahnsteigkante« musste sie überhört haben, oder man hatte es einfach aufgegeben, die Reisenden vor ohnehin bekannten Gefahren zu warnen. Das Ungetüm stampfte bereits heran. Neben der zugeknöpften Hochnäsigkeit der Diesellok kam sich Anne winzig vor, und während das dumpf rumpelnde Ungeheuer vorüberrollte, war sie nicht sicher, ob es sie nicht vielleicht doch noch erfassen und zermalmen würde.
Eine schier endlose Schlange von Wagen zwängte sich in den Bahnhof hinein und kam erst zur Ruhe, als ihr Kopf den Bahnhof schon fast wieder verlassen hatte. Ein bisschen mitgenommen sah alles aus, die meisten Scheiben für den Blick nicht durchlässig, wie man es sich gewünscht hätte, und die Wagen nicht gerade ein überzeugendes Argument für den Sozialismus. Erst der freundlich-urige grüne »Spalny Wagon« versöhnte Anne mit dem östlichen Gefährt. Und schließlich kam der Zug nicht vom Bahnhof Friedrichstraße, sondern in dieser Zusammenstellung zum Teil schon aus Brest und Warschau. Dass auch die Züge vom Bahnhof Friedrichstraße kaum stärkeres Vertrauen weckten, lag nun wieder an einer der Merkwürdigkeiten der deutschen Gegenwart.
Der dunkelgrüne Schlafwagen aus der Sowjetunion kam fast unmittelbar vor ihnen zum Stehen. Obwohl sie täglich mehr mit kyrillischen Buchstaben zu tun hatte als mit lateinischen, berührte es sie jedes Mal eigenartig, wenn sie dieser behäbig archaischen Schrift außerhalb ihres hellen Arbeitszimmers mit den neugierigen Weinranken vor dem Fenster begegnete. An ihrem Arbeitsplatz waren diese Buchstaben, die den Uneingeweihten ein ehrfürchtiges Staunen entlockte, das sie stets mit dem Hinweis auf die ebenfalls erlernbare Kurzschrift abzuschwächen suchte, vertraute Normalität. Aber hier empfand sie die Wirkung der Schlafwagen-Aufschrift als exotisch, wie eine Traumsequenz aus einer fernen Welt, und obwohl sie die Buchstaben entzaubern konnte, erstand ganz plötzlich Russland wieder vor ihr. Das eine Russland, das sie sich in ihren Mädchenjahren bei der hitzigen Lektüre von Tolstoj, Gogol und vor allem Dostojewskij erschaffen hatte und von dem sie auch heute noch bisweilen träumte. Und das andere Russland, das sie selbst vor fünf Jahren erlebt hatte und das heute nicht mehr Russland hieß, sondern Sowjetunion, allenfalls – wenn man das meinte, was einmal Russland gewesen war – Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik, kurz: RSFSR. Russland, das war für sie die italienische Stadt in den nördlichen Sümpfen, die im Gold der Sonne etwas von der morbiden Schönheit Venedigs ausstrahlte, und nicht die baufälligen Kommunalwohnungen, die sich fünf und mehr Mietparteien teilten; das waren die blauen, grünen und goldenen Zwiebelkuppeln der Metropole und nicht die Schwimmbäder und Sporthallen, die unter diesen Kuppeln »arbeiteten«; das waren die einfachen, freundlichaufgeschlossenen Museumswärterinnen und Toilettenfrauen und nicht das beleidigt-barsche Personal in den Geschäften und Restaurants; das waren die Holzhäuser mit den geschnitzten Fensterrahmen und Veranden zwischen Birken auf dem Weg nach Scheremetjewo und nicht die großmäuligen, gleichförmigen Scheußlichkeiten aus Beton in den Vorstädten und im Zentrum der Hauptstadt.
Eine zum Traum geschönte Wirklichkeit hatte sie sich da zusammengebastelt, obwohl sie wusste, dass der große schlimme Meister noch immer grüßen ließ und selbst im Tod dieses Volk nicht losließ, das in schwermütiger Demut mit gefesselter Phantasie und Leidenschaft durch die Geschichte taumelte und nur im Alkohol Vergessen fand. Russland, das wäre für sie eine der möglichen Alternativen zu Paris gewesen, wenn ihr nicht allein der Gedanke an die Einschnürungen der Menschen Atemnot bereitet hätte. Aber die Menschen, die sie dort getroffen hatte, die unverbildeten, einfachen, an denen das System vorbeiglitt wie Schmutzwasserfluten an Häuserfronten, diese Menschen waren anders gewesen als viele Menschen in ihrer Umgebung. Diese Menschen schienen unberührbar, weil sie die Fähigkeit besaßen, ihr Herz zu zeigen, eine Fähigkeit, die ihr in ihrer westlichen Gesellschaft viel zu selten begegnete.
Die neue Eiszeit, die im Westen so gern beschworen wurde, das war – so sah sie es – die Kälte, die von innen kam, die Freundlichkeit ins Vergessen verbannte und böse Erfahrungen abrufbereit speicherte. Nicht umsonst fand jene Presse reißenden Absatz, in der die Brutalität noch eine schlimme Retusche erfuhr und Trivialität und Verlogenheit zur Norm wurden.
Die Russen, die sie kennengelernt hatte, würden vermutlich bei dieser Art von Berichterstattung die Achseln zucken. Sie wussten, dass es wie das Gute auch das Böse gab, dass man damit leben musste. Sie war damals erstaunt gewesen, diese ruhige Selbstverständlichkeit des Lebens in Leningrad wie in Moskau zu finden, erstaunt und beeindruckt, und war mit einem Gefühl von Wärme und Hoffnung wieder heimgefahren in den Westen, wo immer wieder Hitze erzeugt wurde, aber so selten Wärme.
4
»Dann ist es wohl so weit«, hörte sie jemanden sagen. Als sie aufblickte, stand Peter vor ihr, sie selbst bereits im Zug an der offenen Tür, vom Bahnsteig schaute Alexander forschend zu ihr hinauf, ihr Koffer war fort, wohl schon in einem Abteil untergebracht.
»Der Zug ist ziemlich voll, am besten gehst du erst einmal in den Speisewagen, da bekommst du sicher einen Sitzplatz.« Sie nickte, wusste nichts zu sagen, wusste nicht, von wem sie sich zuerst verabschieden, ob sie nach dem Koffer fragen oder ihn suchen sollte. Die Zeit drängte, und Alexander nahm ihr die Entscheidung ab. Er stürmte die halsbrecherischen Stufen zum Wagen hoch, umarmte und küsste sie zärtlich, sagte lachend: »Bleib sauber, Mama, und komm auch mal wieder!« und sprang mit einem Satz zurück auf den Bahnsteig. Peter erklärte ihr, dass sie den Koffer gleich im ersten Abteil auf der rechten Seite an der Tür finden würde, nahm sie dann unerwartet herzlich in die Arme und sagte: »Wenn du zurück bist, müssen wir noch einmal in Ruhe miteinander sprechen. Auch für mich ist das alles nicht so einfach« – küsste sie, wünschte noch das, was man Reisenden eben wünscht, trug ihr Grüße an Charlotte und Klaus auf und stand dann winkend neben Alexander auf dem Bahnsteig, während der Zug sich schwerfällig mühte, in Fahrt zu kommen. Sie ging zum nächstgelegenen Gangfenster, zog es herab und winkte zurück, bis das Wissen, dass ihr dort zwei Menschen hinterherwinkten, von dem Wissen, dass die beiden schon die Treppe hinunterstiegen, abgelöst wurde.
Nachdem sich bestätigt hatte, dass ihr Koffer im Abteil untergebracht war, sie aber keinen Sitzplatz finden würde, machte sie sich auf die Suche nach dem Speisewagen. Das erwies sich als schwieriges Unterfangen, da auch die Gänge besetzt waren mit Menschen, die sich die Klappsitzchen vor den Fenstern heruntergezogen hatten, um auf diese Weise mehr schlecht als recht zu reisen.
Während sie sich Wagen um Wagen vorkämpfte, mit einem freundlichen Dauerlächeln im Gesicht und der ständig wiederholten Entschuldigungsformel auf den Lippen, während sie über Koffer stieg, mit einem Bein fast in einer Tasche landete und mehr als einmal um ein Haar jemandem auf dem Schoß gesessen hätte, weil der Zug unvermutet in eine Kurve ruckelte, traf sie auf unterschiedliche Reaktionen, von der neugierigen Musterung über freundliches Entgegenkommen bis hin zu feindseliger Abwehr. Spätestens im zweiten Wagen wusste man ja, dass sie nicht die Toilette aufsuchen wollte, da sie bereits durch die Gangtür gekommen war. Also in den Speisewagen will die; ist wohl zu fein, wie wir hier im Gang zu sitzen! Als sie das erste Mal diesen Vorwurf im Gesicht eines älteren Mannes las, erfasste sie einen Moment lang leises Unbehagen, denn wenn auch der Speisewagen bis auf den letzten Platz besetzt war, musste sie den langen Weg wieder zurücksteigen über Menschen, Koffer, Körbe und Taschen. Das würde dann wohl kaum ohne entsprechende Kommentare abgehen. Na ja, heute würde sie es »überleben«, Angriffe und Muffeleien vielleicht mit einer schlagfertigen Bemerkung oder einem entschuldigenden Lächeln entschärfen.
Damals, auf einem anderen kläglichen Rückzug aus der Richtung, in der sich der Speisewagen eben gerade nicht befunden hatte, hatte sie erwogen, im Waschraum oder in der Toilette weiter zu reisen, um sich dann beim Halt auf den Bahnhöfen, wenn alles sowieso in bewegtes Durcheinander geriet, über den Bahnsteig Wagen für Wagen zurückzumogeln. Am schlimmsten war der Wagen mit den Bundeswehrsoldaten gewesen, in dem sie die jungen Männer, schon beflügelt von Bier und der Vorfreude auf die Nacht mit der Freundin daheim, mit anzüglichen und eindeutigen Gesten und Sprüchen begleitet hatten. Aber damals war sie ein ganz ansehnliches junges Mädchen gewesen. Derlei würde sich wohl nicht wiederholen mit einer Frau, die ihre Jugend längst abgelegt hatte!
Als ihr beim Aufstoßen einer Gangtür scharfer Kaffeegeruch entgegenwehte, war sie erleichtert. Nun musste sie nur noch einen Platz finden. Aber ihre Sorge war unbegründet. Nur wenige Tische waren besetzt, und mit Genugtuung stellte sie fest, dass sie sogar noch zwischen zwei kleinen Tischen wählen konnte.
Während sie sich auf ihrem Platz einrichtete, fühlte sie, wie ein angenehmes Gefühl der Wärme sie bis zu den Fingerspitzen durchströmte. Die Turnübung durch die Gänge hatte sie mehr verkrampft, als es ihr bewusst gewesen war.
Ein junger, hochaufgeschossener Kellner mit geradem Scheitel kam an ihren Tisch und fragte nach ihren Wünschen. Sie bestellte erst einmal ein Kännchen Kaffee, richtig frühstücken konnte sie immer noch, an regelmäßiges Frühstücken war sie ohnehin nicht gewöhnt; die erste Mahlzeit des Tages nahm sie gegen Mittag ein, in der Woche wegen der morgendlichen Hektik, die ihr den Magen verschloss, am Wochenende, weil sie länger schlief und sich die Familie erst nach den Einkäufen und der Rückkehr der Kinder aus der Schule zu einem ausgedehnten »Spätstück« zusammensetzte.
Der Kaffee wurde kühl-korrekt gereicht. Er war in sozialistischer Einfachheit gehalten, ließ sich aber trinken. Auch in bundesdeutschen Speisewagen war er nicht immer von überwältigender Qualität. Zum ersten Schluck zündete sie sich eine Zigarette an, eine hartnäckig gepflegte Gewohnheit, um so hartnäckiger, seitdem Peter mit aufwendiger Betonung und der Forderung gebührender Beachtung vor sechs Wochen das Rauchen wie den Genuss von Alkohol eingestellt hatte. Sie hatte das Rauchen nicht aufgegeben und trank nun manchmal auch ein Glas Wein mehr, als dem Verlangen nach unbedingt notwendig gewesen wäre. Nicht, dass die Abstinenz ihres Mannes sie gestört hätte – sie hielt lediglich seine mahnenden Gesundheitsexkurse, die immer einen moralisierenden Unterton enthielten, vor den heranwachsenden Kindern für unangebracht, denn die hatten durchaus miterlebt, dass der Vater ein starker Raucher gewesen war und auch kräftig hatte bechern können. Nun wollte er den Kindern weismachen, auch die Mutter rauche nicht mehr. Aber als Alexander einmal in ihrer ewig offen stehenden Tasche eine Packung Zigaretten entdeckt hatte und sie darauf ansprach, hatte sie den Kindern die Wahrheit gesagt. Aber Peter betrieb unbeirrt auch weiterhin seine Nichtraucher-Propaganda, obwohl die Kinder wussten, dass die Mutter rauchte, und obwohl sie ihm mitgeteilt hatte, dass die Kinder im Bilde waren.
Der Zug hatte seine Fahrt verlangsamt und schlich nun zögernd, unwillig über die Unterbrechung, in den Bahnhof Berlin-Wannsee. Kein Reisender verließ den Zug, und nicht einmal eine Handvoll neuer Fahrgäste stieg zu. Wütend über so viel Aufwand stampfte der Zug schwerfällig ins Freie, wo er rasch in den gewohnten Gleichlauf fiel.
Entspannt lehnte sich Anne zurück, ließ den Blick los und in die Ferne wandern. Das war für sie schon immer ein Genuss der besonderen Art gewesen: Im Speisewagen sitzen, dem Fenster viel näher als im Abteil, und in müßiger Beschaulichkeit durch Landschaften zu gleiten, einem Ziel entgegen, das zu erreichen man sich nicht mühen musste. Man hatte das Gefährt bestiegen, die Richtung bestimmt, und hatte nun keinen Einfluss mehr, konnte weder beschleunigen noch anhalten, es fuhr mit einem, aber die Gewissheit, irgendwann am Wunschort anzulangen, war allgegenwärtig. Je länger das gleichmäßige Dahingleiten währte, desto mehr fiel man dieser köstlichen Trägheit anheim, so dass man sich fast widerwillig zusammenraffen musste, wenn es hieß, die Fahrt durch Raum und Zeit zu beenden.
Überall am Bahndamm tanzten wie Ballerinen die hohen Stängel der Goldrute im Wind. Die Fülle der winzigen Blütensternchen versah das Grün ringsum mit einem bewegten gelben Band – die vielen kleinen Dinge, die vereint etwas deutlich Sichtbares bewirkten. Die Goldrute hatte sie so selbstverständlich durch ihre Kindheit zwischen Trümmergrundstücken begleitet, dass sie und ihre Freunde sie nie als Blume wahrgenommen hatten, sondern als Zubehör im Chaos der geborstenen Mauern; nicht einmal den Namen der Pflanze hatten sie gekannt. Manchmal hatten sie die hohen Stiele ausgerissen und sie als Peitschen oder Wedel für ihre Spiele benutzt. Erst als diese stolzen, sanften Stängel, die überall gediehen und mit Vorliebe in üppiger Gemeinschaft wucherten, sich auch vor dem Fenster ihres Arbeitszimmers wiegten, hatte sie sie wiederentdeckt und als Inbegriff des Sommers verstanden.
Ihre Kindheit in Hannover. Die so behütete und doch so schwierige Kindheit mit der Mutter und der Tante in zwei Zimmern und dem Vater irgendwo in den Weiten Russlands. Namen dringen an ihr Ohr, die Erwachsenen haben Mühe, sie auszusprechen, sie klingen rund und fremd, wie aus dem Märchen. Lange Jahre kennt sie den Vater nur vom Bild, empfindet die Zwiesprache, die die Mutter mit dem verblichenen Foto hinter Glas führt, als peinlich, schämt sich, man muss doch nicht laut mit diesem flachen schwarz-weißen Vater sprechen, man kann sich doch viel besser mit dem lebendigen Mann in der Ferne unterhalten, unhörbar für die anderen, die geht das nichts an, ganz dicht und vertraut. Nach langen gemeinsamen Jahren, viel, viel später, wiederholt sich die Situation: Da spricht die Mutter zu dem Grabstein, auf die selbe Weise wie zu dem Bild, in einem unnatürlich süßen Ton, wie Erwachsene mit Kindern reden, und sie, Anne, steht hilflos wütend neben der Mutter und würgt an dem Satz – Lass das, das hat er nicht verdient! –, aber sie unterdrückt den Zorn, weil es der Mutter offenbar ein Bedürfnis ist.