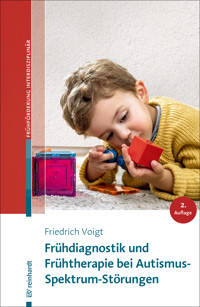31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär
- Sprache: Deutsch
Die Früherkennung und frühe Behandlung von Entwicklungsstörungen in den ersten Lebensjahren ist ein zentraler Punkt der Kinderheilkunde, Frühförderung und Sozialpädiatrie. Das Verständnis von Störungen der frühen motorischen, sprachlichen, kognitiven und sozialen Entwicklung hat sich in den letzten Jahren wesentlich verändert, weshalb eine umfassende Übersicht notwendig ist. Dieses Buch bietet einen grundlegenden Einblick in die einzelnen Formen der Entwicklungsstörungen. Jedes Kapitel klärt systematisch über Meilensteine der Entwicklung, Früherkennungszeichen für Störungen, diagnostische Methoden und Behandlungsstrategien auf. Tipps zur Elternberatung und wichtige Hinweise zum Thema Komorbidität runden das Ganze ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär – Band 23
Friedrich Voigt
Entwicklungsstörungen im Kleinkind- und Vorschulalter
2., aktualisierte Auflage
Mit 17 Abbildungen und 28 Tabellen
Ernst Reinhardt Verlag München
Dr. Friedrich Voigt, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, war viele Jahre leitender Psychologe im kbo-Kinderzentrum München.
Im Ernst Reinhardt Verlag ebenfalls erschienen:
Voigt, F.: Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen (2. Aufl. 2024; ISBN 978-3-497-61879-8)
Hinweis: Soweit in diesem Werk eine Dosierung, Applikation oder Behandlungsweise erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass der Autor große Sorgfalt darauf verwandt hat, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen oder sonstige Behandlungsempfehlungen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03290-7 (Print)
ISBN 978-3-497-61945-0 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61946-7 (EPUB)
2., aktualisierte Auflage
© 2024 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co. KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v § 44b UrhG einschließlich Einspeisung/Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise/Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von iStock.com/FamVeld (Agenturfoto. Mit Models gestellt)
Satz: JÖRG KALIES – Satz, Layout, Grafik & Druck, Unterumbach
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de · E-Mail: [email protected]
Inhalt
Einführung
1Definition des Begriffs Entwicklungsstörung
1.1Variabilität von Entwicklungsstörungen
1.2Verlaufsmerkmale von Entwicklungsstörungen
1.3Umschriebene Entwicklungsstörungen
1.4Diagnosestellung im Rahmen der medizinischen Diagnosesysteme
1.5Komorbidität
1.6Entwicklungsorientiertes Modell
1.7Prävalenz von Entwicklungsstörungen
2Diagnostische Ebenen in der Frühdiagnostik
2.1Entscheidungsschritte in der Frühdiagnostik
2.2Entwicklungsorientiertes Vorgehen
2.3Global oder bereichsspezifisch?
2.4Zeitpunkt der Diagnosestellung
3Sprachentwicklungsstörungen
3.1Verlaufsmerkmale
3.2Definition und diagnostische Kriterien
3.3Klassifikation von Sprachentwicklungsstörungen
3.4Prävalenz von Sprachentwicklungsstörungen
3.5Ursachen von Sprachentwicklungsstörungen
3.6Komorbidität
3.7Diagnostisches Vorgehen
3.8Behandlungsplanung
3.9Prinzipien der Elternberatung
4Umschriebene Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen
4.1Definition
4.2Komorbidität
4.3Prävalenz
4.4Untersuchungsschritte in der Diagnostik
4.5Therapieschwerpunkte
4.6Elternberatung
5Umschriebene kombinierte Entwicklungsstörungen
5.1Kinder mit Zustand nach Frühgeburtlichkeit
5.2Störungen der visuellen Wahrnehmung
5.3Auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen (AVWS)
6Globale Entwicklungsstörungen
6.1Definition und Verlaufsmerkmale
6.2Prävalenz
6.3Ursachen von Störungen der kognitiven Entwicklung
6.4Komorbiditäten
6.5Screening, Basisdiagnostik und komplexe Diagnostik
6.5.1Entscheidungsschritte für die vertiefende Diagnostik
6.5.2Stufenmodell der kognitiven Entwicklung
6.5.3Intelligenzdiagnostik im Vorschulalter
6.5.4Untersuchung von Kindern mit schweren globalen Entwicklungsrückständen
6.6Behandlung von globalen Entwicklungsstörungen
6.7Elternberatung
7Genetische Syndrome
7.1Fragiles X-Syndrom
7.2Down-Syndrom / Trisomie 21
7.3Williams-Syndrom
7.4Angelman-Syndrom
7.5Neurofibromatose Typ 1
8Autismus-Spektrum-Störungen
8.1Definition
8.2Verlaufsmerkmale
8.3Prävalenz
8.4Ursachen
8.5Klassifikation
8.6Komorbidität
8.7Diagnostisches Vorgehen
8.8Therapieprinzipien im Kleinkind- und Vorschulalter
8.9Elternberatung
9Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen
9.1Diagnostisches Vorgehen im Vorschulalter
9.2Therapieprinzipien
9.3Prinzipien der Elternberatung
10Soziale und emotionale Störungen im Vorschulalter
10.1Definition
10.2Verlaufsmerkmale
10.3Prävalenz
10.4Erklärungsmodelle
10.5Diagnostik
10.6Behandlung
10.7Elternberatung
11Systemische Behandlungsprinzipien
12Anhang
Glossar
Literatur
Register
Einführung
Die Früherkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen im Kleinkind- und Vorschulalter hat einen hohen Stellenwert in der kinderärztlichen Praxis, in sozialpädiatrischen Zentren und in der Frühförderung. Idealerweise möchte man Entwicklungsrückstände frühzeitig entdecken und möglichst bald die Förderung des Kindes einleiten. Dies wird oft damit begründet, dass die Stimulierbarkeit und Formbarkeit des kindlichen Gehirns und die kindliche Lernbereitschaft in den ersten Lebensjahren am größten erscheinen. Diesem Anliegen steht entgegen, dass es oft schwierig ist, die frühen Symptome von Entwicklungsstörungen in den ersten 3 Lebensjahren zuverlässig zu beschreiben und in ihrer Bedeutung für den weiteren Entwicklungsverlauf einzuordnen.
Oft genug begegnet man in der kinderärztlichen Praxis der Sorge der Eltern, mit ihrem Kind könnte etwas nicht in Ordnung sein, mit der Empfehlung zunächst abzuwarten. Trotz einer festen Abfolge von Vorsorgeuntersuchungen in den ersten Lebensjahren werden Entwicklungsauffälligkeiten relativ spät erkannt und einige langfristig wirksame Entwicklungsstörungen erst im Alter von 4 oder 5 Jahren diagnostiziert.
Hinzu kommen oft eine fehlende Eindeutigkeit in der Diagnosestellung und eine Vielzahl von Erklärungsmodellen, die dazu führen, dass die Eltern bei ihrem entwicklungsauffälligen Kind im Laufe des Vorschulalters mit sehr unterschiedlichen Diagnosen konfrontiert sind und auch ganz widersprüchliche Aussagen zu der Prognose und zu den Fördermöglichkeiten ihres Kindes erhalten.
Das Anliegen des vorliegenden Buches ist es, die Definitionen und die Verlaufsmerkmale verschiedener Formen von Entwicklungsstörungen in den ersten Lebensjahren systematisch darzustellen und zu einer frühzeitigeren Diagnosestellung und Förderplanung beizutragen. Dazu werden zwei Aspekte besonders hervorgehoben. Erstens die entwicklungspsychologische Perspektive. Es ist wichtig, die Entwicklung von Kindern mit spezifischen Entwicklungsstörungen in ihrer eigenen Dynamik und in der spezifischen Wechselwirkung mit einer Vielzahl von Einflussfaktoren zu verstehen. Der zweite Aspekt betrifft die systemische Perspektive: der Verlauf und die Beeinflussbarkeit von Entwicklungsstörungen lassen sich nur aus dem Zusammenwirken einer Vielzahl von biologischen, neurokognitiven, sozialen, psychischen und soziokulturellen Einflüssen verstehen. Entwicklungsstörungen lassen sich nicht nur als eine medizinisch definierte Diagnose definieren, sie sind vielmehr Teil eines komplexen Bedingungsgefüges. Die Anwendung der ICF-CY zur Erarbeitung von einzelnen Förderzielen in Frühförderung und Sozialpädiatrie wird im vorliegenden Buch nicht thematisiert. Dies hätte einen deutlich größeren Umfang der einzelnen Kapitel und einen anderen konzeptuellen Zugang erfordert. Die Systematik der Darstellung ist durch die klinische Praxis des Autors im Rahmen eines sozialpädiatrischen Zentrums geprägt.
Die Thematik der Entwicklungsstörungen ist überaus vielschichtig und hängt eng zusammen mit einer Vielzahl von neuropädiatrischen Krankheitsbildern. Deshalb wird in der Darstellung eine bewusste Auswahl getroffen. Dargestellt werden verschiedene Formen von spezifischen Entwicklungsstörungen, Störungen der kognitiven Entwicklung und Intelligenz. Gleichzeitig soll ein Überblick über die soziale und emotionale Entwicklung im Kleinkind- und Vorschulalter gegeben werden. Wegen der vielfältigen Fragen zum diagnostischen Vorgehen und zur speziellen therapeutischen Planung werden einige charakteristische Störungsbilder aus dem Bereich der genetischen Syndrome dargestellt. Nicht vertieft werden sollen Entwicklungsrückstände im Kontext von Sinnesschädigungen sowie von neuropädiatrischen Krankheitsbildern. Auch das Thema der psychischen Belastungsfaktoren kann hier nur am Rande behandelt werden. Anliegen des Buches ist eine praxisorientierte Darstellung der wesentlichen Formen von Entwicklungsstörungen und des Vorgehens im Rahmen von Diagnostik und Therapie im Kleinkind- und Vorschulalter.
Die Fachliteratur zu der Thematik des Buches stammt zu einem wesentlichen Teil aus dem angloamerikanischen Raum, Literaturhinweise auf einzelne deutschsprachige Publikationen finden sich am Ende der einzelnen Kapitel.
In die einzelnen Themenbereiche sind eine Reihe von Falldarstellungen eingebettet, die den Entwicklungsverlauf, diagnostische Schritte und die Fördermöglichkeiten bei einzelnen Kindern mit Entwicklungsstörungen veranschaulichen sollen. Der Name des einzelnen Kindes ist zufällig ausgewählt und Details der Familiengeschichte sind systematisch verändert, so dass eine individuelle Zuordnung zu einem konkreten Kind nicht möglich ist.
Für personenbezogene Bezeichnungen werden im Text möglichst neutrale Begrifflichkeiten für alle Geschlechter gewählt. Im Rahmen der Falldarstellungen beziehen sich die Geschlechtsbezeichnungen jeweils auf konkrete Personen.
1Definition des Begriffs Entwicklungsstörung
Die Definition von Entwicklungsstörungen umfasst mehrere Kernelemente. Bei einer Entwicklungsstörung geht man von deutlichen Rückständen wichtiger Bereiche der Entwicklung aus, die Auswirkungen auf andere Entwicklungsfunktionen, auf die soziale Integration und auf die langfristige Prognose z. B. das schulische Lernen haben können. Entwicklungsstörungen werden definiert durch Auffälligkeiten in Kernbereichen der Entwicklung, die im Zusammenhang mit einer abweichenden Entwicklung des Nervensystems stehen (Reiss 2009, Straßburg et al. 2018).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – DEFINITION –
Man spricht von einer Entwicklungsstörung im Unterschied zu einem Entwicklungsrückstand, wenn sich die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren dokumentieren lassen.
Qualitative Merkmale einer Entwicklungsstörung können sich verändern, da sich im Laufe der Entwicklung Funktionsstörungen verstärken oder aber die Schwerpunkte in den Störungsbereichen verschieben können. In der Neuropsychologie hat man dafür den Begriff des Hineinwachsens in eine Störung („growing into a disorder“) geprägt (Heubrock / Petermann 2000). Zudem können neue Fertigkeiten und Kompetenzen entstehen, die dazu beitragen, dass sich spezifische Funktionsstörungen kompensieren lassen.
Odom et al. (2007) definieren Entwicklungsstörungen als eine Summe von Fähigkeiten und Verhaltensmerkmalen, die von der Norm insoweit abweichen, als sie die soziale Teilhabe und Akzeptanz in der Gesellschaft beeinträchtigen (Odom et al. 2007, 4). Der Begriff „Entwicklungsstörungen“ ist demnach ein soziales Konstrukt, mit dem eine gemeinsame Basis für die wissenschaftliche Erforschung der beschriebenen Auffälligkeiten geschaffen wird und der Zugang zu medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen erschlossen wird (Odom et al. 2007). Die Definition bezieht sich dabei sowohl auf die Beschreibung der individuellen Fähigkeiten als auch auf den sozialen und gesellschaftlichen Rahmen.
Im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-5) (Falkai / Wittchen 2015) und in der Internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-11) (von der WHO seit Beginn 2022 international eingeführt, in Deutschland noch nicht offiziell gültig (Stand 2024)) werden die verschiedenen Formen von Entwicklungsstörungen unter der Kategorie „neurodevelopmental disorder“ klassifiziert. Auch Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und tiefgreifende Entwicklungsstörungen wurden unter dieser Kategorie eingeordnet. Diese Störungen haben eine komplexe Ätiologie mit einem hohen Anteil an genetischen Einflussfaktoren (z. B. nachgewiesen bei Autismus-Spektrum-Störungen, bei Sprachentwicklungsstörungen, bei Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS)).
Der Begriff der „neurodevelopmental disorder“ wird ins Deutsche oft mit „neuronale und mentale Störung“ oder „neurokognitive Störung“ übersetzt. Beide Übersetzungen sind nicht optimal. Auch der Begriff entwicklungsneurologische Störung erfasst etwas andere Bedeutungsnuancen.
Entwicklungsstörungen sind komplexe Störungsbilder mit einem natürlichen Verlauf, oft langfristigen Auswirkungen auf den Entwicklungsverlauf (unter Umständen bis ins Erwachsenenleben), mit deutlichem Einfluss auf die soziale und emotionale Entwicklung und mit einem erheblichen Anteil an komorbiden Störungen. Entwicklungsstörungen sind nicht nur eine Summe von Entwicklungssymptomen, die jeweils als Grundlage der Behandlung definiert werden. Im Gegenteil lassen sich Entwicklungsstörungen häufig dadurch charakterisieren, dass ein Kind veränderte quantitative und qualitative Entwicklungsprozesse durchläuft. Zudem können Entwicklungsauffälligkeiten im Laufe der Lebensspanne mit unterschiedlichen Bedeutungen für die Integration im Alltag und sozialen / kulturellen Erwartungen an die jeweilige Altersstufe in Wechselwirkung stehen.
Die Zuordnung der Entwicklungsstörungen unter den primär psychischen Störungen hat diese vielfältigen Zusammenhänge verdeckt. Das DSM-5 und das ICD-11 versuchen, ein aktuelleres Verständnis der Störungsbilder zu definieren und die neuen Forschungsergebnisse zur Ätiologie und zum Krankheitsverlauf zu berücksichtigen.
1.1Variabilität von Entwicklungsstörungen
Die Diagnosestellung von Entwicklungsstörungen ist in vielen Altersstufen erschwert durch die Überschneidungen zwischen den beobachteten Entwicklungsmerkmalen und ausgeprägten Komorbiditäten. Bei allen Formen von Entwicklungsstörungen finden wir neben der Kernsymptomatik assoziierte Entwicklungsauffälligkeiten. Dies zeigt sich am anschaulichsten bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen und bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen.
Dieses Spektrum von variablen Verhaltensmerkmalen erschwert die Diagnosestellung im Vorschulalter. Gillberg verwendet den Begriff ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neuropsychiatric / Neurodevelopmental Clinical Examinations). In den ersten Lebensjahren finden sich demnach in wichtigen Merkmalen der Entwicklung und des Verhaltens starke Überschneidungen zwischen verschiedenen Formen von Entwicklungsstörungen, so dass man zunächst nur das Profil von Entwicklungsbereichen dokumentieren, aber eine genauere Diagnose erst im Rahmen von Verlaufsbeobachtungen stellen kann (Gillberg 2010). Typische frühe Symptome umfassen motorische Auffälligkeiten, globale Entwicklungsrückstände, Sprachrückstände, soziale Defizite, Verhaltensprobleme, Hyperaktivität und Impulsivität, manchmal Hypoaktivität, Aufmerksamkeitsprobleme, Schlafprobleme und selektives Essverhalten. Diese Merkmale sieht Gillberg als Hinweise auf eine entwicklungsneurologische Störung (neurodevelopmental disorder), deren Kernsymptome und Verlauf sich erst im Laufe des Vorschulalters genauer beschreiben lassen (Gillberg 2010). Astle et al. (2022) dokumentieren die aktuellen wissenschaftlichen Perspektiven bei der Untersuchung von Kindern mit Neuroentwicklungsstörungen. Im Rahmen der transdiagnostischen Perspektive versuchen sie in ihrer Übersicht, die vielfältigen Überschneidungen zwischen verschiedenen Formen von Entwicklungsstörungen zu verdeutlichen.
Bei der Abklärung der Diagnose verfolgt man zwei Ebenen. Zum einen versucht man, eine Diagnose auf der phänomenologischen Ebene von Entwicklung und Verhaltensmerkmalen zu stellen. So beschreibt man bei einem leichten globalen Entwicklungsrückstand im Einzelnen den Entwicklungsstand der sozialen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung und dokumentiert typische Verhaltensmerkmale des Kindes. Aus dieser inhaltlichen Analyse kann eine erste Diagnose abgeleitet und eine vorsichtige Prognose gestellt werden.
Als zweiten Schritt versucht man, auch eine ätiologische Diagnose zu stellen, also die Ursache der Entwicklungsstörung herauszufinden. Bei einem globalen Entwicklungsrückstand kann sich etwa aus der Anamnese und den weiteren neurobiologischen Untersuchungen ein Hinweis auf eine frühkindliche Hirnschädigung oder ein genetisches Syndrom ergeben (Voigt, R. 2018, Shulman et al. 2011). Selbst bei Kindern mit einer eindeutig diagnostizierten Intelligenzstörung lässt sich bei einem hohen Prozentanteil die Ursache bzw. die mögliche Ätiologie der Störung allerdings nicht klären (Van Karnebeek et al. 2005).
Interessant sind Veränderungen des Entwicklungsbilds im Laufe der kindlichen Entwicklung. Dies hat zum Teil mit der Unschärfe der Diagnosestellung in der frühen Kindheit zu tun. Entwicklungssymptome können sich wesentlich verändern und eine Entwicklungsdiagnose kann im Laufe von einigen Jahren neu zugeschrieben werden. Man könnte auch sagen, dass eine komorbide Störung, die anfangs mit beschrieben wurde, nun die Kernsymptomatik darstellt.
1.2Verlaufsmerkmale von Entwicklungsstörungen
Der Zeitpunkt des Beginns und der klinischen Relevanz einer Entwicklungsstörung sind schwierig zu benennen. Manche Früherkennungszeichen sind unspezifisch und erlauben keine eindeutige Klassifikation. Es kann sein, dass sich auffällige Symptome erst zeigen, wenn in den Kompetenzen ein bestimmtes Organisationsniveau erreicht wurde.
Entwicklungsstörungen können im Verlauf Phasen von relativer Stagnation und Phasen einer scheinbar beschleunigten Entwicklung zeigen. Phasen von relativer Stagnation können durch Grenzen der Lernbereitschaft entstehen, aber auch durch Vermeidungsverhalten und emotionale Anpassungsprobleme beeinflusst sein (Abb. 1). Zudem kann sich im Übergang zum Schulalter oder im Schulalter eine Phase eines deutlichen Aufholprozesses zeigen, der die langfristige Prognose nachhaltig verändern kann.
Abb. 1: Verlaufsmerkmale von Entwicklungsstörungen
Wie lange eine Entwicklungsstörung über das Kindes- und Jugendalter hinweg besteht, lässt sich im Einzelfall oft schwer vorhersagen. Ohne Zweifel gibt es Formen von Entwicklungsstörungen, die mindestens bis zum beginnenden Erwachsenenalter oder über die ganze Lebensspanne wirksam sind. Dies gilt natürlich für viele Formen von Intelligenzstörungen. Umgekehrt finden sich Kinder und Jugendliche, bei denen eine spezifische Entwicklungsstörung nach einigen Jahren mit qualitativ auffälligen Symptomen nicht mehr nachweisbar ist. Beispiele dafür sind Symptome einer visuellen Wahrnehmungsstörung / auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung, die sich stark abschwächen, oder Symptome einer Sprachentwicklungsstörung etwa mit Auffälligkeiten der grammatikalischen Entwicklung, die man im Laufe des Schulalters nicht mehr nachweisen kann.
Entwicklungsstörungen können einen qualitativ unterschiedlichen Verlauf im Vergleich zur normalen Entwicklung zeigen, so dass ein Vergleich über ein (relatives) Entwicklungsalter unter Umständen keinen Sinn macht. Bei einem Kind könnten in einer Phase der Stagnation bestimmte Entwicklungsvoraussetzungen fehlen, die man im Einzelfall genauer überprüfen müsste. Werden Teilbereiche der Kompetenzen nur langsam aufgebaut und braucht das Kind Zeit, die verschiedenen Wissensbereiche zu integrieren, kann dies zu stufenartigen Fortschritten führen: einer Phase der Stagnation folgt wieder eine Phase, in der die Entwicklung des Kindes schnellere Fortschritte macht. Dies kann allerdings dazu führen, dass zu verschiedenen Untersuchungszeitpunkten die Ausprägung der erfassten Entwicklungsrückstände unterschiedlich groß sein kann (Abb. 2).
Abb. 2: Variable Verlaufsmerkmale von Entwicklungsstörungen
1.3Umschriebene Entwicklungsstörungen
Unter dem Begriff der umschriebenen Entwicklungsstörungen werden Störungen zusammengefasst,
■deren Beginn in den ersten Lebensjahren liegt,
■die Funktionen betreffen, welche eng mit der biologischen Reifung des Zentralnervensystems verbunden sind,
■die einen stetigen Verlauf ohne spontane Remissionen oder Rezidive (d. h. deutliche Rückfälle) zeigen (Straßburg et al. 2018).
Im ICD-10 werden unter den umschriebenen Entwicklungsstörungen unter anderem aufgeführt (Remschmidt et al. 2006):
■Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80.0, F80.1, F80.2)
■Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (z. B. Lese- und Rechtschreibstörung) (F81.0)
■Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (F82)
■Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen (F83)
In der Darstellung von Esser / Wyschkon (2008) werden umschriebene Entwicklungsstörungen als „isolierte Leistungsstörungen“ definiert. Als mögliche Ursache auf der neuropsychologischen Ebene werden Störungen in der Informationsverarbeitung und in der Handlungsplanung genannt.
Wichtige Definitionsmerkmale nach Esser / Wyschkon (2008) sind die Normalitätsannahme und die Diskrepanzannahme.
Normalitätsannahme: Bei dem Kind besteht eine normale abstrakte Denkfähigkeit, abgebildet durch einen Intelligenztest. Das Ergebnis im Testverfahren darf nicht durch die spezifischen Leistungsstörungen stark beeinflusst sein bzw. soll von den Funktionsstörungen unabhängig sein. Sonst muss man auf Intelligenztests ausweichen, welche die speziellen Intelligenzbereiche ausklammern (z. B. nonverbale Intelligenztests bei Sprachentwicklungsstörungen).
Diskrepanzannahme: Die abweichenden Funktionen liegen mindestens 1 ½ Standardabweichungen unter dem Mittelwert der Altersgruppe (oder Klassengruppe bei Schulleistungstests). Das Leistungsniveau des Kindes wird von 7% oder weniger der Bezugsgruppe erreicht. In den Forschungskriterien des ICD-10 hat man als Kriterium 2 Standardabweichungen festlegt. Das erfasste Leistungsniveau des Kindes wird von 2% oder weniger der Bezugsgruppe erreicht.
Dieses Definitionsmerkmal hängt davon ab, wie zuverlässig man die Verteilung von einzelnen Entwicklungs- und Leistungsmerkmalen messen kann. Bei Kindern vor allem im Altersbereich von 1 ½ bis 3 Jahren ist es oft schwierig, das genaue Leistungsniveau des Kindes zu bestimmen. Dann ist es gleichzeitig schwierig, die Ausprägung der Entwicklungsrückstände oder den Prozentrangwert zuverlässig anzugeben.
Entwicklungstests erfassen nicht alle Funktionsbereiche der Entwicklung, zudem lassen sich qualitative Aspekte oft schwer abbilden. Solche Grenzen sieht man etwa bei der Untersuchung von Kindern mit genetischen Syndromen. Bei Kindern mit Neurofibromatose Typ 1 findet sich häufig ein charakteristisches Bild von grob- und feinmotorischen Koordinationsstörungen gekoppelt mit Aufmerksamkeitsproblemen (Rietman et al. 2017). Diese Verhaltensmerkmale bilden sich nicht in allen Altersstufen angemessen in den verfügbaren Motoriktests ab, so dass man einerseits qualitative Auffälligkeiten der motorischen Entwicklung in der Langzeitbeobachtung beschreiben kann, die Diskrepanzdefinition im oben genannten Sinne aber nicht in allen Altersstufen erfüllt wird.
Die Grundannahmen bei der Definition von Entwicklungsstörungen werden von Thomas / Karmiloff-Smith (2002) kritisch diskutiert. Demnach geht man bei dem Diskrepanzmodell von spezifischen Entwicklungsdefiziten aus, die man im Verhältnis zu einer weitgehend normal verlaufenden Entwicklung in anderen Funktionen definiert. Bei einer Entwicklungsstörung würde man also davon ausgehen, dass der Rest der Entwicklung normal verläuft („residual normality“). Man definiert Entwicklungsstörungen dann ähnlich wie neurologische Funktionsstörungen bei Erwachsenen, die durch eine akut auftretende Schädigung entstehen. Bei Entwicklungsstörungen im Kindesalter treten die Schädigungen bzw. die atypischen Prozesse aber vor dem eigentlichen Erwerb von neuen Fähigkeiten auf. Deshalb muss man den Prozess der Entwicklung beim Verlauf einer Störung ständig berücksichtigen. Funktionsstörungen der Sprache, der Kognition oder der sozial-kommunikativen Entwicklung stehen danach in enger Wechselwirkung mit anderen Bereichen der Entwicklung (Iverson 2010). Entwicklungsdefizite werden als Störungen oder Unterbrechungen von adaptiven Lernprozessen in verschiedenen Funktionsbereichen interpretiert (Thomas 2005).
Eine weitere Frage stellt sich hinsichtlich der Erfassung einer normalen intellektuellen Entwicklung im Vorschulalter. Kann man tatsächlich davon ausgehen, dass man die Intelligenz eines Kindes unabhängig von der spezifischen Störung erfassen kann? Gelingt es z. B., die nonverbale Intelligenz bei Kindern mit Sprachstörungen unabhängig von den spezifischen Funktionseinschränkungen zu bewerten? Man geht davon aus, dass in nonverbalen Intelligenztests bei manchen Aufgaben implizite sprachliche Instruktionen oder das Verständnis von begrifflichen Zusammenhängen eine Rolle spielen (Kuschner 2013).
1.4Diagnosestellung im Rahmen der medizinischen Diagnosesysteme
Um die Entwicklungsmerkmale eines Kindes zu definieren, benennt man im Rahmen des gängigen Systems zur Klassifikation von Krankheiten (Internationale Klassifikation von Krankheiten (ICD-10)) eine Hauptdiagnose, welche die Entwicklung die nächsten beiden Jahre am stärksten beeinflusst (z. B. die Kategorien F83, F80.1, F84.0). Diese Diagnose stützt sich öfters auf quantitative Kriterien. Das Kind erreicht z. B. einen niedrigen Prozentrangwert in einem bestimmten Entwicklungsbereich – erhoben mit einem standardisierten Entwicklungstest. Bei einem Teil der Kinder wird die Diagnose aber an qualitativen Merkmalen der Entwicklung festgemacht (z. B. bestimmten sprachlichen Symptomen) (Remschmidt et al. 2006).
Das Benennen einer wichtigen Nebendiagnose im ICD-10 sollte nur erfolgen, wenn z. B. die spezifische Symptomatik verdeutlicht werden soll oder zur Begründung von spezifischen Therapieindikationen notwendig ist. Eine Auflistung von mehreren komorbiden Störungen im Diagnoseschema sollte vermieden werden. Bei einer umschriebenen kombinierten Entwicklungsstörung (F83) können in Klammern die einzelnen Funktionen aufgelistet werden (z. B. Feinmotorik, Gedächtnis, expressive Sprache) (Remschmidt et al. 2006).
Diagnosesystem im DSM-5:DSM-5 führt den Begriff der „neurodevelopmental disorders“ ein, in der deutschen Version wird dieser Begriff als „Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung“ übersetzt (Falkai / Wittchen 2015). Diese veränderte Klassifikation ist wichtig, weil viele Überlegungen auch in die ICD-11 als Neufassung der ICD-10 übernommen werden. Bei den Intelligenzstörungen und den Autismus-Spektrum-Störungen werden verschiedene Schweregrade nach den Symptommerkmalen und dem Maß an sozialer Unterstützung definiert. Die Systematik enthält einige Verschiebungen in der Zuordnung, die im ICD-11 weiter geprüft werden. Im DSM-5 ist es zulässig, dass mehr als eine Entwicklungsstörung im Diagnoseschlüssel aufgeführt wird, es wird nicht mehr davon ausgegangen, dass sich bestimmte Diagnosen zwingend ausschließen müssen (Falkai / Wittchen 2015). Zum Beispiel kann bei einem Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung eine zusätzliche Sprachentwicklungsstörung oder eine Intelligenzstörung diagnostiziert wird. Dies wird auch heute schon im ICD-10 in der klinischen Praxis so gehandhabt, ist aber eigentlich nicht im Sinne der einzelnen Definitionen von Entwicklungsstörungen.
Diagnosesystem im ICD-11: Im ICD-11 hat man die Klassifikation neu zusammengestellt und ordnet die Entwicklungsstörungen unter dem Leitbegriff der entwicklungsneurologischen Störung (neurodevelopmental disorder) ein. Damit wird eine Reihe von Störungen zusammengefasst, die sowohl die kognitive als auch die sozial-kommunikative Entwicklung beeinflussen, deren Ursachen als multifaktoriell gelten und die einen chronischen Verlauf haben, der bis ins Erwachsenenalter reichen kann (Gaebel et al. 2024). Diese Störungen werden von emotionalen Störungen unterschieden, die sich aus den Belastungen und dem Verlauf der psychosozialen Entwicklung ergeben, die nur in einer bestimmten Lebensphase auftreten können und sich nicht chronisch entwickeln müssen.
Die Einführung des ICD-11-Systems ist vorläufig für Januar 2022 geplant. Diese Systematik der Entwicklungsstörungen ist im Wesentlichen identisch mit dem DSM-5 und wird dem Oberbegriff der „neurodevelopmental disorders“ zugeordnet. Auch hier können bestimmte Diagnosen parallel zueinander auftreten z. B. Autismus-Spektrum-Störung und Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung, man versucht also den Aspekten der Komorbidität besser Rechnung zu tragen. Im ICD-11 werden die folgenden Störungsbilder der Kategorie der entwicklungsneurologischen Störungen (neurodevelopmental disorder) zugerechnet (WHO 2024):
■Intelligenzstörungen
■Entwicklungsstörungen der Sprache und des Sprechens
■Autismus-Spektrum-Störungen
■Entwicklungsstörungen des Lernens
■Entwicklungsstörungen der motorischen Koordination
■Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen
■Stereotype Bewegungsstörungen
■eine Restkategorie „andere entwicklungsneurologische Störungen“ (other neurodevelopmental disorder)
Der Vergleich der Klassifikationen in ICD-10, DSM-5 und ICD-11 (Tab. 1) zeigt, dass einzelne übergeordnete Begriffe unterschiedlich verwendet werden. Wichtig sind aber im Vergleich die spezifischen Definitionsmerkmale, so hat das ICD-10 insgesamt 5 Formen von Autismus unterschieden, die man nun im DSM-5 und im ICD-11 unter einem Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ zusammenfasst. Verändert haben sich auch die Definitionen der Schweregrade und die Beschreibung von unterschiedlichen Ebenen der erforderlichen Unterstützung im Rahmen der Intelligenzstörungen. Im ICD-11 hat man zusätzlich spezifische Merkmale zur Beschreibung der Entwicklungsstörungen („specifiers“) eingefügt, die z. B. einzelne Untergruppen von Autismus-Spektrum-Störungen oder von Sprachentwicklungsstörungen kennzeichnen (WHO 2024).
Tab. 1: Klassifikation von Entwicklungsstörungen im ICD-10, DSM-5 und ICD-11
Vergleich der Klassifikationssysteme von Entwicklungsstörungen mit Fokus auf das Vorschulalter
ICD-10
DSM-5
ICD-11
Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80.x)
Kommunikationsstörungen
Entwicklungsstörungen der Sprache und des Sprechens
Umschriebene Entwicklungsstörung schulischen Lernens (F81.x)
Spezifische Lernstörung
Entwicklungsstörungen des Lernens
Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (F82.x)Tic-Störungen (F95.x)
Motorische Störungen: Entwicklungsbezogene KoordinationsstörungStereotype BewegungsstörungenTic-Störungen
Entwicklungsstörungen der motorischen Koordination
Stereotype Bewegungsstörung (F98.4)
Stereotype Bewegungsstörung
Umschriebene kombinierte Entwicklungsstörung (F83)
Frühkindlicher Autismus (F84.0)Weitere Formen von Autismus (F84.x)
Autismus-Spektrum-StörungAbstufungen im Schweregrad und komorbide Störungen
Autismus-Spektrum-Störungmit Beschreibung verschiedener Unterformen
Intelligenzminderung mit Schweregraden definiert über Intelligenzbereiche (F70.x)
Intellektuelle Beeinträchtigungen mit unterschiedlichen Schweregraden
Intelligenzstörungen mit Abstufungen in den Schweregraden
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.x)
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäörung
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen
Klassifikationssystem ICF-CY: Werden mit der Einführung des ICF-CY die Diagnosesysteme an Bedeutung verlieren? Im Rahmen des ICF-CY spielen die medizinischen Diagnosen zunächst eine Rolle bei der Definition der Gesundheitsprobleme bzw. „Gesundheitssorgen“ (Pretis 2020). Um Behandlungsziele zu definieren, ist ein genaues Verständnis der Stärken und Schwächen eines Kindes notwendig. Diagnosen können Grenzen und Funktionseinschränkungen definieren, die im Rahmen der Formulierung von Zielen für die Teilhabe ständig berücksichtigt werden müssen. Das ICF-CY wird also die medizinischen Diagnosesysteme nicht ersetzen. Die Anwendung der ICF-CY zur Erarbeitung von Förderzielen im Rahmen von Frühförderung und Sozialpädiatrie wird in der vorliegenden Darstellung aus Platzgründen ausgeklammert. Die medizinischen Diagnosesysteme haben Fragen der sozialen und persönlichen Einflussfaktoren und das Thema Teilhabe zunehmend in die Diagnoseschemas miteingearbeitet. Dies betrifft die multiaxiale Diagnostik im Rahmen der ICD-10 und ICD-11 und die mehrdimensionale Bereichsdiagnostik, die im Rahmen der Sozialpädiatrie systematisch verwendet wird (Schmid et al. 2016). Das ICF-CY dient nicht der Diagnosestellung, sondern der Erarbeitung von teilhabeorientierten Förderzielen.
Ätiologische Abklärung: Robert Voigt (2018) unterscheidet zwischen einer deskriptiven Diagnose, die sich auf die Beschreibung der Entwicklungsmerkmale und des Verhaltens stützt. Eine ätiologische Diagnose gründet auf den Ergebnissen der Untersuchung von neurobiologischen Faktoren. Dazu gehören genetische und epigenetische Faktoren, Stoffwechselstörungen, Infektionen, Schädigungen bei der Geburt oder ein Schädelhirntrauma nach der Geburt. Diese neurobiologischen Faktoren stehen in enger Wechselwirkung mit Umweltfaktoren und sozialen Einflüssen.
Ist die Symptomatik sehr breit ausgeprägt oder zeigt einen hohen Schweregrad (z. B. eine eher schwere Intelligenzstörung oder eine Autismus-Spektrum-Störung mit starken Einschränkungen der sozialen und sprachlichen Kommunikation), so gelingt eine ätiologische Abklärung sehr viel häufiger. Viele Entwicklungsstörungen und Entwicklungsrückstände sind aber in der Symptomatik leichtgradig ausgeprägt. Bei diesen Kindern gelingt es nur bei einem Teil, eine genaue Ursache zu benennen (Voigt, R. 2018).
Zur Abklärung der Ätiologie gehört neben der Untersuchung verschiedener neurobiologischer Faktoren auch die Bewertung von möglichen psychosozialen Belastungen. Dabei geht es nicht um das Summieren von Risikofaktoren und sozialen Einschränkungen, sondern um die Beschreibung von spezifischen Einflüssen auf den Entwicklungsverlauf eines Kindes. Sheridan / McLaughlin (2016) unterscheiden zwischen mangelnder kognitiver und sozialer Stimulation im Sinne einer Deprivation und der Wirkung von bedrohlichen und traumatisierenden Erfahrungen. Sie gehen davon aus, dass sich die Effekte der Deprivation und der Erfahrung von bedrohlichen Situationen auf typische entwicklungsneurologische Prozesse unterscheiden. Auswirkungen der Deprivation sind demnach eher auf übergeordnete kognitive Prozesse wie Sprachlernen und exekutive Funktionen zu erwarten, traumatisierende Erfahrungen wirken sich stärker auf Emotionsverarbeitung und soziale Regulation aus (Sheridan / McLaughlin 2016). In der individuellen Situation sind diese Mechanismen oft schwer im Detail aufzuklären, es ist für die Therapieplanung aber hilfreich, spezifische Hypothesen zu frühen Belastungsfaktoren eines Kindes zu formulieren.
1.5Komorbidität
Mit Komorbidität bezeichnet man das gleichzeitige Auftreten verschiedener Störungen bzw. Symptomatiken. Die Untersuchung von Komorbiditäten ermöglicht Rückschlüsse auf die Ätiologie von Störungen und mögliche (kausale) Zusammenhänge. Die Komorbidität von Entwicklungsstörungen beeinflusst den Störungs- und Behandlungsverlauf und die langfristige Prognose.
Man spricht von einer homotypischen Komorbidität, wenn diese zwischen Entwicklungsstörungen innerhalb einer diagnostischen Gruppierung beobachtet werden, z. B. Komorbidität zwischen Sprachentwicklungsstörungen und Sprechstörungen (Artikulation, Redeflussstörungen). Bei einer heterotypischen Komorbidität treten Entwicklungsstörungen innerhalb unterschiedlicher diagnostischer Gruppierungen zusammen auf z. B. Komorbidität zwischen Sprachentwicklungsstörungen und umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (Angold et al. 1999). Man unterscheidet zudem zwischen einer gleichzeitigen und einer sukzessiven Komorbidität. Bei der gleichzeitigen Komorbidität treten verschiedene Formen von Entwicklungsstörungen parallel zueinander auf. Dies bedeutet nicht, dass die Störungen zum gleichen Zeitpunkt begonnen haben oder gleichzeitig aufgehoben werden. Bei der sukzessiven Komorbidität findet sich zwar eine Verknüpfung zwischen verschiedenen Entwicklungsstörungen, diese zeigen aber keine zeitliche Überlappung, sondern treten in der Entwicklung nacheinander auf (Angold et al. 1999). Dies beobachtet man z. B. bei Sprachentwicklungsstörungen und Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen. Das verbindende Element über eine längere Entwicklungsphase könnten in diesem Fall Funktionseinschränkungen im prozeduralen Lernen und in exekutiven Funktionen bilden (Lum et al. 2012).
Gillberg (2010) hält den Begriff Komorbidität für eine Fehlbezeichnung. Er geht davon aus, dass wir uns nicht mit genau abgrenzbaren Störungen befassen. Vielmehr gibt es viele Überschneidungen zwischen den verschiedenen Kategorien von Entwicklungsstörungen. Gleichzeitig finden sich unterschiedliche Theorien für das Entstehen dieser Komorbiditäten, aus denen sich interessante Überlegungen zur Ätiologie der einzelnen Störungen ergeben.
Welche Konsequenzen hat das Thema der Komorbidität für das diagnostische Vorgehen? Entwicklungsstörungen und Verhaltenssyndrome zeigen heterogene Verhaltensmerkmale, für die in der Normalverteilung verschiedene Grenzwerte definiert werden können („Spektrum-Störung“). Viele Syndrome umfassen eine Mischung von Symptomen, die je nach Perspektive und Problemstellung zu unterschiedlichen Klassifikationen führen können. Assoziierte oder komorbide Verhaltensmerkmale entscheiden wesentlich über die soziale Integration und psychische Anpassung.
Das diagnostische Vorgehen soll die Zuordnung zu festen „Schubladen“ kritisch betrachten. Für einzelne Störungen soll in der Diagnostik ein komplexes Entwicklungsbild mit charakteristischen Verhaltensmerkmalen erhoben werden (z. B. exekutive Funktionen bei ADHS, sensorische Verarbeitung bei ASS). Das diagnostische Vorgehen sollte den langfristigen Entwicklungsverlauf und sich verändernde Zuordnungen beachten. Kinder mit komplexen Störungsbildern sollten langfristig durch ein speziell qualifiziertes Team aus Neuropädiatrie und Psychologie und weiteren Fachgruppen interdisziplinär im Verlauf betreut werden (Reiss 2009).
Bei Entwicklungsstörungen findet sich im Verlauf von einigen Jahren oft Unklarheiten in der genauen Zuordnung des Störungsbildes und der Prognose. Diese Unsicherheiten in der Zuordnung sollte man akzeptieren und auch Übergänge zwischen Formen von Entwicklungsstörungen als plausibel ansehen.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das therapeutische Vorgehen? Die vielfältigen Symptommerkmale müssen adäquat abgebildet werden und in einen individuellen Behandlungsplan übersetzt werden. Elterntrainings und Elternschulungen sollten auf das Verständnis der speziellen Entwicklungsprobleme abgestimmt sein. Dabei sollten familiär gehäuft auftretende Entwicklungsstörungen mitberücksichtigt werden. Wesentliche Aufträge der Behandlung sind das Verständnis der spezifischen Entwicklungssymptomatik und ein verhaltens- und entwicklungsorientiertes Vorgehen. Auch für das therapeutische Vorgehen sollte man die Zuordnung zu festen Kategorien kritisch betrachten. Für einzelne Syndrome sollte in der Behandlung auf die komplexe Entwicklungssymptomatik eingegangen werden (z. B. exekutive Funktionen bei ADHS, sensorische Verarbeitung bei ASS). Solche Diagnose übergreifenden Therapiekonzepte sind seit dem Jahr 2010 vielfältig diskutiert worden (z. B. Sauer et al. 2016).
Medizinische Diagnosen sind wichtig für die Präzisierung der spezifischen Entwicklungsprobleme und für die prognostische Einschätzung. Diagnosen sind zudem notwendig für die Begründung von Therapien sowie für die Finanzierung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe. Diagnosen sind demnach ein wichtiger Teil der Entscheidungsfindung, sie bilden aber nur einen Ausschnitt der vielfältigen Einflüsse in der Entwicklung eines Kindes ab. Die klinische Praxis zeigt, dass die aktuellen Diagnosesysteme an Grenzen stoßen, vor allem nicht in der Lage sind, Übergänge zwischen Entwicklungssymptomen gut abzubilden (Bishop 2014).
Von großem Interesse in diesem Zusammenhang sind Symptommerkmale, die bei verschiedenen Formen von Entwicklungsstörungen vorkommen und die in der Praxis die Zuordnung einer Diagnose und die prognostische Einschätzung erschweren. Für einzelne Entwicklungsstörungen finden sich extrem diskrepante Entwicklungsprofile mit einzelnen Funktionsbereichen, die altersentsprechend sind, andere Bereiche, die sehr deutliche Rückstände abbilden. Diese Dissoziation zwischen Funktionen findet sich bei einem Teil der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen und lässt sich auch bei einigen genetischen Syndromen beobachten (Voigt et al. 2006).
Störungen der kognitiven Funktionen können in Teilbereichen bei Sprachentwicklungsstörungen vorkommen, sie sind charakteristisch für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen und Intelligenzstörungen. Umgekehrt finden sich Teilbegabungen oder Sonderbegabungen bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen, im Rahmen von Intelligenzstörungen und speziell bei einzelnen genetischen Syndromen. Diese starken Diskrepanzen werfen im Einzelfall vielfältige Fragen zur Ätiologie und der Bedeutung von Einflüssen der sozialen Umwelt auf.
Das Phänomen der Entwicklungsregression ist ein charakteristisches Merkmal bei einem Teil der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen, bei einzelnen genetischen Syndromen und kommt in Einzelfällen auch bei Sprachentwicklungsstörungen vor (Michelson / Ashwal 2003). Störungen des Aufmerksamkeitsverhaltens, der exekutiven Funktionen und der sensorischen Verarbeitung kennzeichnen verschiedenste Formen von Entwicklungsstörungen. Diese Funktionsschwächen machen es verständlich, warum lange Zeit der Begriff der Wahrnehmungsstörung als Erklärungsmodell und als Grundlage für therapeutische Strategien verwendet wurde. Eine Überschneidung zwischen leichten kognitiven Störungen bzw. Intelligenzrückständen und Symptomen einer Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung werden häufig dokumentiert (Voigt et al. 2006). Sekundäre emotionale Störungen und Störungen der sozialen Anpassung begleiten schließlich verschiedenste Formen von Entwicklungsstörungen (Williams / Lind 2013). Zusammengenommen lassen sich Entwicklungsstörungen nur sehr schwer über eine Liste von charakteristischen Einzelsymptomen definieren, weil sich zu viele Überschneidungen und ähnliche Symptommerkmale (Tab. 2). Konzentriert man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung auf ein charakteristisches Symptom, muss man sich bewusst sein, dass die beschriebenen Entwicklungs-und Verhaltensmerkmale unterschiedliche Formen von Entwicklungsstörungen begleiten können.
Tab. 2: Entwicklungs- und Verhaltensmerkmale bei Entwicklungsstörungen
SES
UEMF
ADHS
ASS
IS
Genetische Syndrome
Stark diskrepantes Entwicklungsprofil
X
Je nach Ätiologie
X(bei einzelnen Syndromen)
Störungen der kognitiven Entwicklung
X(20-30 %)
X
X
X
Besondere Teilbegabungen
X
bei einzelnen Syndromen
Regression in der frühen Entwicklung
Selten
X(20-30 %)
bei einzelnen Syndromen
Störungen der sensorischen Verarbeitung
Selten
Selten
X(10-15 %)
X(20-30 %)
bei einzelnen Syndromen
Aufmerksamkeits-störungen
X (Modalitäts-abhängig)
X
X
X
X
Defizite exekutive Funktionen
X
X
X
X
Langfristige Lernstörungen
X
X
X
X
X
Sekundäre emotionale Störungen
X(15-20 %)
X(10-15 %)
X
X
X
X
Soziale Anpassungs-störungen
X(20-25 %
X(10-15 %)
X(25-30 %)
X
X
X
Abkürzungen: SES (Sprachentwicklungsstörungen), UEMF (umschriebene Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen), ADHS (Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung), ASS (Autismus-Spektrum-Störung), IS (Intelligenzstörung)
1.6Entwicklungsorientiertes Modell
Im Rahmen des Defizitmodells werden Entwicklungsauffälligkeiten oder Entwicklungsstörungen im Vergleich zum Entwicklungsstand oder Funktionsniveau von normal entwickelten Kindern beschrieben (Hodapp et al. 1990). Auch wenn man typische Stärken oder Inselbegabungen herausarbeitet, werden diese im Vergleich zu einer Reihe von Defiziten eines Kindes definiert. Dieses Verständnis liegt oft auch der Darstellung kognitiver Fähigkeiten oder der Bewertung der Intelligenz zugrunde.
Im Rahmen eines systemisch verstandenen Entwicklungsmodells zeigen sich Veränderungen von Fähigkeiten und Entwicklungskompetenzen in allen Entwicklungsphasen und bezogen auf alle Entwicklungsbereiche (Darling-Hammond et al. 2020, 98). Damit wird nicht nur verdeutlicht, dass es enge und stetige Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Entwicklungsbereichen gibt. Emotionale und soziale Erfahrungen können Lernerfahrungen beeinflussen oder blockieren und wirken sich auch auf Aufmerksamkeitsverhalten, Gedächtnis und kognitive Prozesse aus.
Bishop (1997) geht bei Entwicklungsstörungen von einem Muster von assoziierten Störungsbereichen aus. Sie spricht von einem Kaskadeneffekt, der sich aus frühen Defiziten auf den weiteren Entwicklungsverlauf auswirkt. Ähnlich spricht Karmiloff-Smith (1998) davon, dass der Entwicklungsverlauf bei angeborenen Störungen z. B. genetischen Syndromen wichtige Informationen erschließt. Auch bei angeborenen strukturellen Störungen der kognitiven, sozialen und sprachlichen Entwicklung wird man von vielfältigen Wechselwirkungen mit der sozialen Umwelt und individuellen Lernerfahrungen ausgehen. Man kann also eine Entwicklungsstörung nicht nur durch ein Muster von aktuellen Defiziten und Störungsbereichen definieren, sondern muss das Zusammenspiel verschiedener Kompetenzbereiche und externer Einflüsse über die Zeit betrachten.
Im Rahmen eines entwicklungsorientierten Ansatzes liegt der Fokus auf dem Prozess der Entwicklung selbst und weniger auf dem Endergebnis und der abschließenden Diagnose. Paterson et al. (2016) versuchen, dies anhand verschiedener Prinzipien zu verdeutlichen. Sieht man Entwicklungsprozesse als wesentlich an und nicht primär das Endprodukt und die schließlich erreichten Kompetenzen, so sind als erstes Verlaufsbeobachtungen ein wesentlicher Zugang zum Verständnis der Entwicklung und zur Analyse der Einflussfaktoren.
Das führt im zweiten Schritt zu einem dimensionalen Ansatz anstelle eines kategorialen Vorgehens. Zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung ist es wichtig, die Stärken und Schwächen eines Kindes zu analysieren. Dies ermöglicht es zu erkennen, ob sich im Verlauf der Entwicklungsstörung nur quantitative Unterschiede beobachten lassen oder ob bestimmte Entwicklungsfunktionen qualitativ deutlich anderes verlaufen (Paterson et al. 2016, 572-573).
Der Zeitpunkt der Entwicklung bestimmter Fertigkeiten und Kompetenzen kann eine prägende Rolle spielen. So führt ein langsamer Entwicklungsverlauf der Motorik oder Sprache dazu, dass auch die soziale Umwelt unterschiedlich auf ein Kind reagiert und damit auch das Entwicklungstempo mit beeinflussen kann (Iverson 2010).
Zum anderen ist es charakteristisch für die normale Entwicklung, dass verschiedene Entwicklungsbereiche in engem Zusammenspiel aufgebaut werden. Ein Kind baut eine Kompetenz langsamer auf, diese Verzögerung trägt dann auch zu einem verzögerten Verlauf der darauf aufbauenden komplexen Fähigkeiten auf, die wiederum in Wechselwirkung zu Einflüssen der sozialen Umwelt und Verhaltensmerkmalen des Kindes stehen können. Dies nennt man in der epidemiologischen Forschung einen Kaskadeneffekt (Masten / Cicchetti 2010). Zugleich kann ein Kind eine Fähigkeit zunächst langsam aufbauen, wenn es aber schließlich das Fundament für die komplexeren Fähigkeiten erworben hat, kann sich der Aufholprozess deutlich beschleunigen.
Deshalb ist die Beobachtung individueller Entwicklungsverläufe so wichtig, weil durchschnittliche Werte einer Gruppe diese Unterschiede nicht sichtbar machen können. Aus den Verlaufsbeobachtungen können sich Phasen von Stagnation oder Rückschritten in Entwicklungskompetenzen ergeben, die man nur aus der individuellen Beobachtung ableiten kann (Paterson et al. 2016, 576-577). Genauso kann man in solchen individuellen Beobachtungen Phasen eines deutlichen Aufholens im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern erkennen.
In der klinischen Praxis und im Rahmen von Therapiekonzepten wurden in den letzten Jahrzehnten oft Modediagnosen in den Vordergrund gestellt, die gerne auch als Erklärungsmodelle herangezogen wurden. Solche Modebegriffe waren in den 1970er Jahren die minimale cerebrale Dysfunktion, in den 1980er Jahren die Teilleistungsstörungen / Wahrnehmungsstörungen, in den 1990er Jahren die Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen, in den 2000er Jahren die auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, seit einigen Jahren die Autismus-Spektrum-Störungen. Wenn solche Modediagnosen für die Erklärung von Entwicklungsauffälligkeiten und als Grundlage für Therapiekonzepte stark betont werden, wird der Blick auf die individuellen Entwicklungsmerkmale und die spezifischen Entwicklungsthemen eines Kindes verstellt.
1.7Prävalenz von Entwicklungsstörungen
Im Rahmen des National Health Interview Survey (NHIS) in den USA wurden die Eltern von 88.530 Kindern im Alter von 3 bis 17 Jahren befragt, inwieweit bei ihrem Kind eine Entwicklungsstörung diagnostiziert wurde. Für diese Altersgruppe werden für 17% der Kinder und Jugendlichen von den Eltern berichtet, dass bei ihrem Kind eine Entwicklungsstörung zugeordnet wurde (Zablotsky et al. 2019). Es wird über eine Zunahme im Vergleich des Zeitraums von 2009 bis 2011 (16,2%) und von 2015 bis 2017 (17,8%) berichtet. Interessant ist vor allem die Zunahme in den Diagnosen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (von 8,5% auf 9,5%), Autismus-Spektrum-Störungen (1,1% auf 2,2%) und Intelligenzstörung (0,9% auf 1,2%). Es werden verschiedene Risikofaktoren benannt, die zu einer höheren Prävalenz beitragen können (Geschlecht, Geburtsgewicht < 2500g, sozialer Bildungsstatus der Mutter, städtisches Umfeld). Zunahmen werden in der Regel mit einem erhöhten Bewusstsein für einzelne Störungsbilder, Fortschritten im Screening und der Frühdiagnose sowie den Zugangsmöglichkeiten zu medizinischen und therapeutischen Einrichtungen in Zusammenhang gebracht (Zablotsky et al. 2019, Zablotsky et al. 2023, Boyle et al. 2011) (Abb.3).
Abb. 3: Häufigkeit von Entwicklungsauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter (3 bis 17 Jahre)
Die Studien in Deutschland gehen von ähnlichen Prävalenzdaten aus (Pietz et al. 2015). Die KIGGS-Studie bezieht sich primär auf den Anteil von psychischen Auffälligkeiten bei Kindern, so dass aus deren Ergebnissen weniger Rückschlüsse auf die Verteilung von Entwicklungsstörungen möglich sind (Baumgarten et al. 2018).
Im Rahmen der Amerikanischen Pädiatrischen Gesellschaft hat man versucht, für das Kleinkind- und Vorschulalter eine Schätzung vorzunehmen, welche Häufigkeiten man für Entwicklungsstörungen erwarten kann. Dabei unterscheidet man zwischen einer Gruppe von Kindern, die bereits eindeutig eine Entwicklungsstörung aufweisen, und Kindern, bei denen das Risiko für eine Entwicklungsstörung besteht. Diese Abstufung soll dabei helfen abzuwägen, bei welchen Kindern man intensive Fördermaßnahmen einleiten sollte und bei welchen Kindern man vor allem eine engmaschige Begleitung und Beratung der Familien anstrebt (Glascoe 2005, Council on Children with Developmental Disabilities 2006) (Abb. 4).
Nach dieser Beschreibung haben 11% der Kinder ein hohes Risiko für komplexe Störungen der Entwicklung und benötigen eine ausführliche Diagnostik und kontinuierliche Begleitung. 20% zeigen ein mäßiges Risiko für eine Entwicklungsstörung oder Entwicklungsauffälligkeiten und benötigen ein Screening der Entwicklungsfortschritte und erhöhte Aufmerksamkeit. 26% der Kinder haben ein niedriges Risiko für Entwicklungsauffälligkeiten und benötigen vor allem eine Beratung der Eltern zum intuitiven Umgang mit Verhalten und Alltagsaufgaben (z. B. Themen wie Temperament, Schlafen, Selbstständigkeit, Essverhalten). 43% haben ein geringes Risiko für Entwicklungsauffälligkeiten und benötigen nur eine regelmäßige Begleitung durch Vorsorgeuntersuchungen (Glascoe 2005).
Abb. 4: Häufigkeit von Entwicklungsauffälligkeiten im Kleinkind- und Vorschulalter
Wie häufig man Entwicklungsauffälligkeiten diagnostiziert, hängt wesentlich von den verwendeten Screeningverfahren und den ausführlicheren diagnostischen Methoden und den jeweiligen Cut-off-Werten ab. Als Kennwerte wählt man oft Rückstände von ein oder zwei Standardabweichungen in einem Verfahren. Dabei lehrt die klinische Praxis, dass man sich für eine Diagnosestellung nicht auf eine einzelne Methodik verlassen kann.
Im Rahmen des IVAN-Konzepts der Kinderärzteverbände in Deutschland wird als Grundlage für die Entscheidungsfindung im Vorschulalter von einem Wert von 11% diagnostizierter Entwicklungsstörungen plus weiteren 6% mit Risiko für das Entstehen einer Entwicklungsstörung ausgegangen. Dies würde zusammengefasst dem Anteil von Kindern unter einer Standardabweichung entsprechen (Abb. 5). Ziel des Konzepts ist es, eine frühe Diagnosestellung und Förderplanung für die Kinder mit eindeutig diagnostizierten Entwicklungsstörungen sicherzustellen (Schmid et al. 2016). Die Versorgungssituation in diesem Bereich ist vielschichtig, weil einerseits Kinder mit Entwicklungsstörungen spät oder gar nicht vor der Schule im Rahmen von speziellen Therapie- oder Frühfördermaßnahmen betreut werden. Andererseits findet sich ein hoher Anteil von Kindern, bei denen sich die Indikationsstellung mehr auf die sozialen und emotionalen Anpassungsprobleme bezieht als auf eine eindeutig diagnostizierte Entwicklungsstörung. Ziel des IVAN-Konzepts ist es, dazu beizutragen, dass bei Kindern mit komplexen Entwicklungsauffälligkeiten einerseits eine sorgfältige ätiologische Abklärung erfolgt, andererseits eine gut abgestimmte Förderplanung und familiäre Begleitung sichergestellt werden (Schmid et al. 2016).
Abb. 5: Häufigkeit von Entwicklungsauffälligkeiten im Kleinkind- und Vorschulalter (IVAN-Konzept)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – BEISPIEL
Pia ist bei der Erstvorstellung im sozialpädiatrischen Zentrum 3 Jahre und 4 Monate alt. Sie erhält zu diesem Zeitpunkt bereits seit 8 Monaten Frühförderung. Neben einer heilpädagogischen Förderung wurde inzwischen auch eine logopädische Behandlung begonnen. Wegen der langsamen sprachlichen Fortschritte fand bereits zweimal eine pädaudiologische Untersuchung statt mit unauffälligem Befund für das periphere Hörvermögen.
Zum Untersuchungszeitpunkt im Alter von 3;4 Jahren (40 Monaten) verwendet Pia aktiv etwa ein Dutzend einsilbige Wörter. Sie kann ihre Wünsche durch Wörter und unterstützende Zeigegesten oder einzelne natürliche Gesten deutlich machen. Sie begleitet ihr Spiel und Konversation oft mit einer eigenen Phantasiesprache, mit der sie scheinbar eigene Kommentare auszudrücken versucht.
Pia zeige sich fröhlich und kontaktfreudig und verstehe nach Ansicht der Eltern alle Fragen und Aufforderungen, die an sie gerichtet werden. Das Mädchen zeige sich sehr selbstständig bei Aufgaben im Alltag, esse eigenständig, habe die Sauberkeitsentwicklung tagsüber abgeschlossen und helfe den Eltern gerne bei häuslichen Aufgaben. Im Spiel sei Pia eher sprunghaft, liebe es aber, mit ihrer Puppe und dem Puppenwagen verschiedene Alltagsszenen nachzuspielen.
Aus der Anamnese ergeben sich keine Auffälligkeiten, die eine Erklärung der Entwicklungsrückstände ergeben würden. Schwangerschaft und Geburtsverlauf werden als komplikationslos beschrieben. Als Kleinkind zeigte sich das Kind sozial leicht zugänglich. Die Meilensteine der frühen motorischen Entwicklung wurden leicht verzögert durchlaufen, das freie Laufen wurde mit 18 Monaten erreicht.
Bei der entwicklungsdiagnostischen Untersuchung ergeben sich Entwicklungsrückstände zwischen 6 und 10 Monaten für die Bereiche Grob- und Feinmotorik, für das Sprachverständnis und die kognitive Entwicklung. Die Entwicklungsalter werden anhand der Bayley Scales of Infant Development und der Münchener Funktionellen Entwicklungsdiagnostik für das 2. und 3. Lebensjahr in ähnlicher Weise eingestuft. Die expressive Sprache ist am deutlichsten verzögert und entspricht einem Entwicklungsstand um 18 Monate.
Die Vordiagnose aus der Frühförderung und von Seiten des Kinderarztes lautet Sprachentwicklungsrückstand. Die entwicklungsneurologische Untersuchung im sozialpädiatrischen Zentrum ergibt keine Hinweise auf eine mögliche Ursache der Entwicklungsrückstände, zur Sicherheit werden ein Wach- und ein Schlaf-EEG durchgeführt. Die Bewertung von Seiten des sozialpädiatrischen Zentrums betont den globalen Entwicklungsrückstand des Kindes, aus der klinischen Erfahrung wird von den verantwortlichen Mitarbeitern abgeleitet, dass sich die Entwicklungsrückstände im Laufe der nächsten beiden Jahre eher vergrößern dürften. Eine weitergehende genetische Diagnostik zur Klärung der Ätiologie wird angeboten und für die nächsten Monate ins Auge gefasst.
Die Eltern stellen das Kind dann erneut im Alter von 5 Jahren vor. In den Therapieberichten der Frühförderung wird zu diesem Zeitpunkt von einem leichten allgemeinen Entwicklungsrückstand gesprochen. Von Seiten der Logopädin wird eine rezeptive und expressive Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert, während die von den Eltern privat hinzugezogene Ergotherapeutin die Begriffe Wahrnehmungsstörung und Störung der sensorischen Integration auflistet. Wegen der zunehmenden Anpassungsprobleme im Regelkindergarten führt der überweisende Kinderarzt die Diagnose soziale Verhaltensstörung mit oppositionellem Verhalten auf.
Die entwicklungsdiagnostische Untersuchung im Alter von 5;0 Jahren ergibt deutliche Belege dafür, dass sich die Entwicklungsrückstände des Mädchens trotz der intensiven Frühfördermaßnahmen über die letzten 2 Jahre erheblich vergrößert haben. Im Alter von 5 Jahren streuen die erfassten Kompetenzen in der Grob- und Feinmotorik, im Sprachverständnis und der kognitiven Entwicklung in einer Altersspanne zwischen 3 und 3 ½ Jahren. Nach wie vor ist die expressive Sprache am deutlichsten verzögert. Der Wortschatz umfasst inzwischen 40 bis 50 Wörter und erste Zwei- bis Dreiwortkombinationen.
Der untersuchende Psychologe betont einerseits, dass beim jetzigen Entwicklungsstand noch keine aussagekräftige Prognose gestellt werden kann. Gleichzeitig wird im Untersuchungsbericht von einer globalen Entwicklungsstörung gesprochen und der Verdacht auf eine Störung der Intelligenzentwicklung geäußert. Die Eltern lehnen diese Einschätzung vehement ab und wollen das bisherige Förderprogramm wenn möglich nochmal deutlich intensivieren. Sie sind immerhin mit einem Wechsel des Kindes in eine schulvorbereitende Einrichtung einverstanden, die im Rahmen einer heilpädagogischen Gruppe auch intensive Therapiemaßnahmen einschließt.
Bei der Einschulungsuntersuchung im Alter von 6;8 Jahren erfolgt schließlich nochmals eine eingehende Intelligenzdiagnostik, die den früher geäußerten Verdacht auf eine Intelligenzstörung bestätigt. Die zuvor erfolgten neuropädiatrischen Untersuchungen und die genetische Diagnostik haben keine weiteren schlüssigen Hypothesen zur möglichen Ätiologie dieser Entwicklungsstörung ergeben. Die Nachuntersuchungen im Alter von 8 und 10 Jahren belegen eindeutig die Verdachtsdiagnose einer Intelligenzstörung, die auch die langfristige Prognose bis zum Erwachsenenalter bestimmen wird. Die Ursache der Störung konnte nicht geklärt werden. Im Laufe des Vorschulalters wurden bei dem Kind eine Reihe von Diagnosen gestellt, die den Eltern oft die Hoffnung gaben, man könne die speziellen Entwicklungsprobleme vollständig ausgleichen.
Die medizinischen Diagnosesysteme versuchen, eine eindeutige Klassifikation von Entwicklungsstörungen zu erreichen.Übergänge zwischen Entwicklungsstörungen und komorbiden Störungen sind im Laufe des Kindesalters aber sehr häufig.Das Verständnis der Entwicklungsprozesse innerhalb der verschiedenen Formen von Entwicklungsstörungen ist grundlegend für die Prognose und die Behandlungsplanung.
Literaturhinweise:
Jenni, O. (2021): Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen. Springer, Berlin/Heidelberg. Ein aktuelles Standardwerk, das die normale Entwicklung und Entwicklungsauffälligkeiten von Kindern insbesondere auf dem Hintergrund der Züricher Längsschnittstudien darstellt.
Straßburg, H.-M., Dacheneder, W., Kreß, W. (2018): Entwicklungsstörungen bei Kindern. Praxisleitfaden für die interdisziplinäre Betreuung. 6. Auflage, Urban & Fischer in Elsevier, München. Ein Standardwerk zur Übersicht über die Ursachen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten bei Kindern.
2Diagnostische Ebenen in der Frühdiagnostik
Ziel der Früherkennung von Entwicklungsstörungen ist es, frühzeitig Auffälligkeiten der Entwicklung zu erkennen, mögliche Ursachen abzuklären und Fördermaßnahmen einzuleiten. In der Literatur finden sich Angaben zwischen 12 bis 16% für den Anteil der Kinder mit Entwicklungsstörungen im Vorschulalter und beginnenden Schulalter (Boyle et al. 2011, Li et al. 2023