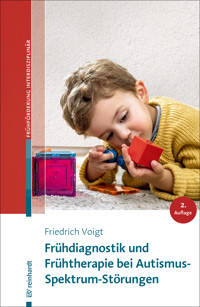
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär
- Sprache: Deutsch
Obwohl den Autismus-Spektrum-Störungen aktuell viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, wird die Diagnose oft spät gestellt. Dieses Buch richtet den Fokus auf eine möglichst frühe Förderung, beginnend mit dem Säuglingsalter bis zum Schulalter. Durch die entwicklungspsychologische Perspektive kann ein passgenauer Förderrahmen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen gestaltet werden. Ausgangspunkt der Frühförderung und Frühtherapie ist dabei ein individueller Zugang zu den Entwicklungsaufgaben und Kompetenzen von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine kompakte und kritische Darstellung von der Früherkennung über Therapieplanung bis zur Elternberatung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär – Band 22
Friedrich Voigt
Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen
2., überarbeitete Auflage
Mit 4 Abbildungen und 24 Tabellen
Mit 7 Checklisten als Online-Material
Ernst Reinhardt Verlag München
Dr. Friedrich Voigt, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, war viele Jahre leitender Psychologe im kbo-Kinderzentrum München.
Hinweis: Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03256-3 (Print)
ISBN 978-3-497-61878-1 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61879-8 (EPUB)
2., überarbeitete Auflage
© 2024 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von iStock.com/Orbon Alija (Agenturfoto. Mit Model gestellt)
Satz: JÖRG KALIES – Satz, Layout, Grafik & Druck, Unterumbach
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de · E-Mail: [email protected]
Inhalt
Einführung
1Diagnose Autismus-Spektrum-Störung
1.1Historische Entwicklung der Diagnose Autismus
1.2Systematik der diagnostischen Klassifikation
1.3Soziale Kommunikationsstörung
1.4Heterogenität und Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen
1.5Differentialdiagnostische Fragen
2Entwicklungspsychologie von Autismus-Spektrum-Störungen
2.1Frühe Entwicklungsmerkmale von Autismus-Spektrum-Störungen
2.1.1Verlaufsstudien bei Autismus-Spektrum-Störungen35
2.2Soziale Entwicklung
2.3Merkmale der frühen sozialen Kommunikation
2.4Sprachentwicklung
2.5Spiel und Spielverhalten
2.6Regression in der frühen Entwicklung
2.7Intelligenzentwicklung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen
3Frühdiagnostik bei Autismus-Spektrum-Störungen
3.1Screening
3.2Autismusspezifische Diagnostik
3.3Psychologische Diagnostik/Entwicklungs- und Intelligenzdiagnostik
3.3.1Intelligenzdiagnostik
3.3.2Psychodiagnostische Untersuchung im Vorschulalter
3.4Diagnostik von Kommunikation und Sprache
3.5Untersuchung von Kleinkindern und nonverbalen Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen
3.6Medizinische Themen zur weiteren Abklärung
4Behandlungsplanung in der Frühtherapie von Autismus-Spektrum-Störungen
4.1Beschreibung von spezifischen Behandlungszielen
4.2Entwicklungsaufgaben
4.3Von den Stärken eines Kindes ausgehen
5Grundprinzipien der Frühförderung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen
5.1Prinzipien der Frühförderung bei Autismus-Spektrum-Störungen
5.2Entwicklungsorientiertes Vorgehen
6Therapiemodelle und Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen
7Überblick über einige komplexe Förderprogramme
7.1Early Start Denver Modell
7.2JASPER-Programm
7.3SCERTS-Programm
7.4DIR Floortime von Greenspan
7.5TEACCH-Programm
7.6Early Social Interaction Model (ESI)
7.7Programme im deutschsprachigen Raum
8Spezielle Themenbereiche
8.1Soziale Kommunikation
8.2Soziale Fertigkeiten
8.3Kognition/Spielfähigkeiten
8.4Sprachentwicklung
8.4.1Kinder mit nur geringer sprachlicher Kommunikation
8.4.2Unterstützende Kommunikation
8.4.3Methoden zur Förderung kommunikativen Verhaltens und des frühen Spracherwerbs
8.4.4Echolalie bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen
8.4.5Semantisch-pragmatische Funktionen
8.5Herausforderndes Verhalten/emotionale Störungen
8.6Stereotypes und restriktives Verhalten
8.7Fütterstörungen/Essstörungen
9Diagnostik und Therapieplanung im sozialpädiatrischen Zentrum
10Elternberatung und Elterntraining
10.1Elternschulung
10.2Beratungsebenen und Coaching der Eltern
11Indikationsstellung und Wirksamkeit von Therapieprogrammen
11.1Wie lässt sich die Vielfalt noch überblicken?
11.2Wirksamkeit von Frühtherapie
11.3Zielsetzung für die Frühtherapie
Anhang: Ausgewählte diagnostische Verfahren
Literatur
Sachregister
Checklisten zur Früherkennung von Autismus-Spektrum-Störungen im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen können LeserInnen dieses Fachbuchs auf der Homepage des Ernst Reinhardt Verlags (www.reinhardt-verlag.de) bei den Informationen zum Buch herunterladen.
Einführung
Seit den 1990er Jahren hat sich das Verständnis von Autismus-Spektrum-Störungen grundlegend verändert. Während man in den 1970er und 1980er Jahren Autismus als eine selten vorkommende Form von Entwicklungsstörung interpretierte, die zudem oft mit einer erheblichen Intelligenzstörung assoziiert sei, geht man heute von einer sehr viel höheren Prävalenz aus und zählt die Symptomatik zu den eher häufig vorkommenden Entwicklungsstörungen mit einer sehr viel variableren Intelligenzentwicklung. Trotz einer exponentiellen Zunahme der Publikationen zum Thema Autismus bleiben viele offene Fragen zur Ätiologie, zum Entwicklungsverlauf, zur Früherkennung und zu den wirksamsten Fördermaßnahmen.
Autismus-Spektrum-Störungen sind gekennzeichnet durch eine große Variabilität im Entwicklungsverlauf und im Schweregrad der Symptomatik. Diese Heterogenität bildet sich in allen Ausprägungsgraden der Intelligenz und der Sprache ab und umfasst eine Vielfalt von qualitativen Störungen auf der Ebene der sozialen Entwicklung, der Kommunikation und der Verhaltensregulation. Die Variabilität findet sich schon früh im Entwicklungsverlauf und trägt wesentlich zu den Schwierigkeiten bei der Früherkennung von Autismus-Spektrum-Störungen bei. Manche Kinder zeigen auffälliges soziales Verhalten bereits im ersten Lebensjahr, andere durchlaufen die Meilensteine der frühen sozialen Entwicklung im normalen Rhythmus und werden erst im Laufe des zweiten oder dritten Lebensjahres auffällig. Manche Kinder werden erst bis zum Schulalter erkannt.
Die Prävalenzrate von Autismus-Spektrum-Störungen, also die Häufigkeit, mit der die Diagnose gestellt wird, hat seit den 2000er Jahren stetig zugenommen. Dabei sind die Untersuchungsergebnisse über die Jahrzehnte nur schwer vergleichbar, da sich die diagnostischen Kriterien und das Verständnis des Störungsbilds wesentlich gewandelt haben. Einerseits werden bei Kindern mit Intelligenzstörungen und genetischen Syndromen häufiger autistische Symptome beschrieben. Zum anderen werden sehr viel mehr Autismus-Spektrum-Störungen mit leichtgradig ausgeprägten Symptomen und variablen Entwicklungsauffälligkeiten diagnostiziert.
Mit der Zunahme von Veröffentlichungen von Betroffenen, also der Beschreibung von autistischem Erleben und der persönlichen Sichtweisen von Personen mit einer Autismus-Spektrum-Störung, hat sich auch der Zugang zu der Störung nochmals gewandelt. Wie gelingen ein individueller Zugang zu der Entwicklung des einzelnen Kindes und ein adäquates Verständnis der emotionalen Bedürfnisse und der Bedeutung mancher Verhaltenseigenheiten? Schwerpunkt der Darstellung in diesem Buch ist der frühe Entwicklungsbereich vom Säuglingsalter bis zum beginnenden Schulalter. Das entwicklungspsychologische Wissen über Autismus-Spektrum-Störungen bildet dabei die Grundlage für das diagnostische Vorgehen und die Behandlungsplanung.
1 Diagnose Autismus-Spektrum-Störung
1.1 Historische Entwicklung der Diagnose Autismus
Leo Kanner hat mit seinen ersten Fallstudien den Begriff „Autismus“ maßgeblich geprägt. Er hat durch die Beschreibung der zentralen Merkmale von fehlendem sozialem Kontakt sowie zwanghaften und rigiden Verhaltensweisen die wichtigsten Kernsymptome herausgearbeitet. In seinen Beschreibungen wird auch schon auf einzelne herausragende Fähigkeiten oder Spezialinteressen von Kindern hingewiesen. Kanner hat viele Einzelbeobachtungen dokumentiert, die die klinische Beobachtung und die Erklärungsmodelle von autistischen Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen über lange Zeit beeinflusst haben (Kanner 1943).
In der Zeit zwischen 1950 und 1970 wurde der frühkindliche Autismus oft den kindlichen Psychosen zugeordnet, es wurden spezielle Kriterien zur Abgrenzung von kindlicher Schizophrenie erarbeitet und es wurden eine Reihe von Modellen entwickelt, die die Ursache der autistischen Störung in der Eltern-Kind-Beziehung und in speziellen psychischen Belastungen des Kindes gesucht haben (Evans 2013).
Das Diagnostische und Statistische Manual der Amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie, DSM III, definierte 1980 den frühkindlichen Autismus als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung mit drei wesentlichen Definitionsmerkmalen, nämlich einer fehlenden sozialen Reaktion auf andere Personen, einer erheblichen Störung der Kommunikation und bizarren Reaktionen auf verschiedene Aspekte der Umwelt (APA 1980). Die Auffälligkeiten sollten in den ersten 30 Lebensmonaten beobachtet werden.
Mit der Einführung der Revision des DSM III-R (APA 1987) hat man versucht, die Kriterien weiter zu präzisieren. Für die drei Kernbereiche der wechselseitigen sozialen Interaktion, der Kommunikation und der restriktiven Interessen und Aktivitäten wurden konkrete Verhaltensbeschreibungen dokumentiert und es wurde festgelegt, wie viele Symptommerkmale das Kind zeigen muss, damit es einem frühkindlichen Autismus zugeordnet werden kann. Im DSM-IV (APA1994) und im DSM-IV-TR (APA2000) wurden die Kriterien weiter ausgearbeitet. Es wurden verschiedene Formen von Autismus definiert, die besondere Schweregrade und Verlaufsmerkmale der Störung berücksichtigten. Vor allem die Einführung der Klassifikation des Asperger-Syndroms führte zu neuen Fragen hinsichtlich der Abgrenzung zwischen dem sogenannten High-functioning-Autismus und dem Asperger-Syndrom. Die insgesamt fünf Formen von autistischen Störungen, die nun explizit als Formen von autistischen Entwicklungsstörungen unterschieden wurden, fanden ihren Niederschlag auch in der Internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10), die seit 1994 in Verwendung war (WHO 1994).
Das Diagnostische und Statistische Manual DSM-5 (APA2013) fasste schließlich die Kernsymptome unter zwei Indexbereichen zusammen, nämlich den Störungen der wechselseitigen sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion sowie den restriktiven und repetitiven Verhaltensmustern. Es wurde ein übergeordneter Begriff der Autismus-Spektrum-Störung eingeführt und die früher verwendeten Kategorien wurden aufgegeben (Ozonoff 2012).
Komorbide Störungen wurden gesondert definiert, insbesondere Störungen der Intelligenzentwicklung, Störungen der Sprache sowie assoziierte medizinische Erkrankungen. Im Laufe der Weiterentwicklung der Konzepte zum Autismus haben entwicklungspsychologische Themen und neuropsychologische Erklärungsmodelle erheblich an Bedeutung gewonnen. Am interessantesten ist aber die geänderte Sichtweise: Autismus wird nicht mehr primär als psychische Störung, sondern als entwicklungsneurologische Störung betrachtet. Damit hat sich auch das Verständnis möglicher Ursachen und die Bewertung der Prognose verändert. In der englischen Sprache wird der Begriff „neurodevelopmental disorder“ verwendet, der die inhaltliche Verschiebung noch besser abbildet. In der deutschen Übersetzung wird der Begriff „Neuroentwicklungsstörung“ oder „neuronale Entwicklungsstörung“ verwendet, der etwas andere Bedeutungsnuancen impliziert. Im ICD-11 wird die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung ebenfalls der Gruppe der „neurodevelopmental disorders“ zugeordnet (WHO 2021).
BEISPIEL
Carl wurde erstmals im Alter von sechs Monaten zu einer ausführlichen entwicklungsneurologischen Untersuchung vorgestellt. Es zeigten sich in diesem Alter leichte Rückstände der motorischen Entwicklung, die sich bis zum Alter von zwölf Monaten auf vier bis fünf Monate vergrößerten. Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich ein freundliches und im Kontakt leicht zugänglich wirkendes Kind.
Unter den begonnen Frühfördermaßnahmen schien der Junge anfangs Fortschritte zu machen, indem er erste Wörter zu wiederholen begann. Den Eltern fiel aber in einem Alter von 14 bis 18 Monaten auf, dass sich das Kind stärker selbstbezogen verhielt, nur an einzelnen Spielgegenständen Interesse entwickelte und bis zum Alter von 18 bis 20 Monaten auch erste stereotype Aktivitäten zeigte. Speziell das Drehen einzelner Gegenstände und das Hantieren mit Ketten faszinierte ihn. Die erneute entwicklungsdiagnostische Untersuchung mit 18 Monaten zeigte, dass sich die Entwicklungsrückstände auf fast die Hälfte des chronologischen Lebensalters vergrößert hatten. Vor allem reagierte der Junge wenig zuverlässig auf Sprache, zeigte keine Körperteile und hatte an sozialen Spielen kaum Interesse. Mit 18 Monaten begann der Junge frei zu laufen.
Mit der Intensivierung der Therapie auch durch eine stationäre Behandlung schien der Junge mehr Interesse an Spielaktivitäten und sozialem Kontakt zu entwickeln. Die Eltern fühlten sich vor allem ermutigt, als der Junge zwischen 2 ½ und 2 ¾ Jahren anfing, Wörter im Kontext eines Spiels zu wiederholen. Vor allem übten sie häufig das Nachsprechen des Namens und waren begeistert, als der Junge schließlich im Laufe der nächsten Wochen mehrfach im Spielabläufen ausrief „Ich Carl“. Trotz dieser Fortschritte verstärkten sich die stereotypen Beschäftigungen im Spiel. Gegenstände wurden nur exploriert und vor allem zu stereotypen Aktivitäten eingesetzt, aber kaum für ein funktionelles Spiel verwendet.
Die Fortsetzung der Frühfördermaßnahmen und der unterstützenden Klinikbehandlungen schienen Fortschritte vor allem im Alltagsverständnis und Sprachverständnis mit sich zu bringen. Die Eltern beobachteten allerdings, dass die früher gelernten Wörter nicht mehr verwendet wurden, ab 3 ¼ bis 3 ½ Jahren wiederholte der Junge weder einzelne Worte noch setzte er diese aktiv zur Kommunikation ein. Wünsche zeigte Carl durch massives und anhaltendes Schreien oder Ziehen an der Hand an. Meist versuchte er aber, Dinge, die er haben wollte, selbst zu erledigen (z. B. sich etwas aus dem Kühlschrank holen).
Trotz intensiver Bemühungen der Eltern, weitere zum Teil privat finanzierte Therapiemaßnahmen durchzuführen, stagnierte die Entwicklung im Vorschulalter. Bei Schulbeginn mit knapp 6 ¼ Jahren zeigten sich Rückstände der kognitiven Entwicklung von mehr als der Hälfte des chronologischen Lebensalters. Es wurde eine Intelligenzstörung diagnostiziert. Die deutlichsten Fortschritte wurden im Sprachverständnis erreicht, ablesbar an zuverlässigen Reaktionen auf vertraute Aufforderungen im Alltag und sprachliche Anregungen der Eltern. Gleichzeitig fanden sich keine aktive Sprache und auch kein Interesse an anderen Mitteln der Kommunikation.
Carl beschäftigte sich in selbst gewählten Spielaktivitäten nach wie vor oft mit stereotypem Hantieren von Gegenständen, er liebte Bewegungsspiele und wanderte oft ziellos in der Wohnung herum. Mit den Eltern wurde besprochen, dass man in den nächsten Jahren wohl nur langsame Fortschritte der aktiven Sprache erwarten könne. Zugleich wurde nochmals intensiv versucht, mit alternativen Kommunikationsmitteln über Gesten und Bilder zu arbeiten.
Der Entwicklungsverlauf mit 10 Jahren zeigte weiterhin keine Fortschritte in der sprachlichen Entwicklung, sondern eine meist stereotype Beschäftigung mit Gegenständen und wenig Interesse an vorgegebenen Funktionsspielen. Verschiedene Strategien zur Verwendung unterstützter Kommunikation waren nicht erfolgreich. Die Untersuchung des Entwicklungsstands ergab trotz einzelner Stärken im visuellen Bereich ein Entwicklungsprofil mit einer Streuung zwischen 24 und 30 Monaten. Die günstigsten Ansatzpunkte fanden sich im Sprachverständnis und bei der Erfassung von visuellen Details, die deutlichsten Grenzen in der sprachlichen Imitation und in der sozialen Kommunikation.
1.2 Systematik der diagnostischen Klassifikation
Sowohl im Rahmen der Internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10) als auch im DSM-IV-TR wurde eine Triade von Symptomen beschrieben, die als gemeinsame Merkmale von Autismus-Spektrum-Störungen gelten. Diese Triade umfasste qualitative Beeinträchtigungen der wechselseitigen sozialen Interaktion, qualitative Beeinträchtigungen der Kommunikation sowie ein stereotypes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Zur Definition gehörte auch der Beginn der Störung in der frühen Kindheit vor dem 30. Lebensmonat. In der ICD-10 werden verschiedene Störungsbilder von Autismus unterschieden (Volkmar et al. 2014).
Als Kernsymptomatik von Autismus-Spektrum-Störungen wurden die qualitativen Störungen im sozialen und kommunikativen Verhalten gesehen. Da die Abgrenzungen zwischen Störungen der sozialen Interaktion und der sozialen Kommunikation nur graduell möglich sind, hat man sich in der Neuausgabe des DSM-5 (2013, deutsche AusgabeFalkai/Wittchen 2015) entschieden, nur noch zwei Kernbereiche einer Autismus-Spektrum-Störung zu definieren.
Im DSM-5 werden frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus, desintegrative Störung und Asperger-Syndrom unter dem diagnostischen Begriff Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst. Eine differentialdiagnostische Abgrenzung zwischen diesen Krankheitsbildern wird nicht mehr als sinnvoll angesehen (Tab. 1).
Tab. 1: Diagnostische Klassifikation von Autismus-Spektrum-Störungen in der ICD-10, dem DSM-5 und der ICD-11
Klassifikation in der ICD-10
F 84.0 Frühkindlicher Autismus
(1) spezifische schwere und allgemeine Störung, Beziehungen einzugehen und eine wechselseitige soziale Kommunikation aufzubauen
(2) spezifische Störung der sprachlichen/vorsprachlichen Kommunikation
(3) eingeschränkte, sich wiederholende und stereotype Verhaltensmuster und Interessen
F 84.1 Atypischer Autismus
Die diagnostischen Kriterien sind nicht in allen drei Störungsbereichen erfüllt oder das Alter des Krankheitsbeginns fällt aus dem üblichen Rahmen.
F 84.2 Rett-Syndrom
Nach einer Phase von einigen Monaten weitgehend normaler frühkindlicher Entwicklung zeigt sich eine deutliche Entwicklungsregression mit Verlust erworbener Fähigkeiten im Bereich von Handmotorik, Sensomotorik und Sprache.
F 84.3 Sonstige desintegrative Störung des Kindesalters
Nach einer längeren Phase normaler Entwicklung (mindestens zwei Jahre) findet sich ein deutlicher Verlust erworbener sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten.
F 84.5 Asperger-Syndrom
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten betreffen die wechselseitige soziale Interaktion mit auffälligem Sozialverhalten vor allem gegenüber gleichaltrigen Kindern. Es besteht eine normale intellektuelle und sprachliche Begabung.
Klassifikation im DSM-5
Autismus-Spektrum-Störungen
Frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus, desintegrative Störung und Asperger- Syndrom werden unter dem diagnostischen Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ zusammengefasst. Komorbide Störungen sind parallel möglich. Es werden verschiedene Schweregrade von Autismus definiert.
Klassifikation in der ICD-11
Autismus-Spektrum-Störungen als Neuroentwicklungsstörungen (neurodevelopmental disorders)
6A02.0: Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ohne Intelligenzstörung sowie ohne oder nur milde Einschränkung der funktionellen Sprache
6A02.1: ASS mit Intelligenzstörung sowie ohne oder nur milde Einschränkung der funktionellen Sprache
6A02.2: ASS ohne Intelligenzstörung und mit eingeschränkter funktioneller Sprache
6A02.3: ASS mit Intelligenzstörung und eingeschränkter funktioneller Sprache
6A02.4: ASS ohne Intelligenzstörung und mit Abwesenheit funktioneller Sprache
6A02.5: ASS mit Intelligenzstörung und Abwesenheit funktioneller Sprache
Anstelle der klassischen Trias von Symptombereichen (soziale Interaktion, Kommunikation und repetitives/stereotypes Verhalten) werden zwei wesentliche Entwicklungsbereiche definiert: Dazu gehören als erster Bereich die qualitativen Abweichungen in der sozialen Kommunikation – die Kategorien der wechselseitigen sozialen Interaktion und der Kommunikation werden zusammengefasst. Als zweiter Bereich werden die repetitiven Verhaltensweisen und restriktiven Interessen aufgeführt. Diese Kategorie wird ausgeweitet und bezieht auch Aspekte der sensorischen Verarbeitung (z. B. sensorische Hyperreagibiliät) mit ein. Die Störung muss weiterhin in der frühen Entwicklungsphase beginnen (vor dem dritten Lebensjahr). Gesondert beschrieben werden komorbide Störungen, die mit dem Autismus assoziiert sein können (z. B. Intelligenzstörungen, Sprachentwicklungsstörungen) (Falkai/Wittchen 2015) (Tab. 2).
Tab. 2: Definition der Störungsbereiche von Autismus-Spektrum-Störungen im DSM-5 und komorbide Störungen
DSM-5: Autismus-Spektrum-Störungen
Störungen in der sozialen Kommunikation/sozialen Interaktion
sozio-emotionale Reziprozität
Evidenz in jedem Bereich aktuell oder in der Vorgeschichte
nonverbale soziale Kommunikation
reziproke Beziehungen
restriktive, repetitive Verhaltensmuster
repetitive Sprache, Bewegungen oder Verwendung von Objekten
Evidenz für Verhalten in zwei Bereichen aktuell oder in der Vorgeschichte
Fixierung auf Routinen/Rituale
restriktive/intensive Interessen
ungewöhnliche sensorische Interessen/Reaktionen
Symptome in der frühen Kindheit
früher Entwicklungsverlauf/Regression
aktuelle Evidenz/Ausprägung der Störung
Komorbide Störungen/parallel auftretende Entwicklungsstörungen
〿mit/ohne kognitive Störung/Intelligenzstörung
〿mit oder ohne Sprachstörung
〿genetische Befunde / genetisches Syndrom
〿komorbide psychiatrische Störung (z. B. Angst)
〿mit oder ohne Regression
Neben den Störungsbereichen hat das DSM-5 auch Schweregrade für Autismus-Spektrum-Störungen definiert. Dabei werden einerseits die Ausprägung der Eigenheiten in der sozialen Kommunikation beschrieben, die die soziale Integration und das kommunikative Verhalten beeinträchtigen. Zum anderen wird die Intensität von restriktiven und repetitiven Verhaltensmerkmalen differenziert. Die Schweregrade stehen sicherlich in engem, aber nicht in durchgängigem Zusammenhang mit Grenzen der Intelligenzentwicklung und der expressiven sprachlichen Kommunikation. Es finden sich z. B. Kinder und Jugendliche mit High-functioning-Autismus, die ein hohes Maß an sozialer Unterstützung benötigen und durch ihre restriktiven und rigiden Interessen und Eigenheiten im sozialen Alltag stark beeinträchtigt sind. Bei der Einschätzung der Entwicklungsprognose kann die Einstufung des Schweregrads hilfreich sein, bei der längerfristigen Prognose spielen aber auch der Verlauf der Intelligenzentwicklung, der Aufbau der expressiven Sprache, Stärken im Bereich der sozialen Kompetenzen und die positiven Einflüsse der sozialen Umwelt eine wesentliche Rolle (Lord et al. 2018, Falkai/Wittchen 2015).
Dabei sollte man sich bewusst machen, dass es durchaus fachliche Einwände gegen dieses neue Klassifikationssystem gab. So wurde von manchen Autoren der Begriff des frühkindlichen Autismus als einer eher schweren Form einer autistischen Störung mit einem chronischen Verlauf als hilfreich angesehen. Das Gleiche gilt für den Begriff des Asperger-Syndroms, der für leichtere Formen von Autismus-Spektrum-Störungen verwendet wird. Gleichzeitig haben Studien, die eine Abgrenzung zwischen diesen Störungsbildern zu definieren suchten, keine klaren Kriterien gefunden (Bennet et al. 2008). Manche Autoren diskutieren, ob es nicht eine Reihe von autistischen Syndromen gibt und inwieweit die Abgrenzung zwischen den Kernsymptomen und den komorbiden Formen von Entwicklungsstörungen überhaupt gelingt (Constantino/Charman 2016, Gillberg/Fernell 2014).
Im Rahmen der neuen Fassung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11), eingeführt von der World Health Organization ab Januar 2022 (WHO 2021), werden die beiden Kernbereiche einer Autismus-Spektrum-Störung (Störung der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie rigide, restriktive und repetitive Verhaltensmuster) analog zum DSM-5 verwendet. Zudem werden Untergruppen definiert, bei denen sich die Ausprägung der Intelligenzentwicklung und der Sprache unterscheidet (Freitag 2020).
Man spricht dementsprechend von Autismus-Spektrum-Störungen ohne oder mit einer Intelligenzstörung sowie ohne oder mit einer leichten oder sogar einer deutlichen Störung der funktionellen Sprache. Schließlich wird noch als weitere Unterkategorie der Sprache eine vollständig oder weitgehend fehlende funktionelle Sprache in Verbindung mit einer Intelligenzstörung genannt (Tab. 1).
Positiv an dieser Systematik ist, dass der Beobachtung Rechnung getragen wird, dass Intelligenz und Sprache variable Kategorien bilden können, die unterschiedlich miteinander kombiniert sein können. Eine Intelligenzstörung ist dabei eindeutig durch spezifische Intelligenzwerte (IQ-Wert < 70) definiert. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass gerade in den ersten sechs bis sieben Lebensjahren eine standardisierte Intelligenzdiagnostik bei einer größeren Zahl von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen nicht durchführbar ist.
Die Ausprägungen einer funktionellen Sprachstörung sind weniger eindeutig definiert und lassen sich nicht mit einem spezifischen Normwert verknüpfen. Der Verlauf der Sprachentwicklung lässt sich im Vorschulalter zudem oft nicht leicht vorhersagen (Brignell et al. 2018).
Das ICD-11 beschreibt die Veränderung der Entwicklungs- und Verhaltensmerkmale über unterschiedliche Altersspannen hinweg. Zudem werden Fragen der Differentialdiagnostik zu anderen Formen von Entwicklungsstörungen und psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter explizit behandelt (WHO 2021, Freitag 2021). In Deutschland ist der Zeitpunkt der offiziellen Einführung der ICD-11 noch nicht bekannt.
1.3 Soziale Kommunikationsstörung
Das DSM-5 hat als neue zusätzliche diagnostische Kategorie die soziale Kommunikationsstörung eingeführt. Mit dieser Kategorie werden Störungen der pragmatischen Entwicklung, also im sozialen Gebrauch der Sprache, beschrieben. Kindern mit diesen Störungen fällt es schwer, sich mit ihrer Sprache auf die sozialen Erwartungen in Alltagssituationen einzustellen. Es gelingt ihnen etwa nur unvollständig, auf ein wechselseitiges Gespräch einzugehen, weil sie die impliziten Erwartungen und Absichten des Gesprächspartners nicht angemessen verstehen oder berücksichtigen können (Swineford et al. 2014).
Im DSM-5 werden für die soziale Kommunikationsstörung vier Bereiche von typischen Entwicklungsauffälligkeiten beschrieben. An erster Stelle gehören dazu Schwierigkeiten, die Sprache für soziale Zwecke zu nutzen, z. B. bei sozialen Ritualen wie Begrüßungen oder informeller Kontaktaufnahme oder beim Austausch von Informationen. Als zweiter Bereich werden Schwierigkeiten aufgeführt, die Kommunikation an die Erwartungen und Bedürfnisse des Zuhörers anzupassen (z. B. dessen möglichen Vorkenntnisse und Erfahrungen zu berücksichtigen). Als Nächstes werden Kompetenzen in der Anwendung von Gesprächsregeln und beim Erzählen von sprachlichen Inhalten genannt, z. B. zu beachten, dass die Gesprächspartner im Wechsel an die Reihe kommen. Als vierter Bereich kommt schließlich das Verständnis für implizite Informationen und die Präsupposition hinzu, also was im Gespräch durch die Vorerfahrungen der Gesprächspartner vorausgesetzt wird. Zudem rechnet man schließlich das Verständnis für mehrdeutige oder übertragene Bedeutungen hinzu (Swineford et al. 2014, Norbury 2014).
Typisch für Kinder mit sozialen Kommunikationsstörungen sind ein verzögerter Aufbau der sprachlichen Kompetenzen und Schwierigkeiten, auf die soziale Interaktion auf der Ebene der Alltagssprache einzugehen. In Familien, in denen soziale Kommunikationsstörungen bei Erwachsenen oder Kindern auftreten, finden sich bei den anderen Familienmitgliedern häufiger Sprachentwicklungsstörungen oder sprachbezogene Lernstörungen (Swineford et al. 2014). Bei einem Kind mit einer sozialen (pragmatischen) Kommunikationsstörung finden sich als komorbide Störungen häufig kognitive Störungen, Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen und Lernstörungen (Norbury 2014). In Familien mit einem Kind, bei dem eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurde, treten Störungen der sozialen Kommunikation häufiger auf (Tye et al. 2019).
Die Symptome treten im Laufe der Kindheit auf und führen zu Schwierigkeiten in der Alltagskommunikation, in der sozialen Interaktion und im schulischen Lernen. Eine Abgrenzung von Autismus-Spektrum-Störungen erfolgt anhand der qualitativen Auffälligkeiten in der wechselseitigen sozialen Interaktion und Kommunikation und den repetitiven und restriktiven Verhaltensweisen.
Da bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen oft auch eine Störung der semantisch-pragmatischen Entwicklung diagnostiziert wird, also eine breitgefächerte Störung der sozialen Kommunikation und des sozialen Gebrauchs der Sprache, ist die Abgrenzung dieser beiden Störungsbilder im Einzelfall nicht einfach und kann oft erst über Verlaufsbeobachtungen eingeschätzt und über eine entsprechende klinische Expertise gesichert werden (Swineford et al. 2014).
!
Im diagnostischen Klassifikationssystem DSM-5 und in der ICD-11 wird der Begriff Autismus-Spektrum-Störung zur einheitlichen Klassifikation von autistischem Verhalten eingeführt.
Das DSM-5 unterscheidet zudem Schweregrade von Autismus-Spektrum-Störungen, die den Grad an sozialer Unterstützung und die Hindernisse für die soziale Integration beschreiben.
Unter der diagnostischen Kategorie „Soziale Kommunikationsstörung“ wird die Entwicklung von Kindern beschrieben, die primär Schwierigkeiten mit der kommunikativen Verwendung der Sprache haben.
1.4 Heterogenität und Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen
Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen zeigen sehr heterogene Verhaltenssymptome. Der Entwicklungsverlauf ist sehr variabel und es ist oft schwer, das Entwicklungstempo z. B. der Sprache oder der kognitiven Entwicklung vorherzusagen. Dieses heterogene Bild findet sich unabhängig von der Bewertung der Intelligenzentwicklung, der sprachlichen Fähigkeiten und der kommunikativen Kompetenzen. Schließlich finden sich große Unterschiede im Verhalten und in den Anpassungsleistungen von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (Jones/Klin 2009). Wegen dieser Heterogenität bezweifeln manche Autoren, ob man überhaupt von einer einheitlichen Störung „Autismus“ ausgehen kann (Waterhouse 2013).
Im Bereich des sozialen Verhaltens zeigen sich große Unterschiede über alle Entwicklungsphasen hinweg. Einzelne Kinder vermeiden sozialen Kontakt weitgehend, andere wirken im sozialen Verhalten lediglich steif und unbeholfen. Kommunikatives und sprachliches Verhalten zeigen eine große Spannweite: von Kindern, die gar keine gesprochene Sprache erwerben bis zu Kindern, die sich vor allem schwer tun beim Eingehen auf eine Gesprächssituation und auf soziale Erwartungen im Bereich der sprachlichen Kommunikation (Gerenser 2009).
Bei den repetitiven und restriktiven Verhaltensmerkmalen zeigen sich ähnlich große Variationen. Jüngere Kinder zeigen vor allem repetitive motorische Manierismen und eine primäre Beschäftigung mit nicht-funktionalen Teilen von Gegenständen. Bei älteren Kindern kommen eine Fixierung auf restriktive Interessen und nicht-funktionale Routinen oder Rituale hinzu (Leekam et al. 2011). Es finden sich Kinder, bei denen stereotype oder restriktive Verhaltensweisen wenig oder gar nicht beobachtet werden, andere Kinder sind auf ihre stereotypen Interessen so stark fixiert, dass diese das Lernen von anderen Entwicklungskompetenzen erschweren oder behindern.
Im langfristigen Verlauf von Autismus-Spektrum-Störungen erkennt man unterschiedliche Schweregrade der komplexen Entwicklungssymptomatik. Dieser Verlauf kann von der Ausprägung der Kernsymptomatik mitgeprägt sein, von großer Bedeutung sind zudem die langfristige Entwicklung der Intelligenz, des sozialen Anpassungsverhaltens und der Sprache. Bei Kindern und Jugendlichen mit einer minimalen Sprachentwicklung wirken Grenzen der Intelligenz und Sprache oft zusammen, die beiden Aspekte können sich aber bei einem Teil der Kinder ganz unterschiedlich gestalten. Tatsächlich zeigt sich in den Studien zur Wirksamkeit der Behandlung eine Tendenz, Kinder mit einem schweren Verlauf der Autismus-Symptomatik deutlich weniger zu berücksichtigen (Stedmann et al. 2019).
In der frühen Entwicklung gibt es zwar Indikatoren für den Schweregrad und die langfristige Prognose (Lord et al. 2022), im Einzelfall ist eine genaue Vorhersage der Intelligenzentwicklung oder der Sprachentwicklung für die nächsten fünf Jahre aber meist schwierig.
Miles unterscheidet zwischen einem essentiellen Autismus – in einem anderen Zusammenhang wird auch von idiopathischem Autismus gesprochen – und einem komplexen Autismus. Beim essentiellen Autismus stützt sich die klinische Diagnose nur auf die Beschreibung der unterschiedlichen qualitativen Verhaltensmerkmale. Es finden sich keine dokumentierbaren körperlichen Auffälligkeiten. Beim komplexen Autismus werden Auffälligkeiten in der Morphogenese, z. B. generalisierte Zeichen von Dysmorphien – also von körperlichen Anomalien – oder Mikrozephalie gefunden. Die Häufigkeitsangaben für den komplexen Autismus liegen bei 10 bis 20 % (Miles 2011a).
In anderen Publikationen findet man die Begriffe idiopathischer Autismus und syndromaler Autismus. Bei idiopathischem bzw. nicht-syndromalem Autismus findet man lediglich bei einem kleinen Teil der Kinder Mikrodeletionen oder Reduplikationen auf der DNA, in der Regel sind hier keine genetischen Abweichungen nachweisbar. Bei diesen Autismusformen ist der Anteil von Jungen zu Mädchen stark erhöht (6,5:1 bis 3,5:1) und es wird oft auch eine stärkere familiäre Häufung der Symptomatik berichtet (Abrahams/Geschwind 2008). Aktuell wird ein Anteil des idiopathischen Autismus von etwa 75 % der untersuchten Patienten angenommen. Bei diesen Kindern fehlen konkrete neurologische oder morphologische Merkmale, die auf eine spezifische medizinische Diagnosestellung hindeuten (Bourgeron 2015).
Bei syndromalem Autismus kann man eine bekannte genetische Ursache finden, z. B. Autismus-Spektrum-Störungen bei fragilem X-Syndrom, beim Phelan-McDermid Syndrom oder bei tuberöser Sklerose. Bei syndromalem Autismus findet man einen hohen Anteil von Dysmorphiemerkmalen, anatomisch nachweisbare Gehirnmissbildungen, Intelligenzstörungen und Epilepsie. Bei diesem syndromalen Autismus ist der Anteil von Mädchen und Jungen fast identisch (Miles 2011a).
Bei syndromalem Autismus lassen sich die Chromosomenanomalien oft im Rahmen der genetischen Untersuchungen abklären. Warum bei manchen Kindern innerhalb eines spezifischen Syndroms eine Autismus-Spektrum-Störung auftritt und bei anderen nicht (z. B. im Rahmen des fragilen X-Syndroms), ist nicht im Einzelnen geklärt. Syndromale Formen von Autismus werden nicht als Autismus-Spektrum-Störungen bewertet, sofern eine genetische Ursache nachgewiesen wurde. Vielmehr geht man von speziellen klinischen Syndromen aus, für die sich der Entwicklungsverlauf und die Prognose vom idiopathischen Autismus unterscheidet (Miles 2011b).
Bei Kindern und Jugendlichen mit fragilem X-Syndrom, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wird, zeigen sich oft weniger stark ausgeprägte Symptome im Bereich der sozialen und kommunikativen Symptome als bei Patienten mit einer nicht-syndromalen Autismus-Spektrum-Störung. Kinder und Jugendliche mit fragilem X-Syndrom mit Merkmalen einer zusätzlichen Autismus-Spektrum-Störung zeigen dagegen eine Reihe von komorbiden Problemen, die sie von Kindern mit nicht-syndromalen Autismus-Spektrum-Störungen unterscheiden. Vor allem Probleme mit Ängsten und Hyperaktivität sind bei Kindern mit fragilem X-Syndrom deutlich stärker ausgeprägt (Abbeduto et al. 2014).
Solche Syndrom-typischen Verhaltensmerkmale zu verstehen, ist für die Behandlung eines Kindes überaus wichtig. Bei Kindern mit dem Williams-Syndrom ist etwa häufig eine geringe Modulation des Blickkontakts und das typische Anstarren anderer Personen zu beobachten. Zudem fällt oft ein ausgeprägtes distanzloses Verhalten gegenüber Kindern und Erwachsenen auf. Jedes Kind in der Vorschulgruppe wird sozusagen zum engen Freund erklärt und auch so behandelt. Es wurden in Studien Einschränkungen in der Gesichtswahrnehmung nachgewiesen, die ein möglicher Auslöser für das Anstarren sein könnten. Die Funktionsstörungen im sozial-kommunikativen Verhalten sind aber sehr viel weniger ausgeprägt als bei Kindern mit idiopathischem Autismus. Stereotype und restriktive Verhaltensweisen bilden sich vor allem in dem wenig flexiblen Spielverhalten ab (Klein-Tasman et al. 2009).
Unter den Kindern mit Neurofibromatose Typ 1 (NF1) wird in der Literatur ein erheblicher Anteil an zusätzlich diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störungen beschrieben (die Angaben schwanken zwischen 10 % und 30 %). Typisch für diese Kinder sind ebenfalls das distanzlose Verhalten, ein flüchtiger und abschweifender Blickkontakt geprägt von Eigenheiten des Aufmerksamkeitsverhaltens und ein oft sehr diffuses Kontaktverhalten. Auf der Ebene des restriktiven und rigiden Verhaltens zeigen sich einzelne zwanghafte Muster, seltener auch ausgeprägte Stereotypien (Garg et al. 2015).
Die Unterscheidung zwischen idiopathischem und syndromalem Autismus ist von großer Bedeutung für die ätiologische Abklärung, für die Einschätzung der Entwicklungsprognose und auch für die Behandlungsplanung. Insofern ist es wichtig, sich über die zugrundeliegende Ätiologie genauer Gedanken zu machen, ehe man systematische Therapiemaßnahmen einleitet.
Bei syndromalen Formen von Autismus-Spektrum-Störungen im Kontext von einzelnen genetischen Syndromen finden sich Syndrom-typische Entwicklungsmerkmale und bei einem Teil der Kinder eine Abmilderung der Autismus-spezifischen Symptome, z. B. bei einer relativen Stabilisierung der kognitiven und sprachlichen Entwicklung. Bei Autismus-Spektrum-Störungen im Kontext von körperlichen Vorerkrankungen, z. B. Zustand nach extremer Frühgeburtlichkeit oder Epilepsie, kann sich ebenfalls eine deutliche Veränderung der Autismus-spezifischen Merkmale im Schulalter zeigen. Diese Veränderungen sind im Laufe des Vorschulalters aber oft noch nicht abzuschätzen.
Das Bild wird nochmals komplizierter durch vorübergehende autistische Verhaltensmerkmale bei Entwicklungsstörungen mit anderen Leitsymptomen im langfristigen Verlauf. So kann sich bei einer Intelligenzstörung zunächst eine Autismus-Symptomatik in der frühen Entwicklung andeuten, die im langfristigen Verlauf aber keine wesentliche Rolle mehr spielt. Schließlich spielt die Komorbidität von Autismus-Spektrum-Störungen mit anderen Formen von Entwicklungsstörungen, z. B. Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen, bei der längerfristigen Prognose eine Rolle. Diese Verknüpfung wirft aber wiederum eine Reihe von differentialdiagnostischen Fragen auf, nämlich welche Leitsymptomatik langfristig im Vordergrund steht.
Autismus-Spektrum-Störungen werden als neurobiologische Störungen verstanden, die primär durch heterogene genetische Faktoren beeinflusst werden. Zugleich wird eine multifaktorielle Ätiologie angenommen, bei der die spezifische Wirkung von Umweltfaktoren noch wenig verstanden wird. Die Ursachenanalyse hat einen engen Zusammenhang mit genetischen Variationen belegt. Dabei geht man davon aus, dass aktuell bei 20 bis 25 % der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen eine konkrete genetische Veränderung als Ursache nachweisbar ist. Diese betreffen z. B. chromosomale Deletionen, Reduplikationen oder Veränderungen der Kopienzahl (copy number variations) (Bourgeron 2015).
Gleichzeitig sind eine Reihe von Umweltrisiken bekannt, die mit Autismus-Spektrum-Störungen assoziiert sind. Diese betreffen z. B. Risiken während der Schwangerschaft (etwa Alkoholexposition oder mütterliche Infektionen), extreme Frühgeburtlichkeit und perinatale Risikofaktoren. Ein weiterer Risikofaktor für autistische Störungen ist z. B. ein höheres Alter von Mutter und Vater, es ist aber nicht zuverlässig bekannt, wie diese Altersfaktoren wirksam werden (Bölte et al. 2019). Diskutiert werden bei Autismus zudem epigenetische Faktoren. Epigenetische Prozesse sind Wirkungsmechanismen, die dazu führen, dass Umwelteinflüsse lebenslange oder vererbbare Wirkungen auf die genetische Kodierung, also die Aktivierung oder Nichtaktivierung eines Gens haben (Waterhouse 2013).
!
Autismus-Spektrum-Störungen zeigen ein sehr heterogenes Bild im Verlauf der Entwicklung und in der langfristigen Prognose.
Die Betonung der neurobiologischen Störungen lenkt den Blick auf die vielfältigen Einflüsse von genetischen und epigenetischen Faktoren.
1.5 Differentialdiagnostische Fragen
Obwohl man für die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung stringente Kriterien formuliert hat, ist die Abgrenzung zu anderen Entwicklungsstörungen keineswegs eine leichte Aufgabe. Dies gilt besonders für die ersten Lebensjahre. Einzelne Verhaltensmerkmale finden sich sowohl bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen als auch bei Kindern mit anderen Formen von Entwicklungsauffälligkeiten. Zwanghafte und rigide Verhaltensmerkmale können nicht nur bei Autismus, sondern in einzelnen Entwicklungsphasen auch bei Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen beobachtet werden. Defizite im sozialen Kontaktverhalten können auch durch eine ausgeprägte Sprachentwicklungsstörung begründet sein. Erhebliche Störungen der emotionalen Regulation können eine Autismus-Spektrum-Störung begleiten, aber auch Zeichen einer frühkindlichen Regulationsstörung oder emotionalen Störung bei belasteter Bindungssituation sein (Matson et al. 2007). Zur Verdeutlichung zeigt Tabelle 3mögliche Differentialdiagnosen in den ersten sechs Lebensjahren, die mit bestimmten Entwicklungssymptomen assoziiert sein können.
Oft gelingt die differentialdiagnostische Abgrenzung nur durch die Verlaufsbeobachtung über einige Monate hinweg, manchmal erst nach einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Es spricht eher für die Sorgfalt des diagnostischen Prozesses, wenn man sich in einzelnen Fällen unsicher ist, wie die genaue Diagnosezuordnung erfolgen kann und man deshalb im weiteren Verlauf alternative Hypothesen überprüft.
Tab. 3: Differentialdiagnostische Fragen bei Autismus-Spektrum-Störungen im Kleinkind- und Vorschulalter
Entwicklungssymptome
andere Erklärungsmöglichkeiten
alternative Diagnose
später Sprechbeginn
Stagnation der Sprachentwicklung
auffälliges Kontaktverhalten in der sprachlichen Kommunikation
Rückstände der Sprachentwicklung vor allem im Sprachverständnis in der ersten 3 Lebensjahren und Phasen stagnierender oder leicht rückgängiger Sprachentwicklung
Bei globalen Entwicklungsrückständen sind in der frühen Entwicklung Auffälligkeiten im sozialen Kontakt beobachtbar.
rezeptive Sprachentwicklungsstörung
globaler Entwicklungsrückstand
Spezialinteressen / eingeschränkte Interessen
Spezialinteressen können Hinweise auf eine intensive Anregung eines Kindes durch das familiäre Umfeld abbilden, manchmal sind sie auch ein Hinweis auf eine hohe sprachliche und/oder intellektuelle Begabung.
Stark eingeschränkte Interessen oder zwanghaftes Verhalten (z. B. das Einhalten einer strengen Ordnung) können Symptommerkmale einer obsessiven-zwanghaften Störung sein und kommen auch bei einzelnen Kindern mit ADHS vor.
Hochbegabung
intensive familiäre Spezialisierung
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung
zwanghaft-obsessives Verhalten
soziales Vermeidungsverhalten
wenig Kontakt zu Gleichaltrigen
Soziales Vermeidungsverhalten kann durch ausgeprägte soziale Ängste bis hin zu elektivem Mutismus begründet sein.
Geringer Kontakt zu Gleichaltrigen kann durch eine relative soziale Isolation der Familie, vor allem begründet aus dem elterlichen Verhalten, entstehen.
soziale Ängste
elektiver Mutismus
extreme Schüchternheit
sensorische Überempfindlichkeit
sensorische Verarbeitungsprobleme
Störungen der sensorischen Integration sind Begleitsymptom einer umschriebenen Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (UEMF) und kommen z. B. als Symptom nach einer extremen Frühgeburtlichkeit (mit hirnorganischen Ursachen) vor.
Hyperakusis und Misophonie können eine sensorische Überreaktion auf der auditiven Ebene, Vermeidungsverhalten, emotionale Reaktionen und Abwehrverhalten auslösen.
Sensorische Verarbeitungsprobleme kommen bei einem Teil der Kinder mit Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen vor.
umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (UEMF)
Hyperakusis/Misophonie
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung
auffälliges Aufmerksamkeitsverhalten, fehlende Reaktion auf soziale Ansprache, impulsives Verhalten
Ständiges Reden, fehlendes Eingehen auf eine Gesprächssituation und geringe Reaktion auf soziale Ansprache können Ausdruck einer Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (ADHS) sein.
Das Vermeiden von Aufgaben, bei denen man sich konzentrieren muss, kann ebenfalls Symptom einer ADHS sein.
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung
exekutive Störung
Fetale Alkoholsyndrom-Spektrumstörung (FASD)
zwanghaftes und obsessives Verhalten
Zwanghaftes Verhalten kann durch ausgeprägte Ängste ausgelöst werden, die z. B. im Verlauf einer Bindungsstörung entstehen können.
Ängste im Zusammenhang mit Bindungsstörungen betreffen eine intensivierte negative Affektivität, eine Hypervigilanz gegenüber Bedrohungen und die Wahrnehmung einer reduzierten Responsivität von Bezugspersonen.
reaktive Bindungsstörung
zwanghaft-obsessives Verhalten
Defizite in der sozialen und sprachlichen Kommunikation, fehlendes Eingehen auf eine Gesprächssituation
Schwierigkeiten, auf die sozialen Erwartungen in der sprachlichen Kommunikation einzugehen können durch eine sozial-pragmatische Störung begründet sein.
Bei einer Schallempfindungs-schwerhörigkeit können solche Symptome durch einen langsamen Aufbau der psychosozialen Entwicklung und des sprachlichen Ausdrucks begründet sein.
sozial-pragmatische Kommunikationsstörung
Schwerhörigkeit
stereotype Bewegungen, z. B. Wedelbewegungen
Hin- und Herwippen
Fixierung auf Reize
isolierte stereotype Bewegungsstörung ohne Auffälligkeiten im sozialen Kontaktverhalten und in der sozialen Kommunikation
stereotype Bewegungsstörungen bei Intelligenzstörungen im Rahmen von genetischen Syndromen
stereotype Bewegungsstörung
genetisches Syndrom
Jaktationen
Echolalie
unmittelbares oder verzögertes Nachsprechen von Äußerungen
Verwenden einer selbsterfundenen Sprache
starke Einschränkungen im Wort- und Satzverständnis und Versuche, die Sprache über das automatische Wiederholen von Äußerungen zu lernen
Kompensation der fehlenden sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten durch eine Privatsprache
perseverierendes Verhalten bei Intelligenzstörungen mit gleichartigen Wiederholungen bestimmter Floskeln, z. B. um Aufmerksamkeit zu gewinnen
rezeptive Sprachentwicklungsstörung
Intelligenzstörung
2 Entwicklungspsychologie von Autismus-Spektrum-Störungen
Über die Entwicklungspsychologie von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen in den ersten beiden Lebensjahren gibt es erst wenige systematische Befunde. Viele Informationen stützen sich auf restrospektive Beobachtungen und Beschreibungen der Eltern. Eltern achten am ehesten auf das Ausbleiben von sprachlichen Entwicklungsfortschritten. Auffälligkeiten im Spielverhalten, im sozialen Kontakt oder in der Fähigkeit zur emotionalen Regulation werden seltener berichtet oder auf andere mögliche Einflüsse in der Entwicklung zurückgeführt (Herlihy et al. 2015). Verschiedene Studien belegen, dass Eltern in den ersten zwei Lebensjahren oft um die Entwicklung besorgt sind, aber es ist unklar, wie spezifisch diese Hinweise sind. Diese Beobachtung gilt auch für die retrospektive Analyse von Videoszenen, die die Eltern in früheren Entwicklungsphasen bei ihrem Kind aufgenommen haben. Es ist unklar, ob die Beobachtungen nicht im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung durch später verfügbares Wissen um die Eigenheiten der Störung beeinflusst werden (z. B. Maestro et al. 2005).
2.1 Frühe Entwicklungsmerkmale von Autismus-Spektrum-Störungen
Für das erste Lebensjahr wurden verschiedene Entwicklungsbereiche bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen systematisch untersucht. Hinsichtlich des Aufmerksamkeitsverhaltens werden einerseits Schwierigkeiten beschrieben, die Aufmerksamkeit von einzelnen Reizaspekten zu lösen, und zum anderen ein reduziertes Interesse an menschlichen Gesichtern im Vergleich zur verstärkten Aufmerksamkeit für Objekte und Reizmuster (Pierce et al. 2011).
Auffälligkeiten im Bereich des sensorischen und motorischen Systems werden auf verschiedenen Ebenen dokumentiert. So wurden auf der sensorischen Ebene entweder eine ausgeprägte Hypersensitivität gegenüber Berührungen oder Geräuschen beobachtet oder aber eine starke Hyposensitivität, also eine sehr geringe Reaktionsbereitschaft auf solche Reize. Dabei stützen sich die retrospektiven Studien oft auf kleine Stichproben. Bei den motorischen Auffälligkeiten werden ein langsameres Durchlaufen der motorischen Meilensteine in der Grob- und Feinmotorik beschrieben (Zwaigenbaum et al. 2015). Zudem werden atypische Bewegungen beobachtet, wie Zitterbewegungen, das Einnehmen bestimmter Körperhaltungen oder ein häufiges Wiederholen alterstypischer Handlungen (z. B. Geräusche mit der Zunge erzeugen) (Landa 2011). In vielen Untersuchungen wird darauf hingewiesen, dass die motorischen Symptome wahrscheinlich nicht spezifisch für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen sind, sondern auch bei anderen Formen von Entwicklungsstörungen beobachtet werden (Zwaigenbaum et al. 2015).
Auf der Ebene des sozialen Verhaltens wird ein Mangel an sozialem Interesse bereits in den ersten Lebensmonaten beschrieben. Das Kind scheint weniger sozialen Kontakt aufzunehmen, geht auf einfache soziale Dialoge über Blickkontakt, Mimik und Gestik wenig ein. Das Interesse an Spielgegenständen und die Exploration der physischen Umgebung wirkt im Vergleich zu Kindern ohne Autismus-Spektrum-Störung wenig ausgeprägt (Maestro et al. 2005). In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres scheinen diese sozialen Auffälligkeiten markanter zu werden. Die soziale Umgebung richtet höhere Erwartungen an das Kind. Am häufigsten werden seltenere Reaktionen auf sprachliche Äußerungen des Erwachsenen dokumentiert, vor allem wenig zuverlässige Reaktionen, wenn das Kind mit seinem Namen angesprochen wird. Das Kind erscheint in dieser Phase weniger an sozialem Kontakt und an anderen Personen interessiert. Es geht auf die typischen sozialen Spiele und Handlungsroutinen (z. B. Guck-guck-Spiel) nicht ein und kann seine Beschäftigung mit der gegenständlichen Welt nicht in den aktiven sozialen Austausch mit den Bezugspersonen integrieren (Landa 2011, Volkmar et al. 2008). Ein sozial gut entwickeltes Kind mit acht Monaten versucht sich über einen Gegenstand, mit dem es hantiert und den es interessant findet, unmittelbar mit dem Erwachsenen auszutauschen. Es kann den Gegenstand herzeigen oder ihn fallen lassen, um die Aufmerksamkeit des Erwachsenen zu bekommen. Diese soziale Initiative kann bei einem Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung komplett fehlen. Wenig Interesse scheint das Kind an sozialen Spielen zu zeigen, es drückt Gefühle gegenüber Erwachsenen oder Geschwistern nur wenig aus und zeigt auch reduzierten Blickkontakt, vor allem zur Regulation der sozialen Kontaktaufnahme (Zwaigenbaum et al. 2013).
Coleman und Gillberg sprechen von mindestens zwei Verlaufsformen der sozialen Entwicklung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen im ersten Lebensjahr (Coleman/Gillberg 1985). Sie beschreiben einerseits ein „Modellkind“, das sich pflegeleicht zeigt, wenig Anforderungen stellt, zum Teil auch passiv und lethargisch wirkt. Zum anderen finden sie extrem irritierbare Kinder, die sich durch Außenreize stark verunsichern lassen, sich kaum beruhigen lassen und anhaltende Schlafstörungen aufweisen. Solche Kleinkinder werden öfters in den Spezialsprechstunden für Schreibabys vorgestellt.





























