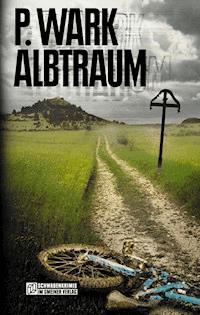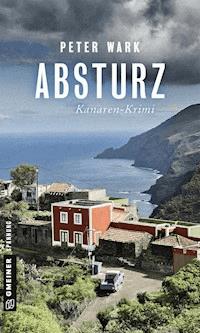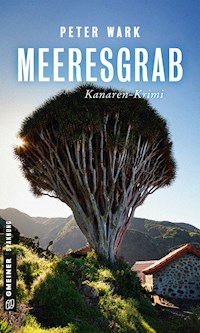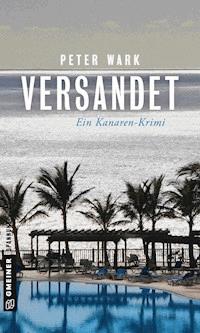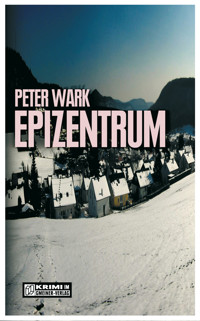
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalist Jörg Malthaner
- Sprache: Deutsch
Junge Geologen der Universität Tübingen machen im Hohenzollerngraben bei Albstadt einen grausigen Fund: Sie entdecken in einem Plastiksack Teile einer verwesten Leiche, die offenbar schon lange dort gelegen hat. Der einheimische Journalist Jörg Malthaner erfährt durch Zufall davon, doch auf seine Nachfragen zeigt sich die Polizei seltsam zugeknöpft und Malthaner beginnt auf eigene Faust zu recherchieren. Da ereignet sich ein weiterer Todesfall und plötzlich interessiert sich auch das Landeskriminalamt in Stuttgart für den Fall …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Wark
Epizentrum
Malthaners vierter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © photocase.de
ISBN 978-3-8392-3228-6
1
Zwei Wochen.
Zwei verdammt lange Wochen war es her, dass ein paar junge Wissenschaftler von der Universität Tübingen die männliche Leiche gefunden hatten – oder das, was noch davon übrig gewesen war, und noch immer war kein Wort an die Öffentlichkeit gedrungen.
Das bedeutete entweder, dass die Polizei völlig im Nebel stocherte und noch nicht einmal über den Hauch einer Ahnung verfügte, wessen Überreste sie da vom Boden aufgeklaubt hatte, oder aber es waren die bekannten ermittlungstaktischen Gründe, die die Kripo-Beamten veranlassten, ihr Wissen für sich zu behalten. Dabei mussten sie in ständiger Sorge sein, dass sich die Nachricht von einem Leichenfund im so genannten Hohenzollerngraben mitten auf der Schwäbischen Alb bald herumsprechen würde. Wenn sich das Gerücht erst einmal von der Universitätsstadt Tübingen bis auf die Alb hinauf verbreitete, dann entwickelte es sich zum Lauffeuer, so viel war dem Freien Journalisten Jörg Malthaner klar. Damit wäre es auch um seinen schönen Informationsvorsprung geschehen.
Außer ihm wusste noch keiner der Medienkollegen von der Geschichte, kein Zeitungsschreiber, kein Fernsehfritze, kein Radiomensch. Schlechte Nachrichten besaßen eine ganz eigene Faszination und gewannen in den meisten Fällen rasend schnell ihre Eigendynamik, wer wusste das besser als ein Journalist. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Medienschaffende davon erfahren würden – dessen war sich Jörg Malthaner vollkommen bewusst. Trotz seines Stillhalteabkommens, das er mit der Polizei getroffen hatte, wollte er die Story auf jeden Fall als Erster bringen. So viel beruflichen Ehrgeiz brachte er allemal noch auf, auch nach vielen Jahren im Nachrichtengeschäft. Er war Journalist – was sonst? – und würde immer einer sein, diese Erkenntnis war schon in jungen Jahren in ihm gereift.
Die Seismologen aus Tübingen, die auf die Leiche gestoßen waren, erzählten die Geschichte von dem grausigen Fund seit zwei Wochen an der Uni und in ihrem jeweiligen Bekanntenkreis herum und schmückten sie möglicherweise mit schaurigen Details aus. Dabei war die Tatsache, im Rahmen eines Forschungsauftrages einen verwesten Mann zu finden, für sich alleine schon schaurig genug. Dass die Leiche in Plastiksäcke verpackt war, stellte dabei noch eine Steigerung dar, wie die Wissenschaftler sie bisher höchstens aus Fernsehkrimis kannten. Die Schlussfolgerung, dass der bemitleidenswerte Mann sich kaum selbst so eingepackt haben dürfte, verlangte nicht allzu viel Hirnschmalz. Von dieser Erkenntnis an war es dann auch kein besonders weiter Weg mehr bis zu der Frage, ob er eines natürlichen Todes gestorben war. Die Umstände sprachen auf den ersten Blick ziemlich deutlich dagegen, obwohl die Polizei Malthaner auf seine Nachfrage natürlich erklärt hatte, dass alles möglich sei.
Egal, wie wenig zart besaitet die Akademiker auch sein mochten, sie würden sich allesamt für den Rest ihrer Tage an ihre Exkursion im Namen der Wissenschaft erinnern, die sie auf den südwestlichen Teil der Schwäbischen Alb geführt hatte. Dem Zollerngraben, diesem unruhigen Herd seismischer Aktivität zwischen den Städtchen Albstadt und Hechingen, hatte wie schon so oft ihre wissenschaftliche Neugierde gegolten. Seit langem bemühten sich Geologen, Seismologen und Archäologen darum, hier mehr über Erdbeben, ihre Entstehung und vor allem über künftige Voraussagemöglichkeiten zu erforschen. Ein Bemühen, das von der einheimischen Bevölkerung überwiegend mit Gleichmut und Desinteresse zur Kenntnis genommen wurde, auch von denen, die das schlimme Beben 1978 selbst erlebt hatten.
Hier oben auf der Alb kümmerte man sich um seine eigenen Angelegenheiten. Die meisten Bewohner dieses kargen Landstrichs hatten sich in ihrem Kokon eingesponnen. Von Interesse waren vielleicht noch Fragen, wie der Nachbar zur Linken sich schon wieder eine Urlaubsreise leisten konnte, oder ob er es mit der Mülltrennung denn auch genau genug nahm. Wenn nicht, hatte man immerhin ein Gesprächsthema mit dem Nachbarn zur Rechten. Weiter gehende echte Neugierde für den Lauf der Welt brachten nicht viele Leute auf.
Als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis galt, dass der Zollerngraben vor 15 Millionen Jahren entstanden war, als sich die Alpen unter dem Druck der afrikanischen Scholle aufgetürmt hatten. Durch die gewaltigen Kräfte veränderte sich damals auch die Juraebene, es entstanden Risse, Spalten und Gräben. Immer wieder bescherten leichtere Erdbeben den Bewohnern dieser Region mulmige Gefühle; zumindest denjenigen, die sich noch an das verheerende Beben vom 3. September 1978 erinnern konnten.
Jörg Malthaner hatte jenes Beben als Junge miterlebt und wusste seither, was das Wort Panik bedeutet.
Wie paralysiert hatte er in seinem Bett im Elternhaus gelegen, nachdem ihn das Unheil verkündende, dumpf grollende Anrollen der Erdbebenwellen geweckt hatte. Unfähig, sich zu bewegen oder irgendetwas zu tun, sogar unfähig, auch nur einen Schreckenschrei hervorzubringen, hatte er dem Kleiderschrank in seinem Kinderzimmer zugeschaut, der so heftig wackelte, als wolle er gleich umstürzen und das Bett mitsamt dem noch nicht einmal ins Jugendalter gekommenen Jörg Malthaner für immer unter sich begraben.
Einzig dem glücklichen Umstand, dass sich das Erdbeben an einem frühen Sonntagmorgen ereignet hatte, war zu verdanken, dass nur wenige Personen verletzt wurden. Tausende von Menschen stürzten in ihren Schlafanzügen auf die Straßen, getrieben von nackter Angst und dem puren Überlebensdrang. Später wurde ein Ausschlag von 5,7 auf der Richterskala gemeldet, das stärkste Erdbeben in Deutschland seit einem halben Jahrhundert. Die Nachbeben hielten noch Monate lang an und verursachten den Menschen in der ganzen Region häufig durchwachte Nächte. Schlimm war für viele Betroffene der materielle Schaden. Mindestens 50 Millionen Mark betrug er alleine in Albstadt und seinen neun Teilgemeinden, hatten die Versicherungen später hochgerechnet. Hunderte von Wohnhäusern waren schwer beschädigt worden, einige mussten später abgerissen werden. Schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war auch die weltberühmte Burg Hohenzollern, an der die spätere aufwändige Behebung der Erdbebenschäden Jahre in Anspruch nahm.
Ein solches Erdbeben an einem Werktag und es wäre zu einer großen Katastrophe gekommen, so viel war jedem Bewohner von Albstadt damals sehr schnell bewusst geworden. Jedes Mal, wenn Malthaner sich an jenen schwarzen Sonntag erinnerte, kamen diese Erinnerungen hoch, begleitet von einem schwer zu definierenden Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins.
Ausgerechnet jener Hohenzollerngraben bescherte ihm jetzt wieder diese diffuse Ahnung bevorstehenden Unheils. Wobei das Unheil ja zumindest schon eine Person ereilt hatte, jene männliche Leiche, über die Malthaner nichts wusste, und über die offensichtlich auch die Behörden nichts wussten.
Er konnte sich gut vorstellen, dass die Polizei auf glühenden Kohlen saß, denn den Kripoleuten war natürlich klar, dass sie die Meldung auf keinen Fall mehr lange unter der Decke halten konnten. Es glich schon einem kleinen Wunder, dass die Sache bislang noch nicht zum Tagesgespräch geworden war.
Eindringlich hatte Theo Reiher, der Pressesprecher der Polizeidirektion, Jörg Malthaner gebeten, diese Nachricht vorerst für sich zu behalten, nachdem dieser ihn angerufen hatte und wissen wollte, was es mit dem Toten auf sich habe. Dass sich die unappetitliche Neuigkeit bis zu Malthaner herumgesprochen hatte, passte Reiher ebenso wenig in den Kram wie den ermittelnden Beamten und der Spitze der Polizeidirektion.
Die Bullen mauerten. Sie bestätigten ihm lediglich, dass es sich um die fortgeschritten verweste Leiche eines Mannes handelte, und dass sie tatsächlich in Plastiksäcke eingewickelt und verschnürt worden war. Das wusste Malthaner bereits selbst. Mehr war nicht herauszubekommen, dabei versuchte er es erst mit Freundlichkeit, dann mit hartnäckigen und unangenehmen Nachfragen, und zuletzt mit der Drohung, eine Riesen-Story daraus zu machen und darin ausführlich die Frage nach der polizeilichen Kompetenz zu stellen eine Leiche zu identifizieren.
Nichts brachte ihn auch nur einen Schritt weiter. Er hatte der Polizei mit seinem Drängen sicher schon heftig Dampf gemacht, denn ein so intensives Nachbohren waren sie von der lokalen Presse und ihren Redaktionsbeamten nicht gewohnt. Der Polizei trat hierfür gewöhnlich niemand auf die Füße, und wenn ein junger und noch unerfahrener Journalist mit einem intensiven Drang zur Wahrheitsfindung es in der Vergangenheit schon einmal versucht hatte, dann genügte bisher immer ein Anruf beim Redaktionsleiter oder beim Verleger, um die Sache unter Verschluss zu halten, wo sie nach Ansicht der Polizeiführung hin gehörte. Unbotmäßige Journalisten, die ihre Arbeit ernster nahmen als die ungeschriebenen Gesetze der Provinz, waren bei den Mächtigen und Meinungsführern im kleinstädtischen Gefüge nicht beliebt und bei anhaltender Widerborstigkeit manchmal plötzlich keine Redakteure mehr. Da hatte es Jörg Malthaner als Vertreter einer landesweit gelesenen und geschätzten Zeitung schon einfacher, er musste keine Rücksichten auf die Befindlichkeiten der regionalen Polizeiführung nehmen, höchstens aus ureigenem Interesse. Sein Chef in Stuttgart ließ sich von ein paar Provinzgrößen auf der fernen Alb nicht ans Bein pinkeln.
Natürlich hatte der Pressesprecher wissen wollen, woher Malthaner seine Information bezog. Natürlich wusste er auch, dass sich der Journalist auf Informantenschutz berief. So lief das Spiel zwischen ihnen schließlich immer, und auch wenn sie beide in ihrer Arbeit Profis waren und in dem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Presse und Behörde versuchten, jeweils Vorteile zu erzielen.
»Malthaner, Malthaner«, hatte Reiher bei jenem Anruf des Journalisten resignierend, aber eine Spur zu empört gesagt. »Lassen Sie doch einmal die Polizei in Ruhe ihre Arbeit machen. Wieso müssen Sie immer den untersten Dreck nach oben kehren?«
»Weil ich nicht will, dass der Dreck unter dem Teppich bleibt und irgendwann zu stinken anfängt.«
»Außer Ihnen wittert keiner auch nur einen leichten Hauch von Geruch«, lautete die Antwort des Sachgebietsleiters Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion.
»Noch weiß hier ja auch niemand davon«, konterte Malthaner. »Wenn das aber passiert, dann wird sich geradezu eine Dunstglocke aus Gestank über die Stadt legen und das ist Ihnen vollkommen bewusst.« Das übliche Geplänkel.
»Wir werden den Fall klären, glauben Sie mir.« Reiher machte nicht unbedingt den Eindruck, als ob er selbst uneingeschränkt glauben würde, was er da wie eine vorgestanzte Wortform von sich gab.
»Und wann gedenkt die Polizei den Fall zu klären? Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, informiert zu werden.« Nun war es an Malthaner, sich etwas zu theatralisch zu geben.
»Lassen Sie mir noch etwas Zeit, ich kann mich leider nicht anders verhalten, als ich das im Moment tue, das verstehen Sie doch.«
Die ritualisierte Form ihres Gesprächs. Eines Gesprächs, das für keinen der beiden Beteiligten ein befriedigendes Ende nehmen konnte. Malthaner versuchte vergeblich, Informationen zu bekommen, und Reiher fühlte sich ganz offensichtlich nicht wohl, weil er gerne mehr preisgegeben hätte, aber möglicherweise auf Weisung von oben nicht durfte.
Malthaners Zusage zur vorübergehenden Verschwiegenheit hatte sich die Polizei mit dem Versprechen erkauft, ihn als ersten Medienvertreter wissen zu lassen, wann man an die Öffentlichkeit gehen werde. Er kannte Theo Reiher seit Jahren und wusste, dass auf sein Wort Verlass war; allerdings zweifelte er daran, dass beim Leitenden Polizeidirektor eine ebenso weit ausgeprägte Bereitschaft bestand, ein Versprechen der Zeitung gegenüber zu halten.
Für Theo Reiher würde der unbekannte Tote voraussichtlich die letzte Leiche sein, mit der er sich in seinem Polizistenleben zu beschäftigen hatte. Denn der Pressesprecher machte zum übernächsten Monatsende Ernst mit seinem seit längerem angekündigten Schritt in den Ruhestand. Reiher hatte gerade die Sechzig erreicht und wollte noch etwas vom Leben haben, wie er Pressevertretern gegenüber immer wieder betonte.
In der Übung, den Journalisten klar zu machen, dass sie in seinen Augen keineswegs nur Vermittler von Informationen, sondern in dem einen oder anderen Fall Parasiten der Gesellschaft waren, hatte Reiher eine gewisse Perfektion erreicht. Dabei war das zu einem guten Teil Fassade, wie Malthaner wusste. So gut kannte er den Polizeisprecher längst. Reiher schätzte sehr wohl die Arbeit der Medien und wusste seriösen Journalismus von unsauberem zu trennen. Nicht selten hatte er in den vergangenen Jahren auch Tipps unter der Hand gegeben. Beide wussten, dass sie sich aufeinander verlassen konnten und was sie aneinander hatten. Daran änderte auch der in offiziellen Angelegenheiten ritualisierte Gesprächsablauf zwischen ihnen nichts.
So gesehen, blickte Malthaner der nahen Zukunft mit einem gewissen Unbehagen entgegen. Noch war nicht bekannt, wer Reihers Nachfolger an der Spitze der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizeidirektion werden sollte. Der Pressesprecher wirkte noch immer jugendlich, war drahtig und durchtrainiert. Er war aktiver Sportler und machte keinen Hehl aus seiner Heimatverbundenheit, wirkte in mehreren Albstädter Vereinen und interessierte sich dem Vernehmen nach ernsthaft für eine Kandidatur bei der nächsten Gemeinderatswahl.
Seine Chancen, sollte er wirklich antreten, standen nicht schlecht, wie Malthaner als Beobachter der kommunalen Szene schätzte.
Dass Jörg Malthaner so schnell von dem Leichenfund erfahren hatte, war einer der nicht erklärbaren Launen des Schicksals zu verdanken. Für seinen Hauptauftraggeber, die Landeszeitung in Stuttgart, wollte der freie Zeitungsjournalist eine Reportage über die erdgeschichtliche Bedeutung der Schwäbischen Alb schreiben. Die Alb – ein riesiger Geopark schwebte ihm als Überschrift über dem Artikel vor.
Hier, auf der Südwestalb, kannte er sich aus, denn hier war er vor 39 Jahren auf die Welt gekommen. Nach langen Jahren in Diensten der Stadtnachrichten und später der Landeszeitung hatte er in der baden-württembergischen Hauptstadt gelebt, bevor er das Wagnis eingegangen war, sich als Freier Journalist niederzulassen. Finanziell war das zu Beginn zwar ein Risiko, aber es hatte sich durchaus gelohnt, denn Malthaner kam zurecht. Er konnte sich nicht mehr vorstellen, wieder in das Laufrad des Redaktionsalltags zurückzukehren, an dem andere drehen und die Geschwindigkeit bestimmen.
Das hatte er zu Beginn seiner Laufbahn erlebt und es reichte ihm für ein ganzes Berufsleben. Nie mehr wollte er in die Situation kommen, einen großen Teil seiner Energie im täglichen Kleinkrieg mit unfähigen und doch immer nörgelnden Vorgesetzten aufzubrauchen, oder im Ärger, den die Korinthenkacker in den Verlagen verströmten, für die Redakteure lediglich einen Kostenfaktor darstellten. Seit die aufrechten Verleger von altem Schrot und Korn in immer mehr Häusern abgedankt und der neuen Managergeneration Platz gemacht hatten, ging es im Pressegewerbe zu wie in jeder anderen x-beliebigen Branche. Diesen armseligen Buchhalterseelen, die man in den Betriebswirtschaftsseminaren züchtete, war es egal, ob sie mit Nachrichten handelten, mit gebrauchten Autos oder mit sonst einer Ware. Sie waren vernarrt in ihre Zahlen, nicht in eine gute Zeitung oder Zeitschrift. Diese Typen konnten Bilanzen lesen, aber keine Zeitung.
Malthaner selbst hatte sich eigentlich nicht beklagen können, als er noch festangestellter Schreibsklave war, denn bei der Landeszeitung gab es durchaus noch Leute, denen publizistische Qualität über kleinkarierte Erbsenzählerei ging.
Zu Beginn seiner Tätigkeit als freier Journalist hatte er in Stuttgart gelebt. Eine Begegnung mit seiner einstigen Jugendliebe Brigitte hatte ihn wieder dauerhaft in seine Heimatregion geführt, von wo aus er die Landeszeitung und eine ganze Reihe von Zeitschriften und Magazinen belieferte.
Bis vor einigen Monaten dachte Jörg Malthaner, dass er sich sein Leben endlich perfekt eingerichtet habe. Doch die immer stärker kriselnde Beziehung mit Brigitte, einer Albstädter Hausärztin, ließ ihn in dieser Betrachtung mehr denn je wanken.
Die Alb – ein Geopark: das brachte die Sache auf den Punkt. Ein geologisches Freilichtmuseum war die Schwäbische Alb, dieses häufig schroff und abweisend wirkende Mittelgebirge, das einem zufälligen Besucher nicht den Gefallen tat, ihm auf den ersten Blick den Eindruck von Idylle zu vermitteln. Nein, die Alb musste man sich schon erarbeiten, gerade hier in ihrem südwestlichen Teil, wo sie sich besonders karg gebärdete, vor allem in den Wintermonaten, die hier länger dauerten als drunten im Neckartal. Nicht jedem Fremden war es vergönnt, dieses charakterstarke Mittelgebirge wirklich lieben zu lernen.
Kraterränder, längst erloschene Vulkane, Erdspalten, Abbruchkanten, Tausende von Höhlen und Quellen; die Alb war ein einziges erdgeschichtliches Museum. Der real existierende Jurassic Park. Die Ausweisung der Schwäbischen Alb als Europäischer Geopark bot dem Journalisten einen aktuellen Hintergrund für seine geplante Zeitungsgeschichte.
Bei den Recherchen war Malthaner schnell auf das Geologische Institut der Uni Tübingen gestoßen. Dort hatte man ihn mit offenen Armen empfangen und schon im ersten Gespräch hatte es nur Minuten gedauert, bis er von dem Leichenfund erfuhr. Ein Seismologe, der von seinem Institut als der offizielle Ansprechpartner bei Pressefragen benannt worden war, gehörte zu der dreiköpfigen Wissenschaftlergruppe, die an jenem Tag vor zwei Wochen im Zollerngraben auf den Plastiksack mit den menschlichen Überresten gestoßen war.
Dass sich ausgerechnet jetzt ein Journalist einer über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus geschätzten Zeitung mit dem Institut in Verbindung setzte, schien dem von der Polizei zum Schweigen verdonnerten Wissenschaftler wie ein Wink des Schicksals. Olaf Ottenbacher, so hieß der Seismologe, der seit längerem mit seiner Doktorarbeit beschäftigt war, stellte jedenfalls einen sprudelnden Informationsquell für Malthaner dar und dachte gar nicht daran, sich an den Maulkorberlass zu halten. Angesichts der absolut und vollkommen außergewöhnlichen Ereignisse war er allerdings vorübergehend mehr an der Leiche interessiert als daran, sein Wissen um die geologischen Besonderheiten der Schwäbischen Alb einem Zeitungsschreiber anzuvertrauen. Malthaner selbst hatte seine Reportage über die erdgeschichtliche Einmaligkeit der Südwestalb erst einmal zurück gestellt, denn auch er war aktuell viel mehr hinter der Geschichte her, die sich zweifellos hinter dem Leichenfund verbarg.
Olaf Ottenbacher war Mitte dreißig. Seine spitz zulaufende, irgendwie aristokratisch wirkende Nase schien ein Fremdkörper in einem rotbackigen, rundlichen Gesicht zu sein, das ebenso wie sein Vorname eher auf eine bodenständige Herkunft schließen ließ. Eine dunkel gerahmte Akademikerbrille machte es sich auf dem schmalen Nasenrücken bequem. Der Haaransatz des Wissenschaftlers wich schon sichtbar zurück, was Ottenbacher dadurch zu kompensieren versuchte, dass er die Haare hinten lang bis auf die Schultern trug. »Spritzlappenfrisuren« hatte man in den längst vergangenen Zeiten der Mantafahrer-Witze dazu gesagt, wie Jörg Malthaner spontan eingefallen war, als er Ottenbacher zum ersten Mal gegenüber stand. Olaf Ottenbachers Frisur hätte dem Bassmann einer Hard-and-Heavy-Band aus den Achtzigern gut zu Gesicht gestanden.
Bei beiden Begegnungen, die Jörg Malthaner mittlerweile mit Ottenbacher hatte, trug der einen penibel gestutzten Drei-Tage-Bart. Alles in allem machte der angehende Doktor einen patenten Eindruck, er schien ein umgänglicher und offener Typ zu sein und hatte Malthaner schon bei ihrem ersten Treffen ohne Umschweife das du angeboten.
Sofort hatte Ottenbacher auf dessen entsprechende Bitte zugesagt, von seinem Wohn- und Arbeitsort Tübingen nach Albstadt zu fahren, um dem Journalisten ganz genau die Stelle zu zeigen, an der er und seine beiden Kollegen den dreckverschmierten Sack mit den Überresten eines Menschen gefunden hatten.
Mühelos konnte Ottenbacher den genauen Fundort benennen, zentimetergenau demonstrierte er, wo sie auf die Leiche gestoßen waren. Selbst wenn er eines fernen Tages alt und grau im Lehnstuhl saß, würde sich Ottenbacher noch an den Tag erinnern, an dem er und seine Kollegen auf die Überreste eines Menschen gestoßen waren. Er konnte seither nicht mehr gut schlafen, hatte er Jörg Malthaner anvertraut. Der konnte das nur zu gut verstehen, hatte er selbst doch auch schon die eine oder andere Leiche zu Gesicht bekommen, die sich später in seine Träume einschlich. »Die Zeit heilt auch diese Wunden«, das war das, was Malthaner dem Forscher an Trost mitgeben konnte. Nicht viel, gewiss. Aber immerhin.
Gemeinsam waren der Seismologe und der Zeitungsreporter in den Graben hinabgeklettert, was an manchen Stellen fast mühelos möglich ist, an anderen nur mit einem großen Risiko. In der Rolle des Bergführers hatte sich Ottenbacher ganz gut gefallen, wie ihn sein Begleiter einschätzte. Das war jetzt fünf Tage her. Malthaner kannte die Stelle, an der Ottenbacher und die anderen beiden Wissenschaftler den Toten gefunden hatten.
Als Kind war er mit seinen Eltern oft auf ihren Sonntagsspaziergängen hier unweit des zum Albstädter Ortsteil Onstmettingen zählenden Albvereins-Wanderheim Nägelehaus vorbei gekommen. Damals hatte er diese Ausflüge immer als überflüssigen Zeitvertreib Erwachsener angesehen. Später, als Jörg Malthaner längst selbst den Reiz ausgedehnter Spaziergänge und Wanderungen erfahren hatte, zog es ihn immer wieder hierher. Seit er wieder fest in Albstadt lebte, kam er oft auf seinen Mountainbiketouren hier vorbei. Keine fünfzehn Gehminuten von dieser Stelle entfernt konnte man einen atemberaubenden Blick auf die bekannteste Touristenattraktion und das meistfotografierte Motiv der Südwestalb genießen, die Burg Hohenzollern auf ihrem kegelförmigen Zeugenberg.
Karg und kahl, fast schon lebensfeindlich, so präsentierte sich die Umgebung des Zollerngraben trotz der außergewöhnlich milden Witterung jetzt im späten März und überhaupt meistens von Oktober bis April.
Die Eigenart der knorrigen Landschaft färbte bisweilen auch auf ihre Bewohner ab, denen nicht gänzlich zu Unrecht Attribute wie mürrisch oder verschlossen angehängt wurden. Man musste sich schon auf sie einlassen und ihre Wesenszüge akzeptieren, sich ihre Zuneigung erarbeiten, dann erlebte man die Älbler als durchaus herzliche Menschen. Aber das konnte dauern, vor allem bei Zugereisten vornehmlich aus nördlichen und östlichen Bundesländern, die noch immer als »Reingeschmeckte« definiert wurden; ein Begriff, der die Skepsis und nicht selten die Ablehnung schon in sich barg.
Das Wetter war deutlich besser als in den meisten Spätwintern, die Malthaner in seiner Heimatregion erlebt hatte. Nur wegen der relativen Milde hatte es für die Wissenschaftler überhaupt Sinn gemacht, vor Ort zu arbeiten. Dennoch war es immer möglich, dass noch einmal ein Wintereinbruch kam. Es war sogar sehr wahrscheinlich und das alles konnte innerhalb von einem oder zwei Tagen geschehen, egal wie freundlich sich das Wetter davor gebärdete. »Außer Juli und August gibt es keinen Monat, in dem es in Albstadt nicht irgendwann schon einmal geschneit hat.« Diese Weisheit hatte ein heimischer Kneipier Malthaner vor Jahren bei einer tief-philosophischen nächtlichen Diskussion am Tresen anvertraut. Der Wirt hatte Recht. Malthaner musste oft an diesen Satz denken, vor allem dann, wenn es Anfang Mai wieder einmal zu einem überraschenden, kurzfristigen und von vielen Verwünschungen begleiteten Aufbäumen des Winters kam, während drunten im Neckartal längst der Frühling eingezogen war. Oder, wenn es schon Ende September die ersten Flocken schneite, was keineswegs zwangsweise einen goldenen Oktober ausschließen musste.
Der Hohenzollerngraben war an dieser Stelle in etwa das, was sein Name nahe legte: Ein Graben. Auf der einen Seite des unebenen und weichen Waldbodens ragte wildes Gestein wie eine Wand bis zu drei, vier Metern hoch, während das Gelände dahinter sanft abfiel und in einen Wald mit Laub- und Nadelgehölzen überging.
Ottenbacher kraxelte wie der legitime Nachfolger von Luis Trenker über den geschichteten Fels hinab, schnell, trittsicher, konzentriert. Unten im eigentlichen Graben drängten sich in den von keinem Sonnenstrahl erreichten Ecken letzte Reste von Schnee im Bemühen, dem unausweichlichen Prozess des Schmelzens zu trotzen.
»Hier«, hatte Ottenbacher nur gesagt und mit dem Zeigefinger eine Stelle nahe an der Felswand beschrieben. »Hier hat der Sack gelegen.«
Malthaner spürte nach dem kurzen Abstieg, dass seine Knie leicht zitterten, was ihn als aktiven Mountainbiker enorm ärgerte. Unter der abgewetzten braunen Lederjacke trug er einen zur Jahreszeit passenden Pullover. Schon als Kind hatte er gelernt, dass es besser ist, sich in einem Alb-Winter gut einzupacken. Doch an diesem Tag schwitzte Malthaner. Dass daran nicht nur die passablen Temperaturen schuld waren, wusste er.
»Beschreibe mir noch einmal ganz genau, wie der Sack ausgesehen hat«, forderte der Journalist. Dabei hatte Ottenbacher ihm schon im ersten Gespräch alles haarklein anvertraut, was er wusste. Die Beschreibung des Sacks und auch die des Inhalts gehörten dazu.
»Na ja, eben wie ein handelsüblicher Plastiksack. Nur so stabil und so groß, dass ein Mensch darin verpackt werden kann. Und teilweise zerfetzt.« Schon bei der bloßen Erinnerung schien Olaf Ottenbacher einem Zusammenbruch nahe. Die Farbe war aus seinem sonst rotlichen Gesicht gewichen. Er senkte die Stimme und lenkte seinen Blick in die Spitzen der kahlen Bäume, die sich am oberen Rand des Zollerngrabens in den kargen Boden krallten. Unaufgefordert redete er aber schnell weiter. »Wir dachten erst, dass hier jemand seinen Müll entsorgt hat. Auf so etwas stoßen wir immer wieder. Der Sack lag bestimmt den ganzen Winter hier, so schmutzig, wie er aussah.«
Kein Wunder, dachte Malthaner, vermutlich erreichte von Spätherbst bis zum Frühjahr kein Sonnenstrahl dieses Loch, das zum Grab für einen Mann geworden war.
Ottenbacher sprach leise. »Wir haben natürlich schnell gemerkt, dass da eigentlich kein Haushaltsmüll drin sein kann. Es sah aus, … na ja, …« – er suchte die treffenden Worte –
»… ich kann das auch heute nur schwer beschreiben.«
»Versuch es«, half Jörg Malthaner ihm auf die Sprünge.
»Vielleicht wie ein Tierkadaver. Das war das erste, was ich dachte.« Sein Blick, der den des Anderen suchte, hatte etwas Unstetes. »Ich weiß, das klingt jetzt komisch.«
»Tut es nicht. Glaube mir, ich weiß wie das ist, wenn man die richtigen Worte sucht und nicht findet. Das passiert mir in meinem Job täglich.« Der Versuch, die Situation zu entkrampfen, fruchtete nicht so recht. Zu schwer wog die Tatsache, dass sie über einen wie auch immer zu Tode gekommenen Menschen redeten. Ottenbacher kramte in seinem Sprachschatz vergebens nach den Worten, die beschreiben konnten, was er erlebt hatte. Jörg Malthaner stellte sich selbst zum wiederholten Mal die Frage, wie wohl eine Leiche aussieht, die hier wer-weiß-wie-lange gelegen hatte und möglicherweise einen Winter in halbgefrorenem Zustand hinter sich hatte. Ohne genaue Vorstellung davon, wie schnell der Verwesungsprozess unter diesen klimatischen Umständen einsetzte, stellte er sich vor, dass nicht viel mehr als das Skelett dieses unglückseligen Menschen übrig war. Immer noch genug, um den Betrachtern sekundenschnell die grausige Wahrheit unbarmherzig ins Hirn zu hämmern.
Unbewusst zog Malthaner den Kragen der schweren alten Lederjacke enger. Diese grobe Landschaft, dieses karge und raue Stück Natur, das er sonst so liebte, kam ihm plötzlich vor wie eine Hinrichtungsstätte.
»Carlos war der Mutigste. Er hat sich alles etwas genauer angeschaut.« Carlos war einer von Olafs Kollegen, ein seit Jahren in Tübingen forschender Brasilianer, wie Malthaner schon beim ersten Treffen mit Olaf erfahren hatte.
»Als uns klar wurde, dass wir einen Leichnam vor uns haben, waren wir alle erst einmal wie paralysiert.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
Ottenbacher hatte an Ort und Stelle gekotzt, wie er Malthaner anvertraut hatte, der sich dabei ertappte, mit den Augen verstohlen den Boden nach Spuren von Erbrochenem abzusuchen. Dass er nichts sah, verwunderte ihn nicht weiter. Vermutlich hatte sich ein Wildtier an der Kotze gütlich getan. Für manche Viecher war das ein Leckerbissen. Als Jugendlicher hatte Malthaner nach einer seiner ersten Sauftouren nachts in den Garten des Nachbarn gekotzt und beim Aufwachen am nächsten Morgen neben allen anderen Begleiterscheinungen eines ausgemachten Katers auch mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen. Es wäre unnötig gewesen, denn der Nachbar hatte eine Katze.
Ob wilde Tiere einen Leichnam anfressen? Malthaner wusste es nicht. Ebenso wenig, wie er spontan sagen konnte, was hier außer Füchsen an Tieren lebte. Er wollte das aber unbedingt recherchieren und machte eine gedankliche Notiz, sich bei einem Jäger oder Förster zu erkundigen. Aus seiner Stuttgarter Zeit kannte er einen Gerichtsmediziner, konnte aber nicht sagen, ob der noch immer im Dienst war. Malthaner wusste, wie eine Leiche aussah, wenn sie nur eine oder zwei Wochen in einer Wohnung lag, bevor man sie fand. Egal, wie blitzblank die Wohnung auch geputzt sein mochte, die Maden waren nach ein paar Tagen immer da. Sie sorgten dafür, dass die ermittelnden Polizeibeamten die Hinterbliebenen eindringlich davor warnten, den Toten oder die Tote vor der Beerdigung noch einmal anzusehen. Der Anblick würde sich für immer in ihr Innerstes einbrennen. Selbst hartgesottene Ermittler konnten an diesen Anblicken zerbrechen. Für Maden war jeder Tote im wörtlichsten Wortsinn ein gefundenes Fressen. Da konnte auch der beste Leichenpräparator nichts mehr ausrichten.
»Wie hat der Tote ausgesehen?«, wollte Malthaner zum wiederholten Mal von Olaf Ottenbacher wissen. Auch das hatte Ottenbacher ihm schon bei ihrem ersten Zusammentreffen beantwortet. Vielleicht kam hier vor Ort, mit dem zeitlichen Abstand zu dem schrecklichen Tag, etwas mehr heraus. »Ich will dich nicht quälen«, schob Malthaner leiser nach.
Ottenbacher machte eine lasche Handbewegung. Das passte zu dem kraftlosen Eindruck, den er verströmte, seit sie sich am Ort des grauenhaften Fundes befanden. »Schon gut. Das habe ich dir doch schon gesagt. Als uns klar wurde, dass es sich um einen toten menschlichen Körper handelte, wollten wir gar nicht mehr hinsehen.«
Malthaner bezweifelte das. Schließlich wusste er nur zu gut, dass fast niemand dem Grauen den Rücken zukehrte. Zu stark war die Faszination des Todes und des Leids anderer. Es waren ja immer die anderen, die es traf. Man kannte ihr Schicksal aus dem Fernsehen; die Flüchtlinge auf dem vollkommen überladenen und im Meer gekenterten Schiff, die Kriegstoten im nahen Osten oder die Opfer von bis an die Zähne bewaffneten und durchgeknallten Schülern in einer amerikanischen Highschool. Schlimm, aber da konnte man nichts machen.
Gäbe es nicht die Anziehungskraft des Grauens, dann gäbe es auch nicht die Gaffer auf der Autobahn. Und was war schon ein Unfall gegen ein solches Ereignis, wie Olaf und seine Kollegen es erleben mussten?
Malthaner erinnerte sich an seine Zeit als junger Polizeireporter bei den Stadtnachrichten in Stuttgart, seiner ersten beruflichen Station. Damals hatte er sich auch jedes Unfall- und jedes Mordopfer erst einmal angeschaut, wenn manchmal auch nur für Augenblicke. Aber der Drang, diesen einen Blick auf die wie auch immer häufig in Sekundenfrist vom Leben zu Tode Gekommenen zu werfen, war stärker als die Abscheu und stärker als das Wissen um schlaflose Nächte mit den immer wiederkehrenden Bildern zerfetzter Körper und eingeschlagener Schädel. Die Menschen sind so, und Malthaner machte da keine Ausnahme, auch wenn er nicht gerade stolz darauf war.
»Ich glaube schon, dass ihr genauer hingeschaut habt, und wenn es nur für eine halbe Minute war«, widersprach er Olaf Ottenbacher. Fair war das nicht, denn der wollte ganz offensichtlich nicht an die Details erinnert werden.
»Eine halbe Minute hätte ich das nicht ertragen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich sofort auf den Boden gekotzt habe.«
Malthaner ließ nicht locker. »War der Mann angezogen oder nackt?«
»Das habe ich dir doch auch bereits gesagt. Das Einzige das ich gesehen habe, war ein Stück dunklen Stoffs. Eine Jeans vielleicht. Und die beiden Anderen wollten es auch nicht genauer wissen. Verstehst du das nicht?«
»Doch, verstehe ich. Aber ich weiß auch, dass man in solchen Situationen eben doch genauer hinschaut. Selbst wenn man sich in der gleichen Sekunde dafür schämt und verflucht.«
Jörg Malthaner blickte an der steil aufragenden Felswand bis in den Himmel empor. Vorbei am urzeitlich anmutenden Gestein, entlang der Stämme gewaltiger Buchen, die hier seit Jahrhunderten oder länger standen und aller Aufgeregtheit der modernen Zivilisation trotzten. Kein grünes Blätterdach begrenzte zu dieser Jahreszeit den Blick nach oben. Erstaunt nahm er zur Kenntnis, dass sich einzelne Moosteppiche in den Fels krallten, an denen der Winter offenbar spurlos vorbeigegangen war. In den Sommermonaten, ja, da waren Baumstämme und Felsen über und über bemoost. Im Sommer, wenn Orchideen ihre Schönheit vollkommen unspektakulär auf dem Waldboden entfalteten, in gutnachbarschaftlicher Beziehung zu Küchenschellen und Herbstzeitlosen.
»Stimmt«, sagte Ottenbacher leise. »Ich verfluche mich seit zwei Wochen jeden Tag dafür, dass ich mich zu der Expedition überhaupt jemals bereit erklärt habe.« Malthaner war, als würde in der Ferne ein Käuzchen schreien. Dabei hatte er keinen Schimmer, ob es hier Käuzchen gab, und wenn ja, in welcher Jahreszeit man sie hören konnte. Noch nicht einmal die Frage, ob Käuzchen tagaktiv waren, wusste er sich zu beantworten. Biologie gehörte, wie zu viele andere Fächer auch, nicht zu seinem Spezialgebiet in der Schule. Damals. Vor hundert Jahren, wie es ihm vorkam.
Sein Blick wanderte erneut in die kahlen Baumkronen. Das war nicht das Motiv, mit dem man in einem Hochglanzprospekt für Urlaub auf der Schwäbischen Alb wirbt. Kein Farbtupfer im Einheitsgrau, das sie umgab und sich auf das Gemüt legte wie eine schwere Decke. Dieses Empfinden verunsicherte Jörg Malthaner, der die Landschaft seiner Heimat gerade auch an diesen Tagen schätzte, die für die meisten anderen Menschen einfach nur trostlos waren. Solche Tage vermittelten ihm für gewöhnlich das Gefühl, dass die Uhren in der südwürttembergischen Provinz, weitab vom lärmenden Kessel Stuttgarts, langsamer gingen und ein Gegengewicht zur Hektik der modernen Zeiten setzten.
Das war der Ausgleich zu den Gefühlen, die er an den anderen Tagen hegte. Dann konnte es ihm vorkommen, als hätte man die Alb und ihre Bewohner in der Landeshauptstadt längst vergessen. Zu unproduktiv. Nichts wert für die Regierenden unten am Neckar. Eine Region auf dem Abstellgleis, abgehängt. Ländlicher Raum. Am Tropf der Zuweisungen aus Land, Bund und Europa. Angewiesen auf die Gnade von ignoranten Bürokraten in fernen klimatisierten Bürogebäuden, die nie einen Fuß in diese großartige Landschaft gesetzt hatten. Die auch die Menschen nicht verstehen würden, weil ihnen der Dialekt, der hier gesprochen wurde, abweisend und schroff vorkommen musste, schroff wie die steil aufragenden Kalksteine und Felsen, die dieser Landschaft ihr Bild gaben.
Die Hände tief in die Taschen der wärmenden Jacke geschoben, ließ Jörg Malthaner seine Blicke ein weiteres Mal nach oben schweifen.
Jedes Mal, wenn er in Zukunft mit dem Mountainbike irgendwo in der Nähe vorbei kam, würde er an den Leichenfund denken müssen. Alleine schon deshalb hoffte er, dass die Polizei die Angelegenheit möglichst schnell und vor allem möglichst lückenlos aufklären sollte. Das hatte mit seinem inneren Frieden zu tun.
»Und du bist sicher, dass du nicht irgendwelche Details für dich behältst, die vielleicht eine Bedeutung haben?« Reichlich unsensibel, wie sich der Journalist eingestand. Ottenbacher war drauf und dran, ehrlich sauer zu werden. »Nein, verdammt noch mal. Bei unseren Forschungen auf eine Leiche zu stoßen ist für uns schließlich keine Routine. Ich bin auch deshalb mit dir hier her gefahren, weil ich hoffe, diese schrecklichen Bilder aus dem Kopf zu bekommen.« Ottenbacher holte Luft. »Außerdem hast du mich das alles schon mehrfach gefragt. Alle diese Fragen hat uns die Polizei auch schon gestellt. «
»Die Polizei stellt nicht immer die richtigen Fragen.«
»Sie stellen die gleichen Fragen wie du.«
»Vielleicht ziehe ich aus den Antworten andere Schlüsse.«
Olaf Ottenbacher sah Malthaner zweifelnd an.
Der hielt seinem Blick stand und sprach aus, was seinen Denkapparat beschäftigte: »Warum nur werde ich das Gefühl nicht los, dass wir es hier mit einem Mord zu tun haben?«
2
Mit einer Tasse Kaffee in der Hand stand Jörg Malthaner an diesem Montagmorgen im Wohnzimmer und dachte an diese Begegnung mit Olaf Ottenbacher zurück.
Das Wohnzimmer gehörte zu Brigittes Wohnung, die seit knapp zwei Jahren auch seine Wohnung war. Wie lange noch?
Brigitte war schon vor zwei Stunden aus dem Haus gegangen, um einen langen Arbeitstag in ihrer Praxis zu beginnen. Abwesend blickte er aus dem großen Fenster auf Ebingen hinab, den größten Albstädter Stadtteil. Der Tag war trüb wie die Tage zuvor, aber es war weiterhin deutlich zu warm für einen März auf der Alb.
Die Fensterfront erstreckte sich über die gesamte Länge des Wohnzimmers. Die sündhaft teure Traumwohnung in Halbhöhenlage hatte Brigitte von ihrem Vater geschenkt bekommen, kurz bevor sie dessen Albstädter Hausarztpraxis übernommen hatte. Dr. med. Hans Schick genoss über fast vier Jahrzehnte einen nahezu legendären Ruf als Hausarzt. Brigitte bemühte sich, diesem Ruf gerecht zu werden und die Familientradition würdig weiter zu führen. Sie war eine ausgezeichnete Ärztin. Allerdings stieß sie mit ihrem Faible für Naturheilverfahren nicht nur bei den Krankenkassen, sondern auch bei vielen meist älteren Patienten auf große Vorbehalte. Davon versuchte sie sich so wenig wie möglich irritieren zu lassen.
Die Geschäfte gingen gut, aber auch Brigitte gehörte zu den niedergelassenen Medizinern, die das ewige Herumdoktern der Politiker jeglicher Couleur am Gesundheitswesen mit zunehmendem Argwohn verfolgte. Sämtliche Gesundheitsreformen haben am Ende außer der Pharmaindustrie nur Verlierer hinterlassen, sagte sie oft, und zählte sich, ihre Patienten und die Kassen dazu.
Der Kaffee schmeckte bitter.
Brigitte hatte neulich erstmals deutlich und unmissverständlich ausgesprochen, dass sie sich eine Trennung vorstellen könnte. Das würde bedeuten, dass Malthaner sich sein Leben vollkommen neu einrichten müsste.
Seit zweieinhalb Jahren waren sie jetzt zusammen.
Damals waren sie sich zufällig in ihrer gemeinsamen Heimatstadt über den Weg gelaufen. Er, der Journalist, der seinerzeit in Stuttgart lebte und sie, die kurz zuvor die Praxis ihres Vaters übernommen hatte, nachdem sie ebenfalls viele Jahre auswärts gelebt hatte. Als Jugendliche waren sie einige Zeit »zusammen gegangen«, wie man das damals nannte. Später hatte Brigitte einen Arzt geheiratet, den sie während des Studiums kennen gelernt hatte. Sie nahm die Sache wohl ernster als der Halbgott in Weiß, der hinter jedem Rock her war und seine große Vorliebe für Medizinstudentinnen auch nach der Hochzeit nicht ablegen wollte. Die Ehe hielt nicht lange.
Kurz bevor sie sich nach all den Jahren wieder begegnet waren, ging Malthaners langjährige Beziehung in die Brüche. Er und Brigitte waren damals beide Suchende, die sich fanden. Und jetzt?
Malthaner drehte sich von der Fensterfront weg und stellte die leere Kaffeetasse neben seinen Laptop auf den Couchtisch, den Brigitte in einem exklusiven Möbelgeschäft für obszön viel Geld erworben hatte. Er ging in die Küche, um mit Mineralwasser nachzuspülen.
Vor einem dreiviertel Jahr hatte Malthaner den Mietvertrag für seine Stuttgarter Stadtwohnung endgültig gekündigt, nachdem er seit langem nur sehr sporadisch dort übernachtet hatte. Seine ständige Abwesenheit wirkte sich auf den Zustand der Wohnung nicht gerade positiv aus. Inzwischen fuhr er für gewöhnlich noch einmal die Woche in die Landeshauptstadt, um sich bei den ehemaligen Kollegen in Erinnerung zu halten und an der Redaktionskonferenz teilzunehmen. Schließlich war er auf die regelmäßigen Aufträge der Landeszeitung angewiesen. Obwohl die Arbeit für einige Zeitschriften, Magazine und ein Verbandsorgan durchaus ordentliche Honorare abwarf, konnte er auf das permanente Engagement bei der Zeitung schon aus finanziellen Gründen nicht verzichten.
Meistens arbeitete er für das Landes-Ressort, das noch immer von seinem früheren Chef und väterlichen Freund Hauser geleitet wurde. Hauser war ein in Ehren ergrauter Journalist von altem Schrot und Korn, der in seinem Ressort nach wie vor alles und alle fest im Griff hatte. Wer nur einmal kurz mit ihm zu tun hatte, behielt den massigen Hauser als polternden und aufbrausenden Menschen im Gedächtnis. Dabei war er sensibel, warmherzig und der zeitgenössischen Kunst zugetan, wie alle wussten, die die Freude hatten, mit ihm über längere Zeit zusammenarbeiten zu dürfen.
Hauser hatte mittlerweile seinen 60. Geburtstag gefeiert, aber an Ruhestand wollte er nicht denken. Viel lieber schockierte er die jüngeren, noch auf Karriere bedachten Kollegen regelmäßig mit der Ankündigung, dass er in den Stiefeln sterben werde, was wohl heißen sollte, dass er seinen Schreibtisch niemals freiwillig zu räumen gedachte.
Das Mineralwasser schmeckte Malthaner so wenig wie der Kaffee zuvor. Überhaupt schmeckte ihm zurzeit in seinem Leben nicht viel. Das galt nicht nur im übertragenen Sinne. Denn er litt unter Appetitlosigkeit; ein Zustand, mit dem er noch nie über einen längeren Zeitraum konfrontiert war. Er hasste es, wenn Beziehungen zu Ende gingen. Am Schluss blieben immer zu viele Scherben, die jemand zusammenkehren musste und zudem schmerzhafte Narben auf der Seele. Mit fast 40 Lebensjahren noch einmal von vorne anzufangen, konnte er sich schwer vorstellen. Und doch schienen alle Weichen längst in diese Richtung gestellt zu sein. Sie beide wussten es oder ahnten es zumindest, schoben eine Entscheidung aber immer weiter hinaus.
Brigitte wusste nichts davon, dass er vor einigen Wochen lockeren Kontakt mit Andi Maurer aufgenommen hatte, einem alten Freund, der seit langem in der Immobilienbranche arbeitete.