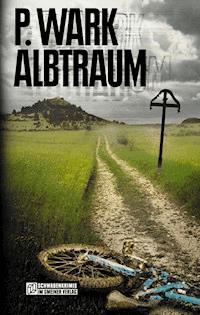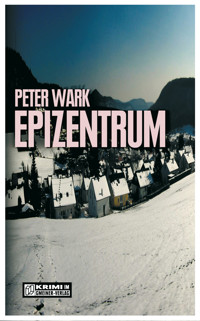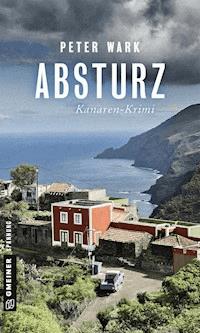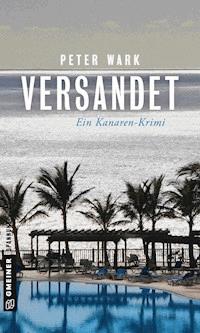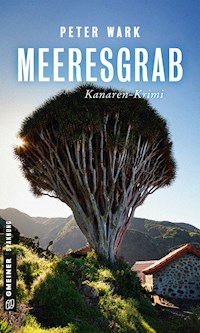
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Aussteiger Martin Ebel
- Sprache: Deutsch
Kann man einem Schulfreund trauen, zu dem man über 20 Jahre lang keinen Kontakt mehr hatte? Diese Frage hätte sich Aussteiger Martin Ebel stellen sollen, bevor sich der ungebetene Gast aus Deutschland in seiner Wohnung auf La Palma breit gemacht hat. Als er die wahren Gründe für den Besuch aus der Heimat zu erahnen beginnt, haben die Ereignisse bereits eine mörderische Dynamik entwickelt - und Ebel wird immer tiefer in den Strudel aus Lügen, kriminellen Verstrickungen und Gewalt hineingezogen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Wark
Meeresgrab
Kanaren-Krimi
Zum Buch
Gast mit GeheimnisWie konnte er nur so dumm sein? Wieso hat er nicht entschieden widersprochen, als sich sein alter Schulfreund Justus selbst nach La Palma eingeladen hat? Als wäre es für den ohnehin schon labilen Martin Ebel nicht schon schlimm genug, den nervtötenden Gast zu ertragen, nehmen plötzlich auch noch merkwürdige Ereignisse ihren Lauf. Während Ebel sich weigert, den Vorkommnissen irgendeine Bedeutung beizumessen, wird Justus von Tag zu Tag nervöser. Was hat er zu verbergen? Und was ist der eigentliche Grund seines Besuchs? Als Ebel schließlich Nachforschungen anstellt, deckt er ein Geflecht aus Lügen, Macht und Gewalt auf und gerät dabei selbst in akute Gefahr. Da treten sogar ein drohender Prozess gegen ihn, die drängende Frage nach der eigenen beruflichen Zukunft und die Trauer um seine endgültig verlorene Liebe Carmen in den Hintergrund!
Peter Wark war viele Jahre als Redakteur bei verschiedenen Zeitungen tätig und arbeitet inzwischen in der Unternehmenskommunikation. Seiner südwürttembergischen Heimat ist er immer verbunden geblieben – seit einiger Zeit lebt er auch wieder dort. Peter Wark hat bereits mehrere Kriminalromane und zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht. Seine Bücher spielen auf der Schwäbischen Alb, den Kanaren, in München, aber auch in Australien. Die La Palma-Krimis sind von seiner Liebe zu der Insel und seiner Leidenschaft für das Mountainbiken inspiriert.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Absturz (2018)
Versandet (2018)
Albtraum (2012)
Epizentrum (2006)
Ballonglühen (2003)
Machenschaften (2002)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Teresa Storkenmaier
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © thomasfuer / photocase.de
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6192-7
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind in den meisten Fällen rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ausnahmen sind mit den betreffenden Personen abgesprochen.
1
Ich bin ein kompletter Idiot.
Leider vergesse ich das manchmal.
Doch irgendwann holt mich die Realität wieder ein, meistens eher früher als später. So wie dieses Mal. Hätte ich einfach auf einem klaren Nein bestanden, wäre diese Sache nie ins Rollen gekommen. Aber ich Trottel hatte mich breitschlagen lassen, weil ich meine Ruhe wollte. Meine Ruhe vor dem Wortschwall von Justus Häussler.
Von Anfang an war es keine gute Idee gewesen. Das hätte ich wissen können.
Ich hatte es auch gewusst. Eigentlich.
Trotzdem war ich hingegangen, zu diesem eigenartigen Jahrgangstreffen.
Hätte ich nur meiner inneren Stimme mehr Gehör geschenkt, wäre mir die ganze unerfreuliche Geschichte erspart geblieben. Es wäre mir erspart geblieben, in einem Flugzeug in zehntausend Meter Höhe neben Justus Häussler zu sitzen. In einem Touristenbomber waren wir von Stuttgart nach Santa Cruz de La Palma unterwegs, der Hauptstadt der Kanareninsel La Palma, auf der ich seit Jahren lebe.
Ein vierstündiger Flug mit einer Passagiermaschine voller sonnenhungriger deutscher Touristen ist an sich schon eine unschöne Angelegenheit. Mit einem aufgedrehten Justus Häussler neben sich konnte man geradezu depressiv werden, und ich besaß ein Faible für regelmäßig wiederkehrende Depressionen. Es gab Tage, da badete ich in Depressionen.
Was hatte ich mich auch darauf eingelassen? Obwohl mein Kopf und mein Bauch Nein gesagt hatten, und zwar deutlich und laut, hatte mein Mund zu meiner eigenen Überraschung Ja gesagt. Wäre ich nur bei meinem Nein geblieben.
Vor rund zwei Wochen hatte der ganze Mist seinen Anfang genommen. Nach längerem Hin und Her hatte ich mich dazu entschieden, mal wieder einen Abstecher nach Deutschland zu machen, um meine Eltern und ein paar alte Freunde zu besuchen, die Einladung zum diesjährigen Klassentreffen im Gepäck. Die aus den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte ich jedes Mal in den Mülleimer geschmissen. Hätte ich es doch auch diesmal getan. Vielleicht kam mir ein schwer zu definierender Anflug von Sentimentalität in die Quere, oder es war einfach eine altersbedingte Melancholie mit der Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Wobei es die bisher nie gab, aber man wurde ja wunderlich, wenn man die besten Zeiten hinter sich hatte und sich dessen bewusst wurde.
Mir war es immer ein Rätsel, wie schon junge Menschen im Alter um die 20 den Drang danach verspüren konnten, sich einmal im Jahr in einem Lokal zu treffen, das die Atmosphäre einer Halle der Bahnhofsmission atmete. Dieses grundsätzliche Misstrauen gegenüber solchen Treffen hatte ich mir bis heute erhalten, und nun war ich ja durchaus nicht mehr der Jüngste. Allerdings noch immer ein paar Jahrzehnte zu jung für die Teilnahme an einem solchen Treffen. Und doch war ich hingegangen. Mag sein, dass mich letztlich eine Art von Neugierde hingetrieben hatte. Oder nur meine schwarze Seele. Warum nicht, dachte ich mir. Wenn du schon in deiner Heimat bist, kannst du dich auch kurz bei dem Treffen sehen lassen. Wirklich nur kurz. Nur um festzustellen, dass du, Martin Ebel, nicht enden willst wie die meisten dieser knapp Vierzigjährigen, die seit Langem in ihrer Lebensroutine gefangen sind. Mit Bauschulden, Gartenzaun, einem Job, der sie ankotzt, und der Hoffnung auf ein späteres komfortables Rentnerdasein.
So hatte ich mir das gedacht.
Und dann saß ich da, einer unter vielen sogenannten Jahrgängern. Schon das Wort! Hat einen Klang wie Kukident oder Inkontinenz. Ich fühlte mich nicht besonders wohl. Das alles war ein gutes Stück von meiner Welt entfernt. Ich war der Exot in der Runde, wie mir schnell klar wurde. Dass jemand seine Karriere als Rechtsanwalt hinschmeißt, um fortan als Aussteiger auf den Kanaren zu leben, passte nicht in das Weltbild schwäbischer Fastvierziger, die lebten und sich verhielten, wie es schon ihre Eltern getan hatten. Auch wenn die Welt zum globalen Dorf geworden war, blieben die Barrieren in den Köpfen festzementiert. In Ewigkeit, Amen! Mein Juristendasein in Stuttgart war seinerzeit nicht ganz freiwillig zu Ende gegangen, das band ich niemandem auf die Nase.
Dass ich in meiner neuen Heimat nicht als Aussteiger, sondern als Resident gelte, ist eine sprachliche Feinheit, mit der ich niemanden überfordern wollte.
Ja, ich hatte so etwas wie den Bonus des Außerirdischen bei diesem Jahrgangstreffen. Was ich denn arbeite, wollten einige wissen. Der Mensch definiert sich schließlich durch Arbeit, das war doch die gängige Annahme. Ich klärte auf, dass ich als Wanderführer und Mountainbikeguide in der schönen Stadt Los Llanos angestellt war, was mir zweifelnde Blicke einbrachte. Wie das Wetter so sei auf La Palma, interessierte andere, die den kommenden Sommerurlaub schon im Sinn hatten. »Das ganze Jahr über meistens schön«, konnte ich ihnen antworten. Ob ich verheiratet oder wenigstens fest liiert sei, war in diesem Rahmen natürlich eine bedeutende Frage. Das eine nie gewesen, das andere zurzeit auch nicht, gab ich zur Antwort. Dass es in der jüngeren Vergangenheit gewisse Probleme mit meiner einstigen Lebensabschnittsgefährtin Carmen gegeben hatte, ging niemanden an diesem Tisch etwas an.
So zog sich der Abend hin. Den Gefallen, breit gestreute Einladungen in meine neue Heimat auszusprechen, tat ich ihnen nicht. Ganz direkt traute sich auch keiner zu fragen. Außer Justus Häussler.
Dazu wartete er eine Gelegenheit ab, unter vier Augen mit mir zu reden. Dann kam er umso schneller zur Sache. Er habe da ein paar nicht einfach aus der Welt zu schaffende Schwierigkeiten, vertraute er mir verschwörerisch an, ein Glas Hefeweizen in der Hand. Es würde nicht schaden, wenn er sich für ein paar Wochen aus Deutschland verabschieden würde, fügte er mit einem theatralischen Augenzwinkern hinzu.
Ich schaute mir den Burschen näher an, der vor zwei Jahrzehnten mit mir Abitur gemacht hatte und mit dem ich später wenig bis nichts zu schaffen gehabt hatte. Hin und wieder hatten wir uns in der Heimatstadt getroffen, zufällig. Justus war ganz bestimmt nicht gerade das, was man für gewöhnlich einen guten Freund nannte. Hatte nach dem Abi an irgendeiner Fachhochschule etwas Betriebswirtschaftliches studiert, sich ein wenig die Welt angeschaut und später – um Lebenserfahrung reicher und um viele Illusionen ärmer – die mittelständische Spedition seines Vaters übernommen. Zusammen mit seinem älteren Bruder Thomas leitete er das Unternehmen.
Justus war geschieden, keine Kinder. Er war kleiner als ich, sein Haar war weniger dicht als meines und sein Bauch rundlicher als meiner, wie ich zufrieden registrierte. Seine Gesichtshaut begann schlaff zu werden, der Ansatz eines Doppelkinns machte sich bemerkbar. Die Ringe unter den Augen könnten entweder vom Alkoholkonsum dieses Abends rühren oder aber ständige Begleiter sein. Genau vermochte ich das nicht zu sagen. Das Hemd, das er trug, schien teuer gewesen zu sein, auch wenn ich von solchen Dingen nichts verstand. Ich kaufte meine T-Shirts für gewöhnlich in einem Laden in Los Llanos für ein paar Euro.
Justus Häussler hatte eine dunkle Stoffhose an, die ebenfalls nicht aussah, als würde ich sie mir leisten wollen oder können. Na ja, er war der Unternehmer von uns beiden. Ich dagegen konnte den unbezahlbaren Vorteil genießen, fast ganzjährig in kurzen Hosen herumlaufen zu können, wenn mir danach war.
Justus lud sich sozusagen zu mir nach La Palma ein. Ziemlich frech, wie mir später, zu spät, bewusst wurde. Nachdem ich halbherzig zugesagt hatte, nur um ihn loszuwerden. Wer konnte ahnen, dass er sich am nächsten Tag noch erinnerte. Er verfügte über eine gewisse Überzeugungskraft. Durchsetzungsvermögen nannte man das wohl im Geschäftsleben.
Es sollte nicht zu meinem Schaden sein, wenn ich ihn für ein paar Wochen aufnehmen würde, sagte er und grinste mich an wie ein Pennäler, der hinter dem Rücken seiner Eltern deren Tafelsilber verscherbelt. Für Justus war der Besuch auf La Palma an diesem Abend bereits beschlossene Sache. Dabei war ich alles andere als scharf auf einen Untermieter.
Der Blick auf die Uhr verriet mir, dass bis zur Landung auf dem Aeropuerto von Santa Cruz noch etwa eine halbe Stunde Zeit blieb. Zeit, um noch einmal über die vergangenen beiden Wochen nachzudenken. Der Besuch bei meinen Eltern verlief harmonischer, als die langjährige Erfahrung es hätte erwarten lassen. Auch sonst waren es zwei angenehme Wochen gewesen, in denen ich mich mit alten Freunden getroffen hatte. Ich hatte darüber gestaunt, dass der Straßenverkehr, vor allem der elendige Schwerlastverkehr, seit meinem letzten Besuch noch mehr zugenommen hatte, und mich gefragt, ob ich in Deutschland jemals wieder leben könnte oder wollte.
Zu intensives Nachdenken und eine Antwort ersparte ich mir. So machte ich das mit unangenehmen Dingen, die den Kern des eigenen Daseins berührten, eigentlich immer.
Auch die Gedanken darüber, wie Justus Häussler kurz entschlossen sein Geschäft für unbestimmte Zeit hinter sich lassen und verreisen konnte, trieb ich nicht gerade voran. Sein Bruder würde die Spedition so lange leiten, hatte er kurz und bündig gesagt. Justus plapperte zu Beginn des Flugs die ganze Zeit unbedeutendes Zeugs. Schließlich setzte sich mein demonstrativ an den Tag gelegtes Desinteresse durch und er wurde merklich stiller. Vor allem schien er sich darüber zu wundern, dass ich keine Anstalten machte, mehr über seine Probleme herauszufinden, die ihn vorübergehend aus der Heimat trieben. Die Wahrheit war, dass ich mir nicht auch noch die Sorgen anderer Leute aufhalsen wollte. Ich hatte genug eigene. In letzter Zeit hatte ich geradezu ein Abonnement auf Sorgen.
Eine davon war der neue Freund von Carmen. Ein paar Tage vor meinem Abflug hatte er mich auf offener Straße provoziert. Sagen wir, ich fühlte mich provoziert. Oder sagen wir, ich hatte darauf gehofft, dass er mich provozieren würde.
Es ging ziemlich schnell und am Ende hatte er ein leicht ramponiertes Gesicht. Jetzt drohte er mir mit rechtlichen Schritten.
Das war schon komisch. Eine ähnliche Situation hatte ich vor ein paar Jahren erlebt. Damals hatte ich mich mit meinem Vorgesetzten, dem Juniorchef der Stuttgarter Rechtsanwaltskanzlei Weißböck, Weißböck & Partner in die Wolle gekriegt und ihm einen nicht unwichtigen Knochen gebrochen. Eine Auseinandersetzung, aus der ich zwar als physischer Sieger hervorgegangen war, die aber auch das Ende meiner Karriere als Rechtsanwalt einläutete. So hatte die Juristerei mich verloren. Sei’s drum, dachte ich damals. An Talent hätte es mir nicht unbedingt gemangelt, wohl aber an ernsthaftem Karrierewillen.
Nach einem mehrmonatigen Umweg, der mich unter anderem nach Australien geführt hatte, war ich so vor ein paar Jahren in meiner neuen Heimat auf La Palma gelandet.
Und ähnlich wie damals war es jetzt wieder gelaufen. Dieser neue Macker von Carmen war mir gänzlich unsympathisch. Jeder andere wäre es sicher genauso gewesen, wie ich mir insgeheim eingestand, stolz auf den Rest meiner Fähigkeit zur kritischen Selbstbetrachtung. Der Kerl hatte mich auch nicht unbedingt ins Herz geschlossen. Die besten Voraussetzungen also für eine tragfähige Auseinandersetzung. Dass ich seine Nase etwas verschoben hatte, freute mich aufrichtig. Nicht so sehr konnte ich mich darüber freuen, dass Carmen alles mir in die Schuhe schob. Soweit ich wusste, tat sie nichts, um ihren Typen von einer Anzeige gegen mich abzuhalten. Mich an ihrem neuen Freund abzureagieren war wohl nicht die richtige Art, ihr zu zeigen, dass ich nach wie vor an ihr hing und sie, verflucht noch mal, vermisste wie keine andere zuvor.
Hinterher ist man immer klüger.
»Weißt du, das ist witzig. Ich war noch nie auf einer der Kanarischen Inseln.« Justus riss mich mit diesem Satz aus meinen Gedanken. Justus, der Vielgereiste. Da hatte er immerhin etwas mit mir gemeinsam. Auch ich war in jüngeren Jahren auf der Welt herumgekommen. Davon zeugten die Filmrollen mit Sand, die ich in meinem Wohnzimmer aufbewahrte. Das war früher so eine Marotte von mir: Von allen Stränden, die ich besuchte, hatte ich mir etwas Sand mitgebracht und in einer kleinen Filmdose aufbewahrt. Diese Dosen standen wie Zinnsoldaten in Reih und Glied auf einem Regal. Ein Anblick, der den flüchtigen Betrachter vermuten lassen könnte, dass ich Wert auf Ordnung lege. Was eine falsche Vermutung wäre.
»Noch nie?« Damit überraschte er mich tatsächlich ein bisschen.
»Nein. Ich kenne zwar alle Kontinente und habe sie mehrfach bereist. In Europa war ich fast in jedem Land. Aber auf den Kanaren war ich noch nie.«
»Das ist interessant«, sagte ich beiläufig und hielt diesen kurzen Satz der Situation angemessen.
»So interessant auch wieder nicht«, verbesserte mich mein Nebenmann, während er einen langen Blick hinter der hünenhaften Stewardess herschickte, die durch den Gang schwebte, als sei er der Laufsteg eines führenden Modehauses in Rom oder wo immer führende Modehäuser auch angesiedelt sein mochten. Eigentlich hatte Justus noch etwas über seine Reisegewohnheiten sagen wollen, wechselte aber das Thema. »Warum müssen die Stewardessen immer solche unvorteilhaften Kostüme tragen?« Mangels einer vernünftigen Antwort zuckte ich mit den Achseln. »Ich wusste gar nicht, dass die Fluggesellschaften so große Frauen als Stewardessen einstellen«, sagte er. Das Thema Sexismus im Zuge der MeToo-Debatte war offensichtlich spurlos an Justus vorbeigegangen.
»Da hat sich einiges geändert«, steuerte ich bei. »Früher gab es da strenge Normen, aber der Nachwuchsmangel hat dazu geführt, dass man die Voraussetzungen aufgeweicht hat. Habe ich so gehört.«
»Also, mir ist es ja egal, wie groß sie sind. Hauptsache, man kann sie anschauen.« Justus war vom alten Schlag. Er genderte nicht um den heißen Brei herum.
»Sicher«, sagte ich seufzend und blickte aus dem kleinen Fenster in ein geradezu schmerzend klares Himmelblau. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie ich die kommenden Wochen mit meinem ungebetenen Gast überstehen sollte.
2
International Airport war eine Übertreibung. Die Größe und der Glanz des Inselflughafens konnten der Bezeichnung in keiner Weise gerecht werden. Man hätte ihn auch The Only Airport nennen können. Oder, um mein schwäbisches Heimatidiom zu bemühen, Airportle.
Warme Luft umfing uns, als wir aus der Maschine stiegen und schnurstracks auf eigenen Füßen in die Ankunftshalle marschierten. Der International Airport in Santa Cruz war auch nach seiner baulichen Vergrößerung und Aufhübschung nichts anderes als ein Provinzflughafen geblieben, auf dem täglich eine Handvoll Maschinen landeten. Trotzdem schafften es über 200 deutsche Touristen, gleich nach ihrer Ankunft für ein Chaos zu sorgen, das einer Drehscheibe des internationalen Luftverkehrs tatsächlich gut zu Gesicht gestanden hätte.
Das einzige arbeitende Gepäckband lief zehn Minuten lang, bevor die ersten Gepäckstücke darauf erschienen. Sie hatten keine Chance, eine Runde zu drehen, denn ihre Besitzer stürzten sich mit Verve in den Kampf, um ja als Erste ihren Koffer vom Transportband zu wuchten. Sie machten keine Gefangenen.
»Wie die Geier«, kommentierte Justus Häussler das Geschiebe und Gedrücke. Er amüsierte sich augenscheinlich.
»Dabei sind die Leute in Ferien«, entgegnete ich. »Wenn sie in zwei Wochen wieder nach Hause fliegen, schwärmen sie von der mediterranen Gelassenheit.«
Mit einer fließenden Bewegung schnappte ich meinen Seesack vom Band. Die beiden Koffer von Justus – es waren zwei, und das ließ mich bezüglich der geplanten Aufenthaltsdauer meines Gastes Schlimmes befürchten – waren noch nirgends auf dem Transportband zu sehen. Dass Justus noch kein Rückflugticket gebucht hatte, wie er mir strahlend erklärt hatte, verbesserte meine Laune nicht gerade.
Ich stellte mich etwas abseits. Sollte er sein Gepäck ruhig selbst schleppen. Dafür, dass ich ihm vor ein paar Tagen nicht energischer widersprochen hatte, hätte ich mir selbst Ohrfeigen verpassen können. Was sollte ich mit dem Kerl in meiner Wohnung? Einem Typen, mit dem ich zufällig vor tausend Jahren die Schulbank gedrückt hatte. Schon nach unserem seltsamen Jahrgangstreffen hatte ich mir überlegt, ob ich ihn nicht woanders einquartieren könnte, hatte den Gedanken dann aber nicht weiterverfolgt. Bis vorhin im Flugzeug. Auf die Schnelle wollte mir keine Lösung einfallen. Ich musste schauen, dass ich Justus möglichst schnell wieder loswurde. Hatte keine Lust, dass er mir wochenlang auf die Pelle rückte. Und mich womöglich in etwas hineinzog, in das ich unter gar keinen Umständen hineingezogen werden wollte. Seine Probleme sollten nicht zu meinen werden.
Dachte ich mir.
Aber meistens kommt es ja sowieso anders.
Er schnaufte schwer, wie er da mit seinen beiden Koffern auf mich zukam. Das freute mich aufrichtig. Im Grunde meines Herzens war ich eben doch böse. Ich dirigierte Justus durch die Halle und legte mehr Eile an den Tag als notwendig.
»Jetzt müssen wir uns auf eine einstündige Busfahrt nach Los Llanos einstellen«, machte ich ihm Angst, während er schwitzend seine Kofferungetüme hinter sich herzerrte.
Es wirkte. »Busfahrt?«, fragte er verzweifelt und nach Luft ringend.
»Ja, klar. Hatte ich etwa vergessen dir zu erzählen, dass ich kein Auto mehr besitze?« Was der Wahrheit entsprach. Den Jeep, den ich mir kurz nach meiner Ankunft auf La Palma vor Jahren zugelegt hatte, musste ich nach einiger Zeit aus finanziellen Gründen verkaufen. Was so schlimm nicht war, denn damals hatte ich Carmen kennengelernt, deren Alfa Romeo mir bis zu unserer Trennung sozusagen uneingeschränkt zur Verfügung stand. Mittlerweile genoss ich in meinem Bekanntenkreis den Ruf, der größte Autoschnorrer zu sein, der jemals seinen Fuß auf die Insel des ewigen Frühlings gesetzt hatte.
Justus war platt. Das lag an seinen schweren Koffern, aber auch an der Nachricht, dass er ein öffentliches Verkehrsmittel würde benutzen müssen. Dabei graute mir selbst davor, mit dem Bus vom Flughafen auf die andere Seite der Insel zuckeln zu müssen.
Ich glaubte, noch einen Trumpf im Ärmel zu haben, den ich zunächst vor Justus verdeckt hielt. Wenn ein Flieger mit 200 oder mehr Touristen aus Deutschland eintraf, war die statistische Chance gar nicht so übel, dass ein paar von ihnen eine Wander- oder Mountainbikewoche bei Siggi gebucht hatten. Siggi war ein guter Kumpel von mir und außerdem mein Ernährer, wenn man so wollte. Als Inhaber der Bikestation waren er und seine Frau Claudia meine Chefs. Gut möglich also, dass Siggi und Claudia vor dem Flughafengebäude auf Gäste warteten und noch zwei Plätze in ihrem Landrover-Monster frei hatten. Darauf hoffte ich insgeheim. Vorhin am Transportband hatte ich gesehen, dass mehrere Passagiere ihre eigenen Fahrräder dabeihatten. Ein gutes Zeichen – in unserer Situation.
Wir traten aus dem Flughafengebäude hinaus in flimmernd warme Luft. Das waren bestimmt fünfzehn Grad mehr als heute Mittag beim Einchecken in Stuttgart. Ich war zu Hause!
Nur leider hatte ich mein Zuhause nicht für mich, was meine Stimmung trübte.
Das satte Grün der wenigen Pflanzen auf dem Flughafengelände ließ einen ersten Eindruck von der Isla Verde aufkommen. Ein schwitzender Uniformierter versuchte ohne großen Elan, den Verkehr vor dem Flughafengebäude am Laufen zu halten. Kleine Mietwagen, Taxen und ein paar Pick-ups veranstalteten ein bemerkenswertes Stop-and-go-Chaos. Wir überquerten den Zebrastreifen, wobei Justus’ Konditionsprobleme überdeutlich wurden. Ungewohnte Hitze und zwei schwere Koffer: Er hatte es nicht leicht.
Ich sah mich um. Keine Spur von Claudia oder Siggi. Oder einem der anderen Kollegen. Mist! Dann sprach doch alles für eine beschwerliche und unbequeme Busfahrt, was ich mit einem leisen Fluchen quittierte.
»Warte mal«, hörte ich die beleidigte Stimme von Justus von hinten an meine Ohren dringen. Ich drehte mich um. Es war wirklich ein herzerweichender Anblick, wie er seine Koffer hinter sich herzog. Es waren diese Dinger mit Rollen dran, bei denen schlimmes Design mit einer obszönen Lärmentwicklung einherging. Schweißflecken unter den Armen und am Kragen von Justus’ Hemd waren unübersehbar. Er tat noch ein paar Schritte auf mich zu, ließ die Koffer los und atmete durch. »Wo fährt der verdammte Bus ab?«, fragte er. Dabei sah er wirklich erbarmungswürdig aus. Die Karikatur eines deutschen Urlaubers.
»Dort drüben.« Ich zeigte in die Richtung eines kleinen orangefarbenen Schildes, das eine Haltestelle markierte.
»Muss das sein?«, maulte er. Von zu Hause war Justus wohl den dicken Benz oder etwas in der Art gewohnt. Da ist die Aussicht auf eine Tour in einem quälend langsamen, nach Ruß stinkenden Bus-Ungetüm von »Transportes Insular« schon ein herber sozialer Abstieg. Dafür konnte ich echtes Verständnis aufbringen. Zu meiner kurzen Zeit im Dienst der Paragrafen hatte ich die Vorzüge deutscher Limousinen ausgiebig genossen.
»He«, rief Justus laut, und sein Gesicht hellte sich auf. »Da. Das ist die Lösung unseres Problems.« Er zeigte auf ein großes grünes Schild mit dem Schriftzug »Europcar«. Sollte mir recht sein. Wenn er zahlte, konnte er ruhig einen Mietwagen nehmen.
»Ich muss hier auf der Insel ja mobil sein«, meinte Justus und seine Laune hellte sich schlagartig auf. »Also mieten wir uns ein Auto.«
Ich gab ihm den Tipp, dass er es billiger haben konnte, und verwies auf die einheimischen Vermieter, die keiner großen Kette angehörten und ihre improvisierten Büros in einem VW-Bus oder einem Jeep betrieben. Da konnte ein Mietwagen dann schon mal eine kleine Beule und ein paar Kilometer mehr auf dem Tacho haben, aber man sparte eben Kohle. Was im Fall von Justus wohl eher zweitrangig war. Immerhin waren die Autos allesamt in einem ordentlichen Zustand und sahen noch nicht unbedingt ihrer baldigen Wiedergeburt als Weißblechdose entgegen.
»Von mir aus«, sage Justus. »Wo geht’s am schnellsten?« Ich wies ihm den Weg und versprach, auf seine Kofferungetüme aufzupassen, während er die Bürokratie hinter sich brachte. War echt gespannt, mit was für einer Karre er anrücken würde. »Ich rühre mich nicht von der Stelle«, versprach ich. Innerlich war mir nach dem Gegenteil zumute.
Ein etwa Vierzigjähriger mit rasiertem Schädel und einem beeindruckenden Exemplar von leicht gezwirbeltem graublondem Schnauzbart fiel mir auf. Schien kein Einheimischer zu sein. Der Bursche trug ein schwarzes T-Shirt unter einer ebenfalls schwarzen Lederjacke, deren Ärmel aufgekrempelt waren. Die Wärme schien ihm nichts anzuhaben. Er lümmelte ein paar Meter entfernt an einem Baum. Kurz blickte er mich direkt an. Er hatte ein überaus markantes Gesicht, wie selbst auf die Distanz auszumachen war. Fast hätte ich mir eingebildet, der Kerl fixiere mich, doch dann schaute er in die andere Richtung.
Hätte ich nur genauer hingeschaut. Diese Eingebung wurde mir erst viel später zuteil.
Es dauerte nicht halb so lange, wie ich befürchtet hatte. Und das Auto war nicht halb so peinlich, wie ich erwartet hatte.
Ein Seat. Mittelklasse. Aufatmen bei mir. Zum Glück hatten sie keinen Chevy oder etwas ähnlich Protziges im Angebot, dachte ich erleichtert.
»Soll ich? Oder willst du?«, fragte mich mein einstiger Klassenkamerad und ließ den Schlüsselbund mit den Fahrzeugschlüsseln um seinen Zeigefinger kreisen. Die akrobatischste Leistung, die ich bisher von ihm zu sehen bekommen hatte.
»Fahr ruhig du«, sagte ich. Das würde ihn beschäftigen.
Nachdem wir das Gepäck verstaut hatten, beschrieb ich Justus, wie er vom Flughafengelände kam. Er fuhr los und bog kurz darauf auf die neu geteerte Schnellstraße ein. Der Atlantik zu unserer Rechten präsentierte sich in einem perfekten Blau, das von der Hand eines naiven Landschaftsmalers hätte stammen können.
Wir kurbelten die Fenster herunter und ließen das Chaos hinter uns. »Urlaub!«, posaunte ein bestens aufgelegter Justus zum Fenster hinaus. Seine Probleme schienen in Deutschland geblieben zu sein. Der alte Bauer, der mit einem schwer bepackten Esel wie ein lebender Anachronismus neben der frisch ausgebauten Straße stand, schaute kurz irritiert den Seat an, aus dessen Fahrerfenster der Schrei drang. Dann drehte er sich desinteressiert wieder weg.
Von Touristen war er Schlimmeres gewöhnt.
Unterwegs betete ich mein Wissen über die Insel herunter. Wortreich schwärmte ich von dem reizvollen Landschaftsbild La Palmas, von den grandiosen Gebirgslandschaften mit ihren tief eingeschnittenen Schluchten und Tälern, von der subtropischen Fauna und einer üppigen Vegetation im Norden und von den Vulkankegeln, die dem Süden des Eilands den Charakter einer Mondlandschaft gaben. Ich dirigierte meinen Chauffeur auf die 812, die Fernverbindungsstraße, die den Osten der Insel mit dem Süden verbindet und die die Hauptverkehrsader La Palmas darstellt.
Ich erzählte von den Menschen, für die es nicht immer einfach war, die vielen Zuwanderer, vor allem aus Deutschland, von Herzen willkommen zu heißen. Ich konnte sie nur zu gut verstehen. Denn längst nicht für alle waren die neuen Mitbürger ein Gewinn. Konnte man es einem palmerischen Kleinbauern verdenken, wenn er sich über die Deutschen aufregte, die sich einfach mir nichts, dir nichts das schöne Haus auf dem Nachbargrundstück leisten konnten, wenn er selbst mit seiner Familie in einem uralten Gebäude leben musste?
Seit Anfang der Achtziger war die Zahl der ansässigen Ausländer geradezu explodiert. Das Zusammenleben lief weitgehend unproblematisch ab und echte Freundschaften zwischen Einheimischen und Residenten waren nicht selten. Trotzdem, noch immer war es häufig ein Aufeinanderprallen zweier Welten.
Die Freundschaft eines Palmeros zu gewinnen war nicht einfach. Ich wusste, wovon ich redete.
Ich erklärte Justus, dass auf La Palma wie selbstverständlich mit dem geschichtlichen Erbe umgegangen wurde. Wer sich als Gast auf dieser Insel wirklich für die geschichtlichen Hinterlassenschaften der Altkanarier interessierte, musste sie sich schon selbst erarbeiten; etwa bei einer Wanderung zu den Höhlen der Ureinwohner und ihren beeindruckenden Felsmalereien. In der Rolle des Oberlehrers gefiel ich mir irgendwie.
Justus hörte zu oder tat zumindest so.
»So wohnt also ein Aussteiger«, sagte Justus nach unserer Ankunft mit dem Whiskyglas in der Hand und ich meinte, eine Spur von Enttäuschung aus seinen Worten zu hören. Das bestätigte er mir sogleich. »Also auf mich wirkt das … wie soll ich sagen … durchaus kleinbürgerlich.«
Was daran schlecht sein sollte, musste er mir gelegentlich mal erklären. Im Übrigen fand ich den Zustand meines vertrockneten Gummibaumes neben der im Wachkoma liegenden Yuccapalme alles andere als kleinbürgerlich.
Wir standen in meinem Wohnzimmer, das zu einer Wohnung gehörte, die zu einem Haus in der Avenida Venezuela gehörte. Eigentlich war es Carmens Wohnung. Bisher hatte sie noch keine Anstalten gemacht, mich hinauszuwerfen. Aber das konnte noch kommen. Denkbar, nein, sehr wahrscheinlich, dass ihr Neuer in dieser Richtung initiativ werden würde. Nach unserem jüngsten Zusammentreffen.
Nachdem ich mit Justus die beiden Scheißkoffer in die Wohnung bugsiert hatte, bot ich ihm etwas zu trinken an. »Ich gewöhne mir gerade das Saufen ab«, sagte ich zu meinem Gast und meinte das auch so. Irgendwie. Wirklich, ich hatte damit angefangen, meinen Alkoholkonsum zu reduzieren. Es gab inzwischen Tage, da schmeckte mir das Zeug nicht mal mehr. Aber es gab eben auch noch die anderen Tage.
Da außer Spirituosen nicht viel vorhanden war, entschied er sich für den Whisky, während ich mir das letzte Dorada aus der Dose einverleibte, das der Kühlschrank noch hergab. Verflucht, ich hatte den Kerl nicht eingeladen.
»Wie sieht das Programm für den Rest des Tages aus?«, wollte mein gut gelaunter Gast wissen, als er auf das geschäftige Treiben unten auf der Avenida Venezuela hinausblickte.
Prima, jetzt war ich also auch noch Animateur.
Dabei hatte ich nach zweiwöchiger Abwesenheit das eine oder andere zu erledigen. Einkaufen sollte ich. Zum Beispiel. Und ein paar Telefonate führen. Mich auf den aktuellen Stand der Dinge bringen.
Mir blieb nichts anderes übrig, als Justus zu beschäftigen. Um ihn für einige Zeit loszuwerden. Daher riet ich ihm, sich in Los Llanos umzusehen, einem wirklich hübschen Städtchen, das wie alle hübschen Städtchen auch seine weniger schönen Seiten hat. Aber die musste Justus ja nicht gleich als Erstes sehen. Vielmehr beschrieb ich ihm die Stadt in schillernden Farben. Er möge die Augen offen halten und sich das Erbe der Konquistadoren genau anschauen, forderte ich Justus auf und schwärmte von den weißen Häusern mit ihren prächtigen Holzbalkonen. Gut, davon gab es in unserem aufstrebenden und für hiesige Verhältnisse modernen Städtchen nicht mehr viele, aber er würde sie schon finden.
Widerwillig stimmte Justus zu, sich zu einem Spaziergang aufzumachen. Nachdem er endlich weg war, atmete ich auf. Eine Nervensäge in meiner Höhle, das würde ich nicht ertragen. Nicht dauerhaft. Ich ging zu dem kleinen Lebensmittelladen um die Ecke und kaufte ein paar Früchte, etwas Gemüse, ein paar Sixpacks Bier und tiefgefrorenen Fisch. Um das Spirituosenregal machte ich bewusst einen Bogen, denn das mit dem Saufen abgewöhnen meinte ich ernst. Gut, ich neige nicht zum Übertreiben, von Abstinenz wollte ich nicht reden. Weniger Alkohol zu trinken, würde mir ganz sicher nicht schaden.
Der Verkäufer, ein freundlicher junger Mann, der in meiner Nachbarschaft wohnte, plauschte kurz mit mir, packte alles in Plastiktüten, die wieder in größere Plastiktüten wanderten. Mit der Müllvermeidung hatten es die Palmeros nicht so. Praktisch alles, was es auf der Insel zu kaufen gab, kam erst einmal in eine Plastiktüte. Das gefiel mir zwar nicht, aber ich sah keinen Sinn darin, missionarisch tätig zu werden. Eigentlich sollte man meinen, dass sich die Meeresverschmutzung bis auf die Kanaren herumgesprochen hatte, doch hier hielt man das mit den Tüten so, wie man es schon immer gehalten hatte. Verstehen wollte ich das nicht, denn viele Palmeros lebten heute noch von dem, was das Meer hergab.
Zuletzt steckte mir der Verkäufer noch eine Eintrittskarte für ein Konzert des Mariachi-Orchesters aus Tazacorte am nächsten Sonntag zu. Der Vorverkauf laufe sehr schleppend, vertraute er mir an. Er habe die Karten von seinem Onkel geschenkt bekommen, der das Orchester leite. Bevor die guten Karten verfielen, verschenkte er sie lieber an seine Kunden. Ich bedankte mich. Ähnliches war mir in Deutschland noch nie widerfahren. Aber da gab es ja auch keine Mariachi-Orchester.
Als ich wieder zurück war, schnappte ich mir das Telefon.
Erst rief ich in der Bikestation an, obwohl mein Urlaub noch ein paar Tage dauern sollte. Vielleicht war ich in den kommenden Tagen ja froh, wenn ich arbeiten und dazu die Wohnung verlassen konnte. Dabei wollte ich in meinen letzten Urlaubstagen eigentlich von keiner größeren Sorge belästigt werden als der, wie ich am besten die Mücken aus meinem Weinglas halten konnte.
Claudia erzählte mir, dass alles seinen normalen Gang gehe. Das klang beruhigend, irgendwie.
Dann hatte sie doch noch eine Neuigkeit. »Ein VIP will auf La Palma Urlaub machen und in etwa zehn Tagen zwei oder drei Wanderungen mit uns machen. Siggi ist schon heftig am Planen. Er meint, dass du ihn betreuen könntest.« Claudia nannte mir den Namen eines deutschen Ministerpräsidenten, dem ich nicht im Mondschein begegnen wollte und der das Ende seiner politischen Karriere vermutlich noch lange nicht erreicht hatte.
Vor meinem geistigen Auge sah ich sein unfreundliches, leicht verschoben wirkendes Macher-Gesicht. Er war eines dieser Stehaufmännchen, denen kein Skandal ernsthaft etwas anhaben konnte. Für mich verkörperte er den Prototypen des verlogenen Politikers, der daran schuld war, dass die Distanz des Normalbürgers zu Typen wie ihm immer größer und unüberwindlicher wurde.
Claudia erntete von mir lautes Protestgeheul. »Nein. Niemals. Vergiss es! Mit diesem Kerl gehe ich nicht wandern.«
»Oh doch« kam mir aus dem Hörer entgegen. »Siggi meint, für diese Aufgabe braucht er seinen besten Mann.«
Hörte ich recht?
»Wie bitte?«, fragte ich sicherheitshalber zurück. Mir war unbekannt, dass Siggi mich für seinen besten Mann hielt. Jedenfalls hatte er sich mir gegenüber nie in dieser Weise geäußert. Eher vermittelte er mit schöner Regelmäßigkeit den Eindruck, dass er mich für unzuverlässig, charakterschwach und überhaupt einen schlechten Menschen hielt. Ein echter Motivationskünstler, mein Chef. Dabei glaubte ich, dass er mich insgeheim ins Herz geschlossen hatte.
»Du hast schon recht gehört. Und du wirst den Ministerpräsidenten und seine Begleiter führen!«, sagte Claudia im Brustton der Überzeugung. »Er wird mit seiner Frau, einem befreundeten Ehepaar und drei Leibwächtern zu uns kommen, die natürlich alle mitwandern.« Sie schien echt begeistert zu sein.
»Dass der Freunde hat, kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen«, maulte ich wahrheitsgemäß. »Und ich habe keine Lust, diese Arschkrampe über die schönen Berge zu schleifen. Ebenso wenig wie seine vermeintlichen Freunde.«
Claudia war nicht sonderlich beeindruckt. »Du führst dich auf wie ein bockiges Kleinkind.«
Mir war sehr daran gelegen, das Thema zu wechseln, und auch Claudia schien es nicht unrecht zu sein, nachdem sie mir noch einmal versicherte, dass ich meine ablehnende Haltung sicher noch mal überdenken würde. Sollte sie eben das letzte Wort behalten, ich war mir sicher, dass ich der Hackfresse nicht als Wanderguide zur Verfügung stehen würde.
Ich berichtete Claudia, dass ich einen ungebetenen Gast hatte. »Sag mal«, fragte ich sie, »hast du zufällig eine Ahnung, wo ich den Kerl einquartieren könnte, wenn er mir so richtig auf die Nerven geht?« Was, genau genommen, längst der Fall war.
»Das ist alles eine Frage des Geldes. Vom lausigen Loch bis zum Zimmer im besten Hotel kann ich alles vermitteln. Aber es schadet dir sicher nicht, wenn du dich ein paar Tage lang als guter Gastgeber benimmst.«
Wieder eine Bemerkung, die ich überging. »Geld scheint keine Rolle zu spielen«, antwortete ich. »Mir ist egal, wo er einzieht, nur möchte ich meine Wohnung nach ein paar Tagen wieder für mich alleine.«
»Deine Wohnung?« Die spitze Bemerkung hätte sie sich sparen können. Natürlich wusste sie, wie alle meine Freunde und die Hälfte der Bevölkerung von Los Llanos, dass meine Wohnung genau genommen Carmens Wohnung war und ich kurz davorstand, unter der Brücke schlafen zu müssen.
Claudia nannte mir ein paar Adressen von Häusern, in denen die Bikestation ihre Kunden regelmäßig unterbrachte. Die kannte ich selbst, und das war alles nicht das, was mir vorschwebte. »Lass mal gut sein, Claudia. Vielleicht ist der Bursche ja früher wieder weg, als ich befürchte.«
»Was bist du nur für ein Freund.« Sie hatte heute wirklich einen schnippischen Tag.
»Er ist kein Freund von mir. Ich habe ihn nur zufällig bei einer Jahrgangsfeier getroffen.«
Jetzt gab es für Claudia anscheinend kein Halten mehr. Sie prustete ins Telefon. »Höre ich richtig? Du warst bei einer Jahrgangsfeier. Du, Martin Ebel?«
Was es da zu blöken gab, blieb mir unbekannt. Ich legte auf. Mit dieser Frau war ja überhaupt nicht zu reden.