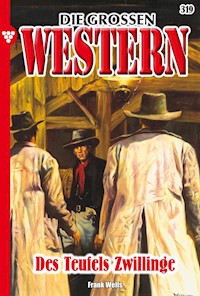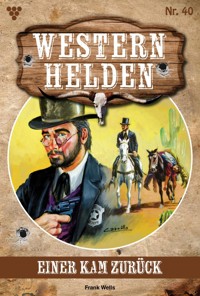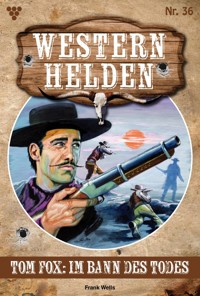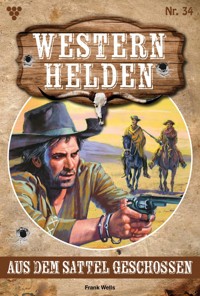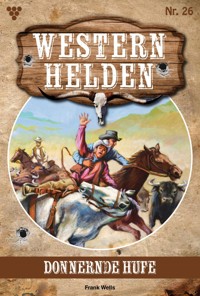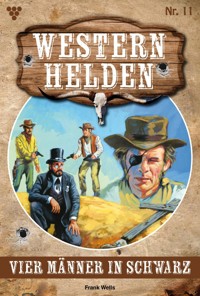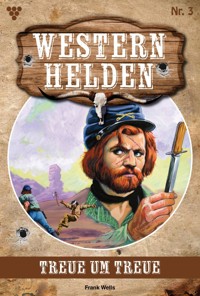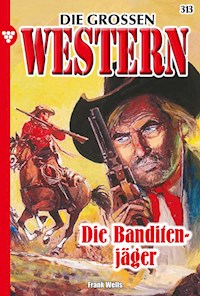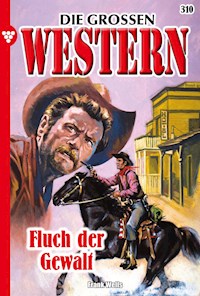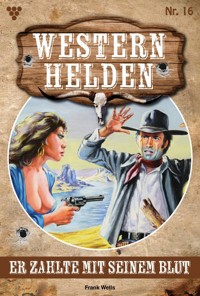
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Western Helden – Die neue Reihe für echte Western-Fans! Harte Männer, wilde Landschaften und erbarmungslose Duelle – hier entscheidet Mut über Leben und Tod. Ob Revolverhelden, Gesetzlose oder einsame Reiter auf der Suche nach Gerechtigkeit – jede Geschichte steckt voller Spannung, Abenteuer und wilder Freiheit. Erlebe die ungeschönte Wahrheit über den Wilden Westen Der Ort hieß Fillmore. Sie hätten ihn genauso gut »Ende der Welt« nennen können. Es musste trostlos sein, hier seine kurzen Erdentage zu verbringen. Es sei denn, man legte Wert darauf, lebendig begraben zu sein. Einem müden Reiter wie Glen Foster war es gleich, wo er sein Haupt zur Ruhe bettete. Hauptsache war für ihn, ein Dach über dem Kopf, kein Lärm außer dem Geheul hungriger Kojoten und ein Bett ohne Wanzen. Der Saloon mit dem einladenden Schild über der Tür »Zum scharfen Messer« schien einiges von dem zu versprechen. Der Staub auf der Straße lag knöcheltief, und ein bissiger Wind fuhr von Westen zwischen die Häuserflucht und wirbelte baumhohe, quirlende Fontänen auf. Schweres Gewölk zog hastig über die Kette der Powder Range heran und versprach Regen für die Nacht. Glen Foster glitt vor der Bar aus dem Sattel und schickte einen müden Blick über die paar Gestalten unter der Veranda hin. Es konnten Cowboys sein oder Schießer, sie sahen zäh aus, hatten schmale Lippen und verkniffene Augen. Sie schienen im Augenblick viel Zeit übrig zu haben. Ausnahmslos trugen sie Waffen, und zwar nicht nur Colts, sondern auch Gewehre, die sie wie Bräute zu liebkosen schienen. Glen überlegte flüchtig, ob er seinen abgetriebenen Braunen an die Haltestange neben der Tränke binden sollte. Er ließ es vorläufig sein, steckte die Linke ins Wasser des Wassertroges und fand, dass das Wasser zu brackig und abgestanden war. Er nahm einen Eimer, ging zum Brunnen mitten auf dem freien Platz vor der Bar und füllte ihn. Sein Mustang prustete freudig und soff in langen Zügen. Glen kehrte zur Haltestange zurück und band den Mustang an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Helden – 16 –Er zahlte mit seinem Blut
Frank Wells
Der Ort hieß Fillmore. Sie hätten ihn genauso gut »Ende der Welt« nennen können. Es musste trostlos sein, hier seine kurzen Erdentage zu verbringen. Es sei denn, man legte Wert darauf, lebendig begraben zu sein.
Einem müden Reiter wie Glen Foster war es gleich, wo er sein Haupt zur Ruhe bettete. Hauptsache war für ihn, ein Dach über dem Kopf, kein Lärm außer dem Geheul hungriger Kojoten und ein Bett ohne Wanzen. Der Saloon mit dem einladenden Schild über der Tür »Zum scharfen Messer« schien einiges von dem zu versprechen.
Der Staub auf der Straße lag knöcheltief, und ein bissiger Wind fuhr von Westen zwischen die Häuserflucht und wirbelte baumhohe, quirlende Fontänen auf. Schweres Gewölk zog hastig über die Kette der Powder Range heran und versprach Regen für die Nacht.
Glen Foster glitt vor der Bar aus dem Sattel und schickte einen müden Blick über die paar Gestalten unter der Veranda hin. Es konnten Cowboys sein oder Schießer, sie sahen zäh aus, hatten schmale Lippen und verkniffene Augen. Sie schienen im Augenblick viel Zeit übrig zu haben. Ausnahmslos trugen sie Waffen, und zwar nicht nur Colts, sondern auch Gewehre, die sie wie Bräute zu liebkosen schienen.
Glen überlegte flüchtig, ob er seinen abgetriebenen Braunen an die Haltestange neben der Tränke binden sollte. Er ließ es vorläufig sein, steckte die Linke ins Wasser des Wassertroges und fand, dass das Wasser zu brackig und abgestanden war. Er nahm einen Eimer, ging zum Brunnen mitten auf dem freien Platz vor der Bar und füllte ihn. Sein Mustang prustete freudig und soff in langen Zügen.
Glen kehrte zur Haltestange zurück und band den Mustang an. Er spürte ein merkwürdiges Kribbeln auf der Haut. Die Stadt gefiel ihm nicht. Die Burschen auf der Veranda gefielen ihm auch nicht – es sah wahrhaftig so aus, als wäre er hier im Vorzimmer der Hölle. Banditentowns sahen so aus wie dieses Fillmore.
Glens Mustang war zu müde für weitere Meilen. Es hatte keinen Sinn, so kurz vor Einbruch der Nacht noch weiterzupilgern. Bis Orchid City mussten es noch hundert Meilen und mehr sein. Und das Gelände war rau.
Glen nahm Mantelsack und Gewehr und warf es sich über die Schulter.
Die Boys regten sich noch immer nicht.
Als Glen die Veranda querte, warf er ein gleichgültiges »Hallo … « hin. Nur einer der Männer hob den Kopf und bedachte Glen mit einem unergründlichen Blick.
Der Anblick der Bar überraschte Glen Foster. Er hatte irgendetwas Düsteres, Dreckiges erwartet, mit einem Haufen Staub überall und Zigarettenkippen in allen Ecken. Stattdessen sah er eine blitzblanke Theke mit einem kugelrunden Mann dahinter, sah saubergescheuerte Tische, leere Aschenbecher und eine Batterie von vielversprechenden Flaschen im Regal hinter der Theke. Und aus der Küche kam ein Duft von gebratenen Steaks, der ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Niemand war sonst im Raum, nur der Dicke.
Glen Foster nahm den Hut ab und wischte das Schweißband trocken. Seine Beine waren steif vom langen Ritt. Er hätte nie gedacht, dass die Strecke von Laramie herauf über Fort Fetterman sich so ins Endlose dehnen würde. Es war ein menschenleeres Land, das er hinter sich gebracht hatte, ein wildes Land von ursprünglicher Schönheit.
»Ich suche ein Bett für die Nacht«, murmelte Glen. »Wie stehts damit, Mister?«
Das Mondgesicht lächelte vergnügt. »Bestens, Freund. Wollen Sie eins mit Morgensonne oder eins mit Blick auf die Straße?«
»Welches ist billiger?«
»Zur Straße ’raus ein Dollar pro Nacht!«
»Genehmigt.«
»Einen Drink, Freund?«
»Später. Ein Steak wäre mir lieber. Hab ’nen Hunger, dass ich meine Nägel anknabbern könnte.«
Der Dicke lachte wie über einen guten Witz. Er zauberte ein Buch unter der Theke hervor und drückte Glen einen Bleistift in die Hand. »Muss alles seine Ordnung haben, Freund! Manchmal kommt der Bezirks-Sheriff vorbei und interessiert sich für die Namen.«
»Was Sie nicht sagen! Der nimmt’s wohl mächtig ernst mit seinem Beruf, was?«
»Ziemlich. Besonders bei Fremden. Sie kennen Nick Mifflin noch nicht?«
»Bin das erste Mal in dieser Gegend.«
»Aus Texas?«
Glen hob überrascht den Kopf. »Woher wissen Sie das?«
»Man hört’s. Ihr da unten im Süden sprecht einen Slang, der euch immer gleich verrät. Wars so schlimm, dass Sie gleich so weit weglaufen mussten?«
Glen grinste breit. »Sehr schlimm, Mister. Ich habe zehn Männer umgebracht, und das alles in einer Nacht. War ’ne höllische Arbeit, kann ich Ihnen sagen. Als ich gerade den zehnten beerdigen wollte, sind sie mir draufgekommen. Seitdem bin ich Tag und Nacht durch geritten – und bloß weil Sie mir ein hübsches Zimmer mit Morgensonne versprochen haben, bin ich hier abgestiegen.«
Der Dicke verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Nicht mit Morgensonne, das kostet einen halben Dollar mehr. Da wird nämlich auch mehr geboten.«
»Aha.«
Glen schrieb seinen Namen in das zerfledderte Meldebuch und fügte hinzu: »Auf der Durchreise.«
Dem Barmann genügte das nicht, denn er brummte: »Von wo nach wo? Das müssen Sie schreiben, sonst wird Nick Mifflin wild!«
Glen zuckte die Achseln und schrieb: »Von Laramie nach Orchid City.«
Kurze Zeit später sollte er diese Offenherzlichkeit bitter bereuen. Aber noch ahnte er nichts davon. Es hat auch sein Gutes, wenn man nicht in die Zukunft blicken kann.
Das Steak war so erstklassig, wie der Duft aus der Küche versprochen hatte. Der Whisky war nicht erstklassig, dafür aber teuer. Die Zigarette tröstete Glen darüber hinweg.
Ein paar Reiter kamen in die Stadt gefegt. Glen sah sie schräg durch das Fenster – zwei schwere Brocken, deren starkknochige Mustangs keuchten und schäumten. Sie parierten die Tiere vor der Bar, durch, und der eine der beiden schrie: »Was habt ihr hier herumzulungern, he? Verschwindet aus der Stadt, aber im Galopp! Ihr werdet auf der Ranch gebraucht.«
Der Mann war groß wie ein Baum und sicher so stark wie ein Bison. Er trug einen Cordanzug, dessen Jacke weit offenstand, darunter eine dunkelrote Weste und ein ehemals weißes Hemd. Sein Halstuch war ebenfalls rot und der breitkrempige Hut auf der borstigen, blonden Mähne grau. Er trug einen ziemlich hochgeschnallten Colt unter der Jacke. In der Linken hielt er eine Flasche, die er nach der zornigen Ansprache an die Lippen setzte, um einen langen Zug zu tun.
Der andere Mann war nicht ganz so groß, aber dafür in den Schultern noch breiter. Sein breitknochiges, ausdrucksloses Gesicht war so steinern wie eine Granitwand, und die Augen lagen klein wie funkelnde Knöpfe in den Höhlen.
Die Gents vor der Bar erhoben sich wie ein Mann und stolzierten breitbeinig zu ihren Pferden, die im Gang neben der Bar angehalftert standen. Sie stoben in einer Staubwolke zur Stadt hinaus.
Die Stimme neben Glen war nicht mehr als ein Flüstern, und er zuckte erschrocken herum. Er hatte die Frau nicht kommen hören. Es war eine Frau, die offenbar keine schönen Zeiten hinter sich hatte, denn ihr hartes Gesicht war von tiefen Runen durchpflügt.
»Hüten Sie sich vor denen!« flüsterte sie. »Sie machen sich einen Spaß daraus, einen Fremden durch den Wolf zu drehen. Oder kennen Sie Jill Malloy und Bulldogge Simpson?«
»Nein«, murmelte Glen, »ich kenne sie nicht. Gibt es nicht einen Malloy in Orchid City?«
»Der gehört auch zu der Brut. Er ist ein Onkel von Jill – der Bruder von Derek Malloy.«
»Wer ist Derek?«
»Jills Vater. Sie sollten in Deckung gehen, Mann aus Texas! Und wenn Sie wissen wollen, warum ich Sie gewarnt habe – ich stamme auch aus Texas.«
Die Frau glitt mit den leeren Tellern weg wie ein Schatten und verschwand in der Küche.
Malloy – das war derselbe Name, der in dem Brief erwähnt war. In dem Brief, den Glen Foster seit Wochen mit sich trug, auf dem ganzen langen Trail von Süden herauf. Sein Freund Lenk Quinn hatte ihn geschrieben. Und wenn ein Freund rief, musste man sich auf die Socken machen.
Der Riese im Cordanzug – Jill Malloy – saß noch immer im Sattel. Sein gerötetes Gesicht wies einige Züge nackter Gemeinheit auf, die wohl durch den genossenen Alkohol besonders deutlich zutage gefördert wurden. Sein mächtiger Oberkörper schwankte sanft hin und her wie ein Baum unter einer stetigen scharfen Brise. Er setzte die Flasche wieder an den Mund und trank. Dann schleuderte er sie in die Pferdetränke und rutschte aus dem Sattel.
Glen Foster hatte keine Lust, die nähere Bekanntschaft der Familie Malloy zu machen. Er ließ den Rest Whisky stehen und ging zur Treppe im hinteren Teil der Bar.
Der Dicke kam vom Hof herein, rieb sich fröhlich die Hände und sagte: »Ich habe Ihr Pferd versorgt, Mr. Foster. Ein prächtiges Tier, alles was recht ist. Aber mächtig müde. Hatten Sie’s so eilig?«
»Ziemlich. Und jetzt ab ich’s noch eiliger, in die Klappe zu kommen.«
»Gut. Ich zeige Ihnen das Zimmer.«
*
Dämmerung fiel wie ein schweres, graues Tuch über die Stadt, als die Postkutsche von Süden heranrollte.
Glen Foster trat interessiert ans Fenster und sah den Barmann auf die Straße treten.
Die vierspännige Kutsche kam in Karriere heran, dann quietschten die Bremsen, und die schäumenden Pferde kamen zum Stehen. Der Kutscher sprang vom Bock. Ein Stallboy strängte die Tiere aus, und die Passagiere verließen die Kabine.
Der Barmann stand hemdsärmelig neben der Kutsche, hielt die Tür auf und dienerte unaufhörlich.
Als Erster stieg ein hagerer, grauköpfiger Herr aus, der einer jungen Dame behilflich war. Es war schon zu dämmerig, um das Gesicht der Lady genau erkennen zu können. Ihre Figur war schlank und biegsam wie eine Gerte, man hätte sie mit einem Jungen Mann verwechseln können. Unter dem breiten Hut schaute schwarzes Haar hervor, das in ungebändigten Wellen bis auf die Schulter floss.
Hinter der Lady kroch ein fetter, stiernackiger Mann aus der Kutsche. Er hielt eine lange Zigarre zwischen den Lippen.
Plötzlich tauchten die beiden Riesen auf: Malloy und Bulldogge Simpson. Malloy ging breitbeinig wie ein Seemann bei Windstärke zwölf. Simpson folgte ihm nur drei Schritte und blieb dann still ein wenig abseits von der Kutsche stehen.
Glen Foster griff hastig nach der Lederjacke, warf sie über und schnallte den Gurt mit dem Halfter um. Durch das halbgeöffnete Fenster hörte er die heisere, rohe Stimme Malloys: »Verdammt will ich sein, wenn das nicht der triefäugige Stanley Morgan ist! ’ne prächtige Überraschung am frühen Abend, was? Mann, Sie haben sich aber ’ne kesse Puppe angelacht! Viel zu schade für so einen alten Griesgram, hahahaa!«
Zwei Schritte vor der Frau und dem schlanken, grauhaarigen Herrn namens Stanley Morgan blieb Jill Malloy stehen. Er hatte den Huf weit im Nacken, die Beine gespreizt und die Daumen hinter den Gurt gehakt.
Stanley Morgans Gesicht zuckte. Es konnte Furcht sein oder auch Zorn über die Unverschämtheit. Er schaute Malloy voll an und rief mit klirrender Stimme: »Ich habe nichts mit Ihnen zu schaffen, Malloy! Sie können sicher sein, dass ich diese Stadt nie betreten haben würde, wenn nicht die Kutsche …«
Jill Malloy trat einen gleitenden Schritt auf Morgan zu, und seine Faust krachte mit der Wucht eines explodierenden Geschosses in das deckungslose Gesicht.
Stanley Morgan wurde gegen das Rad des Wagens geschleudert. Er wälzte sich im Staub und kam auf die Knie hoch. Sein Kopf schaukelte hin und her, als wäre er an einem lockeren Band aufgehangen.
Als Morgan torkelnd auf die Füße kam, krachte plötzlich ein Colt.
Glen Foster stand starr vor Schreck und Entsetzen. Er sah die aufblühenden Mündungsflammen und die schlanke Gestalt Stanley Morgans, der vom tödlichen Blei durchgeschüttelt wurde wie ein Halm im Sturmwind.
Die Lady wich Schritt für Schritt zurück, bis sie mit dem Rücken gegen das Vorderrad der Postkutsche stieß. Sie schlug die Hände vors Gesicht, und ihre Schultern zuckten wie im Krampf.
Der Barmann huschte flink zur Seite und tauchte unter der Veranda unter. Bulldogge Simpson regte sich nicht.
Es war Mord, nackter, kalter und erbärmlicher Mord, so erbärmlich und niederträchtig, wie Glen Foster es noch nie erlebt hatte. Er hatte Erfahrungen genug gesammelt, mehr als genug.
Er riss die Gardine zur Seite und stieß das Fenster ganz auf. Stanley Morgan war tot, lag lang ausgestreckt auf dem Gesicht und regte sich nicht mehr. Jill Malloy stieß umständlich die noch rauchenden Hülsen aus der Trommel des Colts und schob neue Patronen ein. Er steckte die Waffe ins Leder zurück – und vom ersten Schuss bis zu diesem Augenblick war keine Minute vergangen.
Mit der sturen Zielstrebigkeit eines Betrunkenen wandte Malloy seine Aufmerksamkeit dem nächsten Objekt zu – der Lady. Er lachte nicht mehr, aber in seiner Stimme schwang tiefe Befriedigung mit: »Diese stinkende Kröte! Wollte doch tatsächlich einen Trick versuchen und mich umlegen!«
Die junge Frau ließ die Hände sinken und starrte Malloy aus weitgeöffneten Augen an. Dann schrie sie: »Sie sind eine Bestie! Stanley Morgan hatte überhaupt keine Waffe bei sich! Wie hätte er sich gegen Sie wehren sollen?«
»He, Schwester! Sie wollen doch nicht sagen, dass ich lüge? Er hatte die Kanone im Ärmel versteckt. Das ist ein uralter Trick, und ich falle nicht drauf rein. Hast du’s gesehen, Simpson?«
»Yeah«, erwiderte der Bulle, der immer noch reglos am gleichen Fleck stand.
»Er hats gesehen, mein Täubchen«, sagte Malloy. »Er ist mein Zeuge. Glauben Sie’s nun?«
»Er lügt so wie Sie!« rief die Lady, »Sie bezahlen ihn dafür! Ein Mann wollen Sie sein? Der letzte Dreck sind Sie!«
Die junge Frau war tapfer, zu tapfer. Ihr Widerspruch und ihr Zorn musste einen Mann wie Malloy reizen. Und das sollte sich gleich zeigen.
Wieder war es ein langer, gleitender Schritt, mit dem Jill Malloy zu der Frau hinübertrat. Er streckte die Hand aus und zog sie mit einem brutalen Griff an sich.
Glen Foster wartete keine Minute länger. Er schwang die Beine aufs Dach der Veranda und rief: »Hände weg, Malloy!« Er brauchte zwei Schritte bis zum Rand der Veranda. Er sah, dass Bulldogge Simpson gedankenschnell zum Colt langte – und er flog mit einem Panthersprung auf den Bullen hinab.
Sie knallten zusammen wie zwei Expresszüge in voller Fahrt. Glen riss im letzten Augenblick beide Fäuste hoch und stieß sie in Bulldoggs Bauch. Dann wälzten sie sich übereinander, und Simpson stöhnte.
Durch den Schwung des Anflugs wurde Glen Foster über den aufs Kreuz krachenden Simpson hinweggeschleudert. Er landete auf der rechten Schulter, überschlug sich und stand wieder. Er wirbelte herum und warf einen Blick auf Jill Malloy.
Seine schlimmsten Befürchtungen wurden noch übertroffen. Malloy hielt mit der Linken die Lady fest an sich gepresst, während in seiner Rechten der Lauf des Colts schimmerte und im gleichen Augenblick Feuer spie.
Die Kugel verfehlte Glen nur um Haaresbreite. Er hörte sie vorüberzirpen und ging auf die Knie nieder, während er selbst zum Colt griff.
Es war ein riskanter Schuss. So breit Jill Malloys Brust auch war, er hielt das Mädchen wie einen Schild vor sich gepresst. Nur eines bedachte er nicht – dass sein Kopf weit über den der Frau hinausragte.
Malloys zweite Kugel staubte neben Glens Knie in die Straße. Zu einer dritten bekam er keine Gelegenheit mehr, denn Glen zog den Colt zauberhaft schnell hoch und ließ den Hammer auf die Patrone fallen. Die Kugel traf Malloy in den Kopf.
Glen Foster sprang hoch und einen Schritt zur Seite. Keine Sekunde zu früh, denn Bulldogge Simpson kam angebraust wie ein Bison. Seine Fäuste stachen Löcher in die Luft. Um der Gefahr zu begegnen, schlug Glen den stählernen Lauf des Colts mit schmetternder Wucht über Bulldogges Hinterkopf. Das gab dem rasenden Ansprung des Riesen noch einen gepfefferten Schwung dazu, und er segelte mit der Nase voraus in den Staub.
Die Lady stand noch stocksteif am gleichen Fleck, aber die Pranke Malloys hielt sie nicht mehr umklammert, Beide Arme des riesigen Mannes hingen schlaff herab. Er taumelte hin und her und kippte plötzlich nach hinten weg, als hätte ihn ein unsichtbarer Mann in die Kniekehlen getreten. Er war so tot wie Stanley Morgen. Doch daran war ganz und gar nichts Tröstliches oder Erfreuliches.
Der Barmann und der fette Kerl aus der Postkutsche standen auf der Veranda wie festgenagelt. Der Stallboy hielt mit den abgetriebenen Postpferden im Gang neben der Bar und starrte herüber. Der Postkutscher kratzte sich hinterm Ohr, murmelte einen Fluch und trieb die Pferde an, Glen Foster trat auf die Lady zu, nahm ihren Arm und ging schweigend mit ihr in die Bar. Seine Gedanken wirbelten. Er fühlte sich ausgebrannt und milde – und gleichzeitig so aufgepulvert wie selten in seinem Leben. Er führte die Dame an die Theke, langte irgendeine Flasche aus dem Regal, füllte zwei Gläser und sagte: »Trinken Sie! Alles auf einmal – das hilft!«
Sie trank, aber ihr Gesicht blieb grau wie Asche. Schreck und Entsetzen hatten sich in sie hineingewühlt. Es würde lange dauern, bis sie sich von diesem Schock erholte.
Glen trank selbst und füllte die Gläser wieder. »Noch einmal!« befahl er. Und sie gehorchte und trank.
Der Barmann kam hereingewankt und schüttelte unaufhörlich den Kopf. Der fette Fahrgast watschelte hinter ihm her und rief: »Das war ein Ding! Mann, war das ein Ding. Wenn ich das erzähle, glaubt’s kein Mensch. Schenk mir einen ein, Frenchie! Und lass die Flasche gleich dabeistehen! Hell und damnation, wenn ich mir überlege, wie …«
»Halten Sie den Mund!« fauchte Glen. Er schaute den Barmann an und sagte: »Die Dame braucht ein Zimmer. Ich hoffe, Sie haben noch etwas frei.«
Der Barmann schüttelte den Kopf. Er warf einen schiefen Blick auf den fetten Gast und murmelte: »Ich habe kein Zimmer mehr. Auch nicht für Sie, Mr. Foster.«
»Was, zum Teufel, soll das heißen?«
Frenchie antwortete nicht. Er machte kehrt und verschwand in der Küche. Der fette Gast nahm seine Flasche und sein Glas und verzog sich in die Ecke der Bar.
Die Lady neben Glen wandte den Kopf und schaute ihn mit trostlosen Augen an. »Stanley Morgan war ein prächtiger Mann. Wenn ich daran denke, wie er sterben musste!«
»Sind Sie mit ihm verwandt?«
»Nein. Er war unterwegs nach Orchid City. Er wollte uns helfen. Nun ist er tot. Mein Gott – sind Sie fremd hier? Ich meine, kennen Sie diese Stadt und dieses und nicht?«
»Nein. Ich bin unterwegs nach Orchid City. Falls Sie einen Mann namens Lank Quinn kennen sollten – er ist mein Freund.«
Sie ergriff Glens Arm. Plötzlich flüsterte sie: »Wir müssen weg! Wir dürfen keine Sekunde verlieren! Hören Sie – dies ist Malloys Stadt! Hier tanzen alle Puppen für ihn! Wenn er mit seiner wilden Horde kommt …«
Glen Foster konnte sich eine sehr gute Vorstellung von der wilden Horde machen. Er hatte einige Mitglieder gesehen. Die Boys vor der Bar – die Männer mit den ledernen Gesichtern und den harten Augen. Ihm ging ein Kronleuchter auf.
»Gut«, erwiderte er in schnellem Entschluss. »Wo kriegen wir ein Pferd für Sie?«
»Ich … Ich weiß nicht. Auf mich kommt es auch nicht so sehr an. Sie sind in Gefahr.«
»Wir stecken beide im gleichen Dreck. Ich reite nicht ohne Sie. Moment, ich hole nur meine Sachen!«
Als Glen mit Mantelsack und Gewehr von seinem Zimmer herunterkam, stand die verhärmte Frau, die aus Texas stammte und ihn vor Malloy gewarnt hatte, unten an der Treppe.
»Kommen Sie!« raunte sie. »Ich habe alles gehört. Rufen Sie die Lady! Ich habe ein Pferd für sie.«
Ein Wink genügte, und die Dame kam zur Hintertür. Im Stall standen etwa zehn Tiere, unter denen Glen wählen konnte. Er suchte ein stämmiges Pferd aus, das zwar nicht sonderlich schnell zu sein schien, dafür aber umso ausdauernder. Wortlos legte die Frau aus Texas dem Tier einen Sattel auf, und als Glen seine Brieftasche zog, um zu zahlen, winkte sie ab.
»Sie schulden mir nichts!« murmelte sie. »Für mich waren Sie eine Erinnerung an bessere Zeiten. Und Sie haben eine Bestie getötet. Sie haben Derek Malloy das angetan, was ich ihm hätte antun sollen. Seit Jahren schon. Ich hasse die ganze Brut, wie ich nie etwas gehasst habe. Reiten Sie! Reiten Sie schnell, und seien Sie vorsichtig! Nehmen Sie nicht den geraden Weg, dort werden Sie bestimmt eingeholt. Wenn Sie den Cheyenne-River erreichen, folgen sie ihm ein Stück nach Osten bis zu den Vorbergen der Black Hills! Dort sind Sie in Sicherheit.«
»Danke … mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Sobald ich kann, schicke ich das Pferd und den Sattel zurück.«
»Das ist nicht nötig. Und bleiben Sie nicht in Orchid City! Reiten Sie weiter, ohne jeden Aufenthalt! Derek Malloys Arm reicht weit, und seine Rache würde fürchterlich sein! Bedenken Sie, dass in Orchid City Malloys Bruder wohnt!«
Glen Foster half der Lady in den Sattel und stieg selbst auf seinen etwas erholten Braunen.
Die Frau wies ihnen einen schmalen Pfad am Stall vorbei auf die offene Prärie hinaus.
Sie ritten langsam, und Glen ertappte sich dabei, dass er nach hinten lauschte. Aber die Stadt blieb still. Noch war das Unheil nicht unterwegs.