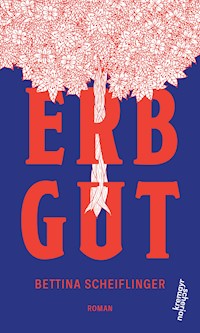
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit einem lauten Schrei erblickt ein Kind das Licht der Welt und ein Lebensweg, dessen Bahnen schon vorgegeben zu sein scheinen, nimmt seinen Lauf. Rund um die Ich-Erzählerin wird ein Netz aus Beziehungen offenbar: vom gewalttätigen Großvater väterlicherseits, der NSDAP-Mitglied und später Kriegsgefangener war, der Großmutter mütterlicherseits, die als Tochter von italienischen Gastarbeiter*innen in der Schweiz aufwuchs, bis zu den Eltern, die sich in Bezug auf ihre Vergangenheit in Schweigen hüllen. Als sie erwachsen wird, steht die junge Frau vor der Wahl, welchen Weg sie selbst gehen möchte. Kann sie sich vom unsichtbaren Erbe ihrer Vorfahren lösen? Bettina Scheiflinger setzt in ihrem Debütroman Szenen aus verschiedenen Biografien wie Mosaiksteinchen nebeneinander, bis allmählich sichtbar wird, wie über Generationen Verhaltensweisen, Lebensentwürfe und Traumata weitergegeben werden und mahnend über den Individuen schweben, die um ihre Eigenständigkeit ringen. "Bei meiner Geburt jage ich meiner Mutter einen Schrecken ein. Mich muss man nicht aus ihr herausholen, ich will von selbst aus ihr raus. Ich presse mein Gesicht als Erstes durch den Geburtskanal. Augen voran komme ich zur Welt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Scheiflinger
Erbgut
Roman
Bei meiner Geburt jage ich meiner Mutter einen Schrecken ein. Niemand muss mich aus ihr herausholen, ich will von selbst heraus. Es ist sogar noch einige Wochen zu früh. Ich presse mein Gesicht durch den Geburtskanal. Augen voran komme ich zur Welt. Ich will ihr frontal begegnen, mich ihr entgegenstrecken und sofort sehen, was da ist. Mein Gesicht verzerrt sich dabei. Die Augen und der Mund werden in alle Richtungen gezogen. Beides öffne ich weit.
Meine Mutter denkt, etwas stimmt mit mir nicht.
Mein erster Atemzug ist lang und gierig. Dann beginne ich laut zu schreien.
»Du warst ein Wunschkind«, erzählt mir meine Mutter Jahre später das erste Mal. Danach wiederholt sie es an jedem meiner Geburtstage.
Ich bin das zweite Wunschkind meiner Eltern. Bei meiner Geburt ist meine Mutter schon über dreißig. Das gilt als späte Mutterschaft. Es sind die Achtziger. Meine Mutter strahlt als Wöchnerin. Sie ist so erleichtert. Sie murmelt: »Ein liebes Mädchen.«
Jetzt gibt es für sie nichts Wichtigeres mehr, als dass ich mich gesund entwickle, dass ich wachse, heirate, eine Familie gründe und immer sehr glücklich bin.
Meine Schwester Anna war vor mir da. Ich bleibe das letzte Kind meiner Eltern. Mein Vater wollte schon vor mir aufhören.
Johanna liegt auf dem Küchentisch. Das Kind will jetzt sofort aus ihr heraus. Es ist Krieg. Johanna hört die Flieger nicht, die in der Ferne am Himmel kreisen. Die Leute eilen zum Wirtshaus, steigen in Johannas Keller hinab. Es ist der größte im Dorf, die Menschen wollen beieinander sein.
Jetzt hört Johanna die Flieger. Sie sieht ihr Baby in den Händen der Hebamme liegen. Zwischen ihren Beinen spürt sie die Nabelschnur.
»Ein Bub, Johanna, es ist ein Bub!«
Die Hebamme hilft Johanna auf und vom Tisch herunter. Sie lenkt sie sanft, aber bestimmt zum Keller. Der Saum ihres Arbeitskleides klatscht Flecken von Blut und Schmiere auf Johannas Oberschenkel. Durch das Fenster im Gang erhascht sie einen Blick in den Garten. Unter dem Marillenbaum hat sie die Nachgeburten ihrer anderen Kinder vergraben. Der Baum ist kahl, er hat schon vor Monaten seine Blätter verloren. Johanna schaut in die Küche zurück. Die Nachgeburt dieses Babys liegt unter dem Tisch.
Im Keller ist es dunkel. Rund um Johannas Körper drängen sich andere Körper. Der Geruch von gelagerten Erdäpfeln, Zwiebeln und Schweiß steigt aus dem Lehmboden auf. Nervöses Quietschen ist von irgendwoher zu hören. Die Ratten hätte man schon vorher rausbringen und ersäufen sollen, denkt Johanna. Resi, ihre Nachbarin, drückt ihre Knie in Johannas Rücken. Johanna ruht ihren Kopf auf der Schulter ihrer Tochter Frieda aus. Inge, die Jüngere, sitzt auf Friedas Schoß. Die eingelegten Birnen schweben braun in den großen Einmachgläsern. Es ist nicht der erste Bombenalarm und nicht der letzte. Johannas Angst ist immer die gleiche.
Kurz bevor die Kellertür geschlossen wird, durchfährt es Johanna heiß. Sie springt auf und ruft: »Das Kind, wo ist mein Kind?« Sie hat ihr Neugeborenes oben in der Küche vergessen.
Sofia wiegt das in Tücher gewickelte Baby in ihren Armen. Sie sitzt aufrecht im Krankenhausbett und spürt eine Wärme auf ihren Wangen. Sie summt ihrer Tochter ein Lied ins Ohr, während sie aus dem Fenster auf die Churfirsten schaut. Der Chäserugg hat schon eine weiße Kappe.
Sofia hört in ihren Körper hinein, ganz vorsichtig versucht sie zu spüren, wie sich ihr Unterleib anfühlt. Sie ist erleichtert, das schreckliche Brennen ist wirklich ganz weg.
Emil war dem Medikament gegenüber skeptisch. Es sei ein ganz neues, hat der Doktor es angepriesen, Sofia könne sich glücklich schätzen, dieses Medikament zu bekommen. Sie war bereit, alles zu tun, was gegen die Blasenentzündung nach der Geburt hilft. Sofia ist dem Doktor dankbar.
»Mischlingskinder sind eben die schönsten«, hatte er ihr kurz nach der Geburt gesagt, als er das Neugeborene mit den vielen schwarzen Haaren in den Händen einer Krankenschwester sah.
Das Penicillin wirkte sogar noch schneller, als Sofia erwartet hatte.
»Kommst du heute heim?«, begrüßt Emil seine Frau.
Er setzt sich auf den Stuhl neben ihrem Bett und betrachtet sie und sein Baby. Sofia erfindet jeden Tag eine kleine Ausrede. Die Schwestern zwinkern ihr zu, wenn sie ihr das Essen auf dem Tablett servieren, das Baby holen und es trocken zurückbringen. Sofia schläft hier die ganze Nacht durch. Kein einziges Mal muss sie ihre Tochter selbst wickeln. Zu Hause kümmert sich ihre Mutter währenddessen um den Haushalt. Emil muss so lange auf der Couch schlafen.
»Was ich auch in die Finger nehme, nimmt sie mir gleich wieder weg und macht es selbst«, klagt Emil. »Nicht für Mann«, äfft er seine Schwiegermutter nach.
»Du übertreibst, Emil. Meine Mutter spricht ganz passabel Deutsch!«
»Und sie putzt noch mehr als du und ich muss die Schuhe vor der Wohnungstür ausziehen.«
Sofia legt das Baby in Emils Arme. Er schaukelt es sanft. Die Falten auf seiner Stirn glätten sich. Er spitzt seine Lippen und murmelt ihm einzelne Silben zu.
»Noch ein paar Tage und unsere Große spricht kein Deutsch mehr, wenn du heimkommst«, zischt er über den Kopf des Babys Sofia zu. Dann schaut er wieder lächelnd auf das Bündel in seinen Armen.
Er dreht eine Runde durch das Zimmer und lässt sich von den anderen Frauen in den Betten die Schönheit seiner Tochter bestätigen. Dann trägt er sie zum Fenster und benennt ihr alle Gipfel der Churfirsten.
Sofia schaut ihm mit halb geschlossenen Lidern zu. Emil setzt sich zu ihr auf die Bettkante, sie steckt ihre Arme unter die Decke. Emil drückt seine Tochter ein bisschen fester an seine Brust. Er lächelt sie an, streicht ihr mit einem Finger über die Stirn.
»Wie geht es dir?«
Sofia verzieht ihren Mund.
»Noch nicht so gut. Heute Nachmittag kommt der Doktor. Es tut noch immer weh, da unten. Du weißt schon –.« Sofia deutet mit ihrem Kinn irgendwo auf ihren Körper unter der dicken Krankenhausdecke. Emil schaut schnell weg.
»Was hältst du von Ursula?«, fragt er, den Blick wieder auf seine Tochter gerichtet.
Sofia schüttelt heftig den Kopf.
»Nein, nein. Ich weiß schon einen Namen!« Sofia strahlt. »Es ist nicht irgendein Name, Emil, es ist der richtige Name für unser Mädchen.« Emil schaut Sofia erwartungsvoll an.
»Flora!«, ruft Sofia, dass es alle im Zimmer hören können. Eine Frau hinter einem Vorhang kichert.
»Wie das Waschmittel? Vermisst du deine Waschküche schon so sehr, Sofia?«, ruft eine andere. Emil wird rot. Er legt Sofia das Baby auf den Bauch.
»Um Himmels willen. Was ist das denn für ein Name? Flora? Auf keinen Fall!«
»Ich habe letzte Nacht davon geträumt. Ich weiß nicht mehr genau, was. Aber der Name war einfach da, das ist kein Zufall.«
Emil dreht sich zum Fenster. Sofia schaut sehnsüchtig zur Tür, ob nicht bald eine der Schwestern kommt. Sie rutscht etwas tiefer in ihre Kissen. Ihr ist heiß und kalt am ganzen Körper. Kopfschüttelnd steht Emil auf. Dann blickt er Sofia in die Augen.
»Heulst du jetzt etwa deswegen?« Er flüstert, schüttelt den Kopf noch immer. Er fährt sich mit der Hand über die Augen und die Stirn, atmet laut ein und wieder aus.
Sofia denkt nach. Sie streicht ihrem Baby über das Köpfchen. Es hat schwarzes Haar und dunkle Augen, wie seine Schwester. Eine schlanke, aber etwas zu lange Nase. Die gleiche Nase wie ihr eigener Vater. Das Baby schmatzt leise.
»Rosa. Unsere Tochter soll Rosa heißen«, beschließt Sofia und küsst Rosa sanft auf die Stirn.
Ich bin dreißig und sitze am Esstisch im Haus meiner Eltern. Ich höre meine Mutter in der Küche hantieren. Schüsseln scheppern und Messer und Gabeln klackern, aus dem Radio dringt eine Männerstimme, dann Musik und dann der Wetterbericht. Nieselregen und Nebel. Ich fühle das Holz der Tischplatte unter meinen Händen und höre die Muttergeräusche. Ich will mit meiner Mutter sprechen, kaue an meinen Fingernägeln, warte auf das Ende des Schepperns und Klackerns, auf das Ende von Nieselregen und Nebel. Früher habe ich oft versucht, Abstand zwischen uns zu bringen. Ich gierte nach Luft zum Atmen.
Mein Vater ist ein höchst sentimentaler Mensch. Ich kenne niemanden mit einem weicheren Herzen. Er weint lautlos bei Dokumentarfilmen. Er gibt jedem Bettler etwas. Er hängt an Gegenständen aus seiner Vergangenheit. Unseren Esstisch hat er bei allen Umzügen in Luftpolsterfolie verpackt. Er schleift ihn regelmäßig ab, ölt ihn ein und bittet uns, Gläser nie ohne Untersetzer daraufzustellen. Er lässt uns sonst aber wirklich fast alles durchgehen. Wir waren keine folgsamen Kinder.
Ich fahre mit dem Zeigfinger den Wasserringen auf dem Holz nach. Es gibt immer eine Überschneidung, ich muss nie den Finger vom Holz heben und ihn zum nächsten Ring fliegen lassen. Meine Nägel sind abgekaut, aus mehreren Stellen sickern Tröpfchen von Blut, das sich in den Ritzen der offen liegenden Nagelbetten und rundherum sammelt und dunkel wird. Das Pochen und das Kreisen mit den Fingern lenken mich von den Wörtern ab, die in meinem Kopf zurechtgelegt warten.
Meine Mutter runzelt die Stirn, als sie aus der Küche um die Ecke biegt und meine malträtierten Finger über das Holz streichen sieht. Ich weiß, dass sie schon am Telefon ahnte, dass etwas mit mir los ist. Früher störte mich das, vor meiner Mutter so durchsichtig zu sein. Ich sitze am alten Holztisch, ziehe Wasserglaskreise mit pochenden Fingern, während aus der Küche das Wetter aus dem Radio schallt. Dann setzt sie sich neben mich.
Johanna packt das Baby in eine zusätzliche Decke. Es hat die Augen geschlossen und schläft. Arno ist ein braves Kind. Er öffnet die Augen nur, um nach Milch zu verlangen.
Auch ohne Franz schafft es Johanna, alles am Laufen zu halten, im Haus, im Stall und im Wirtshaus. Ihre Eltern helfen ihr so oft und gut sie können. Der Magd und dem Knecht hat sie heute freigegeben. Johanna hat die Säue im Morgengrauen gefüttert, die Eier im Hühnerstall eingesammelt.
Sie legt das Baby vor sich auf die Anrichte und blickt in den Spiegel. Sie zieht sich das Kopftuch zurecht, schiebt mit der flachen Hand ein paar widerspenstige Härchen unter den Stoff. Ohne den Blick von ihrem Spiegelbild zu lösen, ruft sie nach Frieda und Inge. Im oberen Stock poltert etwas. Die zwei Mädchen hüpfen die Treppe runter und rennen in den Hof.
»Inge, du bleibst hier!«, ruft ihnen Johanna nach.
Sie nickt sich im Spiegel zu, presst ihre Lippen zu einem dünnen Strich zusammen und nimmt das Baby hoch. Frieda wartet mit Inge an der Hand im Hof, löst den Griff der kleinen Schwester und nimmt ihrer Mutter das Baby ab. Johanna bückt sich zu Inge.
»Wir sind heute Abend zurück. Du bleibst bei Omama und Opapa heute. Sei schön artig.«
Inge nickt tapfer und trottet ins Haus zurück. Johannas Eltern kümmern sich heute um die Jüngste und das Nötigste auf dem Hof.
Johanna geht zum Schuppen. Frieda wartet mit Arno auf dem Arm, während Johanna das Rad herausholt. Es ist schwer und der Schuppen klein. Johanna ächzt. Friedas Rad steht schon draußen, an die Hausmauer gelehnt. Die Tochter legt das weich eingepackte Baby in den Korb am Lenker von Johannas Rad. Diese Transportvorrichtung hat Johannas Vater gebastelt. Frieda hält das Rad, damit ihre Mutter leichter aufsteigen kann. Sie selbst sitzt flink auf und fährt voraus.
Einige Dörfer weiter machen sie eine kurze Pause zum Verschnaufen und trinken etwas Wasser aus einem Brunnen. Sie seien schon über die Hälfte der Strecke gefahren, erklärt Johanna ihrer Tochter. Es fehle nicht mehr ganz eine Stunde.
Sie betrachtet ihre Älteste stolz. Kein einziges Mal hat sie gejammert auf dem Weg. Johanna weiß, dass ihr die Schuhe zu klein geworden sind die letzten Monate und drücken, sie hat die Blasen an Friedas Zehen gesehen. Auch dass das Rad ihr eigentlich noch ein wenig zu groß ist und sie deshalb oft im Stehen in die Pedale tritt, bis ihre Oberschenkel brennen.
»Dein Vater wird sich freuen!« Johanna zwinkert ihrer Tochter zu.
»Meinst du, mit Inge geht alles gut daheim?«, fragt Frieda.
»Bestimmt.« Die Mutter schnalzt mit der Zunge. »Die Großeltern kümmern sich um sie. Ein Tag dauert nicht sehr lange.«
»Und Arno, geht es ihm auch gut da drin?«
Die beiden schauen in den Korb am Fahrrad. Der Junge ist die ganze Zeit wach und hat einige Male geweint. Jetzt schaut er erwartungsvoll und als Johanna ihm einen Finger in den Mund steckt, lächelt er.
»Findest du es nicht wichtig, deinen Vater zu besuchen? Sei froh, dass er sich vor den Russen verstecken konnte und bei den Briten gelandet ist. Erinnerst dich wohl gar nicht mehr an ihn.«
Johanna sieht, wie Frieda die Stirn runzelt und zu Boden schaut. Sie fahren schnell weiter. Johanna spürt ein schmerzhaftes Pochen in ihren Beinen und im Rücken von den Schlägen, die das Radeln über die unbefestigten Straßen durch ihren Körper schickt. Beim Gedanken an Franz verfliegen ihre Schmerzen.
Als sie ankommen, nimmt Johanna das Baby aus dem Korb und richtet Frieda mit einer Hand das Kleid und die Zöpfe. Frieda schiebt sich das Ende eines Zopfes in den Mund und kaut daran. Die Mutter klapst ihr auf die Finger und marschiert mit dem Kind auf dem Arm voraus.
Der Weg auf den Hügel ist steil. Frieda überholt Johanna bald. Nach ein paar Minuten schwitzt die Mutter und holt Frieda erst oben ein. Sie streckt schon ihre Arme aus und schwenkt sie so in der Luft, wie Johanna es ihr gestern gezeigt hat. Johanna stellt sich hinter ihre Tochter. Unten, am Fuß des Hügels, liegt das Gefangenenlager. In der Ferne sieht sie die Gebirgskette. Es liegt Schnee auf den Gipfeln. Sie fröstelt und drückt ihr Baby fest an sich.
»Wo ist Vati?« Frieda wird ungeduldig. Mit den Augen sucht die Mutter den Lagerhof nach Franz ab. Sie hat sie angekündigt, hat ihm letzte Woche geschrieben, dass sie heute mit den beiden Kindern herkommt. Er hat seinen Jüngsten noch nie gesehen.
»Wo ist Vati? Ist er da unten, Mutti, ich seh ihn nicht!«
Johanna wird nervös. Da erblickt sie ihren Mann. Sie weiß sofort, dass er es ist. Er sieht aus wie die anderen Männer. Sie erkennt ihn daran, dass er angestrengt zum Hügel hochblickt. Und daran, weil es ihr Franz ist. Sie reckt das Kinn. Dann hebt sie den freien Arm und winkt.
»Wo ist Vati, da ist Vati, ich seh Vati!«, ruft Frieda aufgeregt.
Johanna sieht die hagere Gestalt ihres Mannes das erste Mal seit Monaten. Er steht im Hof des Lagers, zwischen anderen Häftlingen. Langsam hebt er eine Hand, schirmt damit seine Augen gegen das Licht ab. Er hebt nun auch die andere Hand auf Schulterhöhe, bewegt sie hin und her. Johanna hält das Baby hoch, hält den kleinen Arno in die Luft, über ihren Kopf. »Dein kleiner Bub!«, ruft sie. Sie weiß, dass Franz sie nicht hören kann.
»Es ist ein Bub, er ist brav!« Jetzt schreit sie.
»Er trinkt viel. Er wächst schnell. Arno, er heißt Arno!« Die Stimme versagt ihr.
»Komm bald heim«, flüstert sie, als sie das Baby wieder an ihren Körper presst.
Sie stehen lange auf dem Hügel und winken nach unten. Franz lässt nach einiger Zeit seine winkende Hand kraftlos fallen, steht einfach da.
»Warum ist Vati im Gefängnis?«, fragt Frieda.
»Weil er im Krieg war.«
»Aber du hast gesagt, der Krieg ist aus. Warum ist Vati noch im Gefängnis?«
»Weil er bei den Falschen war.«
Auf der Rückfahrt machen sie keine Pause. Es ist schon dunkel, als sie auf dem Hof ankommen.
Morgens liegt Sofia wach im Bett und lauscht. Die Wohnungstür wird geöffnet und wieder geschlossen. Es ist noch dunkel draußen, ihr Vater hat diese Woche Frühschicht in der Fabrik. Kurz darauf hört sie die Tür ein zweites Mal aufgehen und sich schließen. Ihre Mutter verlässt das Haus immer erst, nachdem sie das Frühstücksgeschirr des Vaters aufgeräumt und die Küche blitzblank geputzt hat. Immer muss alles glänzen und strahlen in der Wohnung.
Sofia tastet ihren Körper unter der Decke ab. Sie hebt ihr Pyjamaoberteil und schiebt die Hände über ihren Bauch. Bis zur Hochzeit soll er noch so flach wie möglich bleiben. Es wäre sehr peinlich, wenn ihre Eltern etwas merken würden. Oder sonst jemand. Die warmen Hände auf dem Bauch dämpfen das Knurren ein wenig. Sie wird gleich in die Küche gehen, nimmt sie sich vor. Dort wird sie den Zettel ihrer Mutter lesen, darauf stehen genaue Instruktionen und Erklärungen zu Sofias heutigen Pflichten der Haus- und Handarbeiten.
Sofia wälzt sich. Sie dreht sich auf den Bauch und steckt ihren Kopf zwischen zwei Kissen. Das Geräusch der sich schließenden Wohnungstür hallt in ihrem Kopf nach. Kurz fühlt sie sich wieder wie das Kind, das sie war, dem ein erneuter Tag allein in der lautlosen Wohnung bevorsteht. Das Kind, das unter dem Bett spielt und dabei keinen Ton von sich gibt. Sofias ganzer Körper fühlt sich taub an bei der Erinnerung.
Sie wackelt mit den Zehenspitzen, spürt Wärme ihre Waden hinauf in ihren Oberkörper gleiten und zieht den Kopf zwischen den Kissen hervor. Sie schüttelt die Taubheit an Armen und Beinen ab und dreht am Radio auf ihrem Nachttisch, dreht es sehr laut auf. Das Rauschen in ihren Ohren verschwindet. Seit ein paar Monaten gibt es diesen Gedanken, der ihren ganzen Körper mit Kribbeln erfüllt.
Nach der Hochzeit wird sie zu Emil ziehen. Sofia schleicht zum Schrank, wie jeden Morgen seit einer Woche. Sie berührt den weißen Tüll, darunter die weiße Seide und darunter die weiße Baumwolle. Sie streichelt die weißen Plastikknöpfe. Sie wiegt ihren Körper zur lauten Musik aus dem Radio. Das wird der schönste Tag ihres Lebens. Ihr Bauch ist unterhalb des Nabels erst ein kleines bisschen gewölbt. Sofia zieht den Bauch ein und hält die Luft an. Mit dem Kleid in den Armen dreht sie sich zur Musik immer wieder um die eigene Achse. Abrupt hält sie inne. Ihre Mutter steht im Zimmer.
»Figlia mia! Was machst du hier für einen Zirkus? Hast du keinen Anstand!«, schleudert ihr die Mutter auf Italienisch entgegen.
»Du bist doch auf der Arbeit?«, stottert Sofia.
Die Mutter reißt das Hochzeitskleid aus Sofias Händen. Grob wirft sie es aufs Bett.
»Benimm dich wie eine Frau, Sofia! Bist ja schon eine.«
Der Blick, den ihr ihre Mutter zuwirft, lässt Sofia erschrecken.
Sie folgt ihr in die Küche.
»Was ist los, Mama, warum bist du nicht in der Fabrik?«
Die Mutter wendet sich ihr zu. Jetzt erst sieht Sofia ihre roten Augen. Die Mutter lässt sich auf den Küchenhocker plumpsen, kramt ein zerknülltes Taschentuch aus ihrem Ärmel. Tränen rinnen ihr über die Wangen.
»Ist etwas passiert? Wo ist Papa?«
Die Mutter schnieft und schüttelt den Kopf.
»Es ist Federico!«, ruft die Mutter und schluchzt.
»Federico wer? Wer ist das?«
»Dein Cousin natürlich. Er war im Krieg. Er ist tot, Sofia, einfach tot! Wir müssen trauern!«
Sofia fällt das Foto ein, das im Wohnzimmer zwischen den vielen Familienbildern aus Italien steht. Kann sein, dass der junge Mann in der Militäruniform Federico ist. Sofia holt das Bild. Ihre Mutter nickt und weint weiter.
Sofia geht in ihr Zimmer zurück. Sorgfältig hängt sie das weiße Kleid wieder über den Kleiderbügel und hakt ihn vorne am Kleiderschrank ein. Sie streicht noch einmal über alle Lagen der Stoffe. Aus der Küche hört sie ihre Mutter schluchzen.
Der Tüll knistert zwischen ihren Fingern und die Seide fühlt sich so weich an. Sofia zieht sich bis auf die Unterwäsche aus und schlüpft in das Hochzeitskleid. Sie platziert ihren kleinen Spiegel auf dem Bett, sodass sie möglichst viel von ihrem Körper darin sehen kann. Sie dreht sich vor dem Spiegel und freut sich über die Bewegungen und Geräusche, die der Stoff dabei macht.
»Was soll das! Sofia!« Ihre Mutter steht wieder in der Tür. Sie hat sich umgezogen und trägt einen schwarzen Jupe und eine schwarze Bluse.
»Sollen die Leute denken, du hast keinen Anstand?«
Die Mutter reißt Sofia barsch an der Schulter herum und öffnet den Reißverschluss des Kleides am Rücken.
»Ausziehen!«
»Aber Mama, ich hab doch nur geschaut.«
»Nichts da!«
Die Mutter holt eine Tasche aus der Küche und stopft das weiße Kleid hinein. Sofia entfährt ein kleiner Schrei.
»Tradition ist Tradition!«
Zwei Wochen später tritt Sofia in Schwarz vor Gott, um sich von Emil zur Frau nehmen zu lassen. Die Tränen laufen ihr lautlos über das Gesicht. Sie trägt einen schwarzen Jupe und einen schwarzen Blazer. Sogar ihre Bluse darunter musste schwarz sein. Emil runzelt die Stirn, als ihm der Vater der Braut die weinende Tochter anvertraut. Sofia glaubt, die ganze Kirchgemeinde aufatmen zu hören, als Emil bezeugt, sie zur Frau zu nehmen.
Rosa betrachtet sich zufrieden im Spiegel. Seit dem frühen Nachmittag sitzt sie mit ihrer Schwester im Badezimmer. Maria hat das Küchenradio der Mutter ins Bad geholt. Es läuft schon wieder ein Lied der Beatles.
»Los gehts!« Maria schaut auf die Uhr und dreht das Radio ab. »Worauf wartest du, die anderen sind bestimmt schon alle auf dem Maitanz.« Maria schaut Rosa erwartungsvoll an.
Rosa geht das erste Mal mit. Maria hat ihr Locken gedreht und falsche Wimpern aufgeklebt.
»Alle Mädchen putzen sich heraus für den Maitanz, Rosa«, hat Maria sie erinnert, als sie sie versehentlich mit dem Lockenstab am Ohrläppchen verbrannt hat. Rosa sitzt auf dem Wannenrand und schaut zu ihrer großen Schwester vor dem Spiegel auf. Maria raucht schon und Campari Orange ist ihr Lieblingsgetränk. Sie hat eine kleine Flasche Weißwein ins Bad geschmuggelt und Rosa trinkt ihren zweiten Schluck davon. Sie verzieht das Gesicht. Maria lacht sie aus.
Rosas dunkles Haar türmt sich auf ihrem Hinterkopf zu einem Berg Locken auf. Seitlich an ihrem Gesicht hängt jeweils eine Locke. Maria hat mit unzähligen Haarklammern auf ihrem Kopf hantiert. Sie stechen Rosa in die Kopfhaut.
»Stell dich nicht so an, das muss so sein!«
Maria muss es wissen, sie macht schließlich eine Lehre zur Coiffeuse. Sie lernt dabei auch Nägel lackieren und Augenbrauen zupfen und sie kann perfekt Lidschatten auftragen.
Rosa steht auf, lächelt ihr Spiegelbild an, rotiert den Kopf nach links und rechts, lässt sich nicht aus den Augen. Maria hockt sich auf den Klodeckel und kneift ihr in den Hintern.
»Da ist ja kein Fleisch dran. Aber den Preis um den hübschesten Kopf würdest du heute wohl gewinnen«, sagt sie lachend und schüttelt ihre blondierten Haare, die sie stundenlang mit dem Glätteisen bearbeitet hat. Sie steht auf, wirft die brennende Zigarette in die Schüssel und spült. Sie bietet Rosa eine Zigarette an. Rosa presst die Lippen zusammen. Sie streicht über den hellroten Minirock, den ihr Maria ausgeliehen hat. Maria hat davor Rosas Kleiderschrank durchwühlt und laut geseufzt. Als Maria augenzwinkernd den Minirock aus ihrem eigenen Schrank gezogen und gesagt hat, dass ihr Freund den am liebsten an ihr sieht, ist sie rot geworden. Mit dem Gürtel sieht man kaum, dass das Kleidungsstück Rosa zu groß ist.
»Ich sollte noch kurz den ausgerissenen Saum hier flicken.« Rosa dreht sich zur Tür, Maria hält sie am Arm fest.
»Sieht wirklich keiner, lass, der ist schon lange kaputt.«
Rosa runzelt die Stirn. Sie oder ihre Mutter hätten das in wenigen Minuten erledigt.
»Du wirst so viel Spaß haben heute. Ich werde dich vor den Verehrern beschützen müssen!«, sagt Maria.
Rosa schaut sich noch einmal im Spiegel an. Sie senkt ihren Blick, als sie Hitze in ihren Wangen aufsteigen spürt.
Sie gehen in Marias Schlafzimmer und suchen sich jeweils ein Paar passende Schuhe aus. Schwarze Pumps mit einer applizierten Blume für Rosa. Maria entscheidet sich für die beigen Stiefeletten. Rosas Finger kribbeln, sie ist nervös, freut sich aufs Tanzen und auf alle Versprechen, die ihr Maria für den heutigen Abend gemacht hat. Verehrt, angeflirtet, eingeladen zu werden, zu tanzen und zu lachen, bis sie todmüde sind. Hoffentlich hat die große Schwester mit der Hälfte ihrer Versprechen recht, dann wird es schon ein toller Abend, denkt sie sich.
Die Schwestern nehmen ihre Handtaschen und Jäckchen. Als sie an der Küche vorbeikommen, winkt Rosa ihrer Mutter zu. Die Mutter steht mit einem Messer in der Hand zwischen Lavabo und Esstisch. Sie legt es ab und geht ein paar Schritte auf ihre Töchter zu.
»So wunderschöne Töchter habe ich. Jetzt sind sie beide erwachsen. Unglaublich«, sagt Sofia und tätschelt Rosas Schulter.
Rosa küsst ihre Mutter auf die Wange.
»Du gehst also wirklich mit, Rosa?«
»Mama, keine Sorge, ich bin früh zurück.«
Maria steht schon in der Tür, mit einem Fuß draußen, mit dem anderen wippt sie ungeduldig. Rosa schaut zwischen ihrer Mutter und ihrer Schwester hin und her. Sofia geht ins Wohnzimmer, lässt sich auf die Couch sinken.
»Geht, Mädchen, geht euch amüsieren!«, ruft sie und wedelt ihre Töchter mit der Hand weg.
Rosa und Maria verlassen die Wohnung. Auf dem zweiten Treppenabsatz kehrt Rosa um. Das Parfüm hat sie sich bis zuletzt aufgespart, jetzt hat sie es vergessen.
Sie geht zurück in die Wohnung. Die Mutter sitzt noch immer auf der Couch und starrt in die Luft. Als sie die Tür hört, dreht sie sich um und ihr Gesicht erhellt sich beim Anblick ihrer jüngsten Tochter. Rosa sieht ihre wässrigen Augen und die Falten darum herum.
»Mama?«
»Geh nur, Rosa, geh zum Maitanz!« Ihre Mutter schnieft.
Rosa setzt sich zu ihr auf die Couch. Sie streicht ihr über die Wange und lächelt sie an. Dann nimmt Rosa die Fernbedienung vom Couchtisch, lehnt sich zurück, streift ihre Pumps ab und stellt das Samstagabendprogramm ein.
Ich wache auf und bleibe bewegungslos liegen. Ich höre den Geräuschen zu, die meine Eltern im unteren Stock in der Küche und im Wohnzimmer machen. In ein paar Tagen werde ich neunzehn. Es wird mein erster Geburtstag ohne Nonna sein. »Rosa, wir müssen bald los«, höre ich meinen Vater rufen.
Ich sehe das schwarze Kleid. Meine Mutter hat es gestern gebügelt und an die Schranktür gehängt. Sie hat mir auch schwarze Strumpfhosen dazugelegt. Es mache nichts, dass ich keine schwarze Jacke habe, hat sie gesagt. So genau werde es niemand nehmen.
Ich schließe die Augen und lasse zu, dass meine Gedanken zu Nonna wandern. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war sie schnell müde. Wir haben nur kurz Karten gespielt. Ich habe ihr einen neuen Nagellack mitgebracht, den wollte sie sofort ausprobieren. Wahrscheinlich hatte sie ihn noch auf den Fingernägeln, als sie gestorben ist. Meine Mutter war in dem Moment bei ihr.
Jetzt ruft sie nach mir. Ich gehe im Schlafanzug nach unten. Sie sitzt am Küchentisch, ich setze mich neben sie. Sie schiebt mir einen Teller und ein Messer hin, zeigt auf das Brot auf dem Tisch.
»Butter und Käse sind im Kühlschrank. Soll ich dir etwas holen?«
Ich schüttle den Kopf.
»Anna wartet schon draußen. Gleich fahren wir gemeinsam zum Friedhof. Maria treffen wir dann dort.«
Ich schaue zum Fenster raus, sehe meine Schwester neben ihrem Auto stehen und auf ihrem Handy tippen. Sie trägt signalroten Lippenstift.
Meine Mutter räumt das Geschirr in die Spülmaschine. Es ist alles viel zu geschäftig, viel zu laut. Ich lege die Hände über meine Ohren und stütze die Ellenbogen auf die Tischplatte. Meine Mutter streicht mir über den Kopf.
»Das gehört dazu.«
Sie legt mir ein Stück Brot auf den Teller. Ich löse meine Hände von den Ohren und bohre einen Finger in das Innere des Brotstücks. Ich löse das Weiche heraus und stecke es mir in den Mund.
»Hat Nonna noch den hellroten Nagellack drauf?«
Ich erhalte keine Antwort. Hinter mir geht der Küchenlärm weiter. Ich drehe mich um, fasse meine Mutter am Arm.
»Hat sie noch den hellroten Nagellack drauf?«
Sie schaut mich verwundert an.
»Ich weiß nicht. Darum kümmern sich die Leute vom Bestattungsinstitut.«
»Den hatte ich ihr mitgebracht.« Ich bohre wieder im Brot.
Meine Mutter lässt das Geschirrtuch sinken. Sie hängt es über den Rand der Spüle, seufzt. Dann setzt sie sich mir gegenüber, schaut mich an und beginnt zu weinen. Ich lege meine Hand auf die Tischplatte. Sie legt ihre Hand auf meine und ich drücke fest zu. Sie hört auf zu weinen, erwidert meinen Händedruck und lächelt.
»Weißt du, ich glaube, ich habe mich erst jetzt von meiner Mutter abgenabelt.«
Rosa kratzt gedankenverloren die Kruste von einem schon mal aufgekratzten Mückenstich an ihrer Wade ab. Es beginnt zu bluten, sie steckt sich den Finger in den Mund, saugt ihn sauber. Sie drückt den Finger auf die kleine Wunde, lehnt sich zurück. Sie sitzt in einer längs halbierten Badewanne im Garten der Eltern. Ihr Vater fand es originell, die alte Wanne rauszustellen und als Sitzgelegenheit umzufunktionieren. Ihre Mutter hat selbst genähte Kissen reingelegt und ist mit dem Vater lachend Probe gesessen.
Der Garten gehört zu dem Haus, in dem Rosa mit ihren Eltern und ihrer Schwester eine Wohnung bewohnt, in den beiden anderen Wohnungen leben ihre Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen.





























