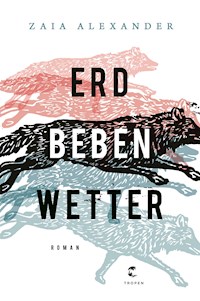
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Zaia Alexander erzählt ebenso mitreißend wie reflektiert von der Begegnung mit Menschen, deren Worte so ins Zentrum der eigenen Existenz treffen, als hätte man ein Leben lang darauf gewartet.« Denis Scheck Kojoten ziehen hungrig durch die Wohnviertel, in den Nachrichten warnen sie vor Schießereien und blinder Verkehrswut. Mit der Hitze kommt eine unheimliche Stille. Erdbebenwetter. Das Leben in L.A. gleicht in diesem Roman nicht dem Hollywood, das uns die großen Studios in ihren Filmen vorgaukeln. Und auch Lous Alltag ist nicht aus dem Stoff der Traumfabrik. Ihr Leben scheint in einer Endlosschleife hängengeblieben zu sein, als sie bei einer Filmpremiere einen alten Freund wiedertrifft, der mittlerweile ein erfolgreicher Regisseur ist. Er nimmt sie mit zu einem Kurs in einem Tanzstudio in Santa Monica und führt sie in die Welt der Hexer ein. Damit gewinnt ihr Leben eine elektrisierende Intensität. Das allzu Bekannte wird außergewöhnlich, der Alltag rückt in ein neues Licht. Lou erkennt, dass es Ausfahrten und Schlupflöcher im vermeintlich festgelegten Koordinatensystem des Lebens gibt. Ein poetischer, kraftvoller, kosmopolitischer Roman, der Grenzen überschreitet, Hierarchien zwischen Tier und Mensch und Kindern und Eltern ins Wanken bringt und L.A. als jenes flirrende Geheimnis in der Wüste zeigt, das die Stadt bis heute ist. »Als ich am nächsten Morgen durch den windigen Canyon fuhr, stand vor mir auf der Straße ein Kojote. Ich hatte den starken Impuls, Gas zu geben. Kurz vor ihm bremste ich ab und brachte das Auto zum Stehen. Wir starrten uns durch die Windschutzscheibe an. Reglos und lange, wie es schien. Dann machte er kehrt und rannte ins verdorrte Gebüsch.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zaia Alexander
Erdbebenwetter
Roman
Tropen
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Tropen
www.tropen.de
© 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
unter Verwendung einer Illustration von © FinePic®, München
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50459-0
E-Book: ISBN 978-3-608-12007-3
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Für Antje
Tu so, als ob du weinst, weil Dichter nur so tun, als ob sie sterben.
Jean Cocteau
Erster Teil
Der Morgen, an dem die Kojoten in die Stadt kamen
Als ich erwachte, war sie nicht da.
Der dicke Nebel der letzten drei Tage war zu einem diesigen Schleier verdunstet. Es war später Morgen.
Gewöhnlich kam sie nachts durch das Gartenfenster herein. Ich hatte draußen einen kleinen Holztisch unter das Fenster gestellt, damit sie hochspringen und zwischen den schmiedeeisernen Gitterstäben hindurchschlüpfen konnte. Das vertraute Geräusch ihrer Pfoten und das Klappern der Tischbeine auf dem Terrakottaboden, ihr wunderbar runder Kopf, der in mein Zimmer spähte, ihr samtiges graues Fell, das blau schimmerte. Sie weckte mich immer zu früh, im ersten Morgengrauen, aber ich hatte mich daran gewöhnt. Als ich jetzt die Augen öffnete, wusste ich instinktiv Bescheid. Nicht zum ersten Mal war sie nicht da, wenn ich erwachte, aber an diesem Morgen füllte ihre Abwesenheit mein mönchisches Zimmer ganz aus.
Ihr Sohn lag friedlich neben mir. Vielleicht hatte er sie nachts draußen nicht gesehen. Oder er hatte sie gesehen, aber nicht ganz begriffen, was mit ihr los war. Vielleicht hatte er, was auch immer ihr passiert sein mochte, für etwas Natürliches gehalten, ein Element der städtischen Wildnis. In rasender Eile zog ich mich an. Ich musste sie befreien, aus welcher Falle auch immer. Ich lief über die Thayer Avenue in Richtung Norden und überquerte die Fahrbahn. Etwas Graues lag am Ende der Straße auf dem Rasen. Meinem ersten Impuls folgend, wollte ich das Geschehene ungeschehen machen, ihre Eingeweide zurück in den Kadaver schieben, sie im Arm halten, ihren Samtkopf küssen, aber die Nachbarin, die herauskam, weil der Schrei nicht endete, hielt mich zurück. Möglicherweise gab es Tollwut. Später sah ich Büschel grauen Fells, die sich von unserer Hauseinfahrt etwa fünfzig Meter die Straße hinunter bis zu der Stelle verteilten, an der sie gelegen hatte. Vielleicht waren die Kojoten geflüchtet, bevor sie ihre Mahlzeit beenden konnten. Fünfzig Meter maß die Strecke, die sie gebraucht hatten, um sie zu töten.
Ich weiß nicht mehr, wie ich zurück in mein Zimmer kam, zum Bett, ich wickelte mich in die Decke. Ihr Sohn kam und legte sich neben mich, so, wie er immer neben seiner Mutter gelegen hatte. Wir mussten stundenlang so dagelegen haben, die Schatten der Blautanne veränderten sich, das Licht wurde schwächer, bis irgendwann am späten Nachmittag meine Tochter aus der Schule kam. Und während dieser ganzen Zeit konnte ich an nichts anderes denken als daran, dass ich es ihr sagen musste. Ich musste ihr erzählen, was mit der Katze passiert war, die sie einmal gerettet hatte, mit dem Kätzchen, das auf ähnliche Weise zu ihr gekommen war wie meine Tochter vor zehn Jahren zu mir.
Aus dem Blauen heraus.
Nachdem die Kojoten die Katze geholt hatten, kam der Nebel zurück und blieb mehrere Tage. Es war, als würde er nie mehr verschwinden.
Am Abend zwang ich mich, aufzustehen, um an den Bäumen in der Thayer Avenue und der gesamten Nachbarschaft große Schilder aufzuhängen. Ich hatte den Text auf Pappen geschrieben, und meine Tochter malte wortlos die Buchstaben aus. Sie hatte aufgehört zu weinen. Als ich ihr erzählt hatte, was passiert war, schien sie es schon geahnt zu haben, als hätte sie längst verinnerlicht, dass dem natürlichen Lauf der Dinge wenig entgegenzusetzen war. Ich versuchte, sie zu trösten, und sagte ihr, die Nachbarin habe angeboten, sich um unsere Katze zu kümmern und eine schöne Urne für ihre Asche auszusuchen. Meine Tochter bestand darauf, ihrem Kätzchen seine Decke und das Körbchen zu bringen. Das Kätzchen war ihr Schützling, und sie würde es bis zum Ende begleiten.
Unsere Schilder sollten die Nachbarn vor den Kojoten warnen, sie daran erinnern, wachsam zu sein, ihre Tiere im Haus zu behalten, sie bei Sonnenuntergang hereinzuholen und nicht vor dem Morgengrauen wieder herauszulassen, wenn überhaupt.
Als alle Schilder aufgehängt waren, sah ich auf dem Rückweg zu unserem Haus eine halb geöffnete Büchse Katzenfutter unter einem Busch versteckt und große Stücke Weißbrot ringsum auf dem Rasen. Nicht weit von dort entfernt hatte unsere Katze gelegen. Der gezackte Deckel schien eilig aufgerissen worden zu sein.
Es sah aus wie ein Köder.
Als ich am nächsten Morgen durch den windigen Canyon fuhr, die Luft roch nach Salbei und Meer, stand vor mir auf der Straße ein Kojote. Ich hatte den starken Impuls, Gas zu geben. Ich hätte ihn mühelos überfahren können. Kurz vor ihm bremste ich ab und brachte das Auto zum Stehen. Wir starrten uns durch die Windschutzscheibe an. Reglos und lange, wie es schien. Dann machte er kehrt und rannte ins verdorrte Gebüsch.
Blau
Meine Tochter war dreizehn, als sie von der Elementaryschool nach Hause kam und mir erzählte, dass sie ein halb verhungertes Kätzchen in der Einfahrt vor unserem Haus gefunden hatte. Sie sagte, sie habe es in ihre Schultasche gesteckt und mit zur Schule genommen. Ihre Klassenlehrerin, die ehrenamtlich für eine Tierklinik arbeitete, habe ihr gesagt, das Kätzchen müsse untersucht und geimpft werden, und vorgeschlagen, sie beide in der Mittagspause zum Tierarzt zu fahren. Meine Tochter bettelte nicht darum, das Kätzchen behalten zu dürfen, als sie nach Hause kam. Sie gab mir einfach die Quittung, auf der die Adresse der Tierklinik stand, und sagte: »Wir müssen uns beeilen. Sonst schaffen wir es nicht, sie rechtzeitig abzuholen. Sie machen um fünf zu.«
Ich wusste nicht besonders viel über Tiere oder darüber, wie man sich um sie kümmerte. In meinem Leben hatten sie bisher keine Rolle gespielt. Im Übrigen wusste ich auch nicht besonders viel darüber, wie man sich um Kinder kümmerte. Das Mädchen, mit dem ich an der Thayer Avenue wohnte, hatte ich nicht zur Welt gebracht. Sie war eines Tages in meinem Leben aufgetaucht, und von diesem Tag an kümmerte ich mich um sie.
Vielleicht war es auch umgekehrt.
Schon in den ersten Tagen bewies meine Tochter, dass es ihr mit dem Versprechen ernst war, das sie, wie sie mir erzählte, ihrem »Schützling« gegeben hatte. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, die Katze noch einmal untersuchen zu lassen, weil sie immer noch krank aussah. Ich hätte nicht einmal den Unterschied zwischen krank und gesund bemerkt. Aber meine Tochter rief eine ambulante Tiermedizin an und bat darum, jemanden vorbeizuschicken, der sich die neue Hausbewohnerin anschaute. Hätte sie das nicht getan und die Tierpflegerin die Katze nicht an den Tropf gehängt, um sie zu rehydrieren, wäre das Tier gestorben.
Innerhalb von wenigen Tagen hatte das Kind seiner Katze zweimal das Leben gerettet.
Auf der Rückfahrt von der Tierklinik hatte ich meiner Tochter noch versichert, das Ganze würde nur vorübergehend sein. »Wir machen keine Gefangenen«, sagte ich im Auto. »Lass die Katze laufen, sie ist nicht einsam.« Das enge Verhältnis zwischen Menschen und ihren Tieren war mir immer absurd vorgekommen.
»Diese Katze ist mir zugelaufen, und das bedeutet, dass ich für sie die Verantwortung habe«, gab meine Tochter zur Antwort. »Ich muss mich um sie kümmern.«
Sie sagte öfter solche oder ähnliche Dinge, und das brachte mich dazu, sie eines Tages zu fragen, wer sie sei.
Ohne zu zögern, sagte sie: »Ich bin ein vierundachtzigjähriger Chinese.«
Usher
Einmal hatte mir eine Produktionsassistentin ein Handbuch mit dem Titel E. T.-Einmaleins gegeben, das angeblich von Aliens verfasst worden war. Sie sagte, das Buch habe ihr Leben verändert, nicht so sehr der Inhalt, sondern vielmehr das Versprechen am Ende des Buches: Wenn Sie E. T.-Einmaleins gelesen haben, wird sich Ihr Leben für immer verändern.
Damals war ich gerade aus Berlin zurückgekehrt. Ich war dorthin geflüchtet, nachdem man mich aus der Filmschule geworfen hatte, weil ich die Gebühren nicht bezahlen konnte. Obwohl ich kein Wort Deutsch verstand, war ich sicher gewesen, in Berlin problemlos Regisseurin werden zu können. Stattdessen war ich in schlechtbezahlten Gelegenheitsjobs gelandet, die nirgendwo hinführten, und schließlich nach Los Angeles zurückgekehrt in der Hoffnung, meine Erfahrungen in Europa würden mir helfen, im Filmgeschäft in Hollywood Fuß zu fassen.
Ich hatte nichts zu verlieren.
Nachdem ich E. T.-Einmaleins gelesen hatte, hatte ich einen eindrücklichen Traum. Ich war im Garten meiner Großeltern. Der Garten umgab ein Haus, das wie eine spanische Hazienda aussah. Als Kind war es mein Zufluchtsort gewesen. Obstbäume standen dort, Zitronen, Limetten, Grapefruits, Orangen, ein riesiger Avocadobaum, Pfirsichbäume, Aprikosen, es gab Rosmarin- und Lavendelbüsche, und die weißen Hauswände waren von leuchtend rosa Bougainvilleen bedeckt. Ein weißes Tor trennte den Garten vom glitzernden Meer. Durch das Tor kam ein lebensgroßer blauer Delphin, und als er bei mir war, verwandelte er sich in einen betagten, obdachlosen Mann, dessen linkes Augenlid schlaff herabhing. Der Obdachlose mit dem hängenden Lid sagte, ich müsse den Rest meines Lebens hier mit ihm verbringen.
Ich ging in dieser Zeit fast täglich ins Kino. Die Filmvorführung für geladene Gäste, die das Independent Film Project in West Hollywood veranstaltete, besuchte ich nicht aus reiner Liebe zur Kunst. Ich brauchte Kontakte. Ich hoffte, einen Produzenten zu finden, der meine Projekte finanzieren würde. Nach der kurzen Einführung zum Film drängte sich jemand in der Reihe hinter mir an den Sitzenden vorbei. Er trug einen eleganten dreireihigen Anzug, aber seine Hosen waren eine Nummer zu klein. Weiter hinten im Saal waren noch Stuhlreihen frei, dennoch setzte er sich direkt hinter mich. Während des ganzen Films spürte ich seinen Blick. Als das Licht wieder anging, klopfte er mir auf die Schulter, und im ersten Moment wollte ich so tun, als würde ich ihn nicht erkennen.
Wir kannten uns seit der Kindheit.
Er erzählte mir, dass er jetzt Regisseur sei und einen der Böse Tote-Filme für Sam Raimi gedreht und eine Zusage von Scorsese habe. Ich erzählte ihm von meiner Projektentwicklungsfirma in den Hollywood Studios und dass ich auf der Suche nach guten Drehbüchern sei. Ich sagte nicht, dass meine Firma nur eine einzige Mitarbeiterin hatte, nämlich mich, und dass sie wegen fehlender Projekte kurz vor der Pleite stand oder dass ich mit der Comedian, die neben mir saß, zusammenwohnte, deren Leben weitaus weniger komisch war als sie selbst auf der Bühne.
Irgendwie war ich in diesem gar nicht komischen Leben hängengeblieben.
Eine Woche später tauchte der Freund aus der Kindheit unerwartet wieder auf. Mit einer exotischen Blume und Pralinen aus dunkler Schokolade in einer Holzschachtel von Maison du Chocolat stand er vor der Tür meiner Firma auf dem Studiogelände. Beim Anblick der seltsamen Blume kam mir in den Sinn, wie er sich früher gekleidet hatte. Schon in der vierten Klasse hatte er jeden Tag schwarze Hosen und einen schwarzen Rollkragenpullover getragen, das hatte er bis zur Zehnten getan, als er die Highschool geschmissen und angefangen hatte, als Krankenpfleger in einer Notaufnahme in West Hollywood zu arbeiten. Manchmal hatte er mich mitten in der Nacht angerufen und mir die grausigsten Geschichten erzählt, und als ich ans College gewechselt war, war ich froh gewesen, dass ich ihm meine neue Nummer nicht gegeben hatte.
Wir saßen auf Regiestühlen vor meinem Büro. Der edel aussehende eingeschossige Flachbau war das einzige Gebäude auf dem gesamten Gelände, das nur aus einem Zimmer bestand. Es war gerade groß genug für den modernen Schreibtisch, den mir die Produktionsfirma nebenan geliehen hatte. Ursprünglich hatte der Tisch als Requisit gedient, und man hatte mir empfohlen, nicht dagegen zu stoßen, weil sonst das dünne Furnier reißen könnte. Er war nicht besonders praktikabel, sah aber beeindruckend aus. Vor den zwei Fenstern hingen Jalousien, die Wände rochen nach frischer weißer Farbe. Alles war makellos. Die Manuskripte und Bücher, die ich angesammelt hatte, befanden sich der Größe nach geordnet im eingebauten Bücherschrank an der hinteren Wand und füllten etwa die Hälfte eines Fachs. Die restlichen Fächer waren leer. Sonst hatte ich nichts in meinem Büro, nicht einmal Deko.
»Tja, Ende der Führung«, sagte ich, nachdem mein Kindheitsfreund die drei Stufen hochgestiegen war und durch die Tür geschaut hatte.
»Hmmm, und die Blume gibt dem Ganzen ein gewisses je ne sais quoi …«, sagte er und küsste Daumen und Zeigefinger wie ein Koch, der mit der Soße, die er gerade verkostet hatte, zufrieden war.
Wir hatten beide an diesem Nachmittag nicht viel Zeit für seinen unerwarteten Besuch. Er war mit einem Produzenten verabredet, der gerade auf dem Gelände drehte. Und was mich betraf, würde die Comedian jeden Moment aufkreuzen, um mich abzuholen.
Josh fragte mich, ob ich am Abend mit ihm essen gehen wollte. Ich sagte zu.
Abends tauchte er in einem langen schwarzen Cashmeremantel auf. Es war Winter in Los Angeles, und das bedeutete Brände bei Trockenheit und Überschwemmungen bei Regen. Am Morgen und in den Nächten war es kalt, und manchmal frischte der Wind auf und verlieh dem Winterhimmel ein knackiges Blau. Schichten von Salz und Meer und Kaminfeuern hingen in der Luft.
Das Haus in Hancock Park, in dem ich mit der Comedian wohnte, war ziemlich groß, hatte aber keinen Kamin, obwohl der weiße Holzsims an der Wand darauf hindeutete, dass dort einmal ein Kamin gewesen war. Die schönen Holzböden, die Bogengänge und die hohen Decken waren typisch für L. A.-Bungalows aus den dreißiger Jahren. Das Bad war mit mexikanischen Fliesen gekachelt, es gab Einbauschränke, und in der kleinen Essecke in der Küche stand ein eingebauter Tisch mit Sitzbänken an jeder Seite. Ein Panoramafenster zeigte zur Straße.
Hancock Park war ein altes Stadtviertel. Früher war es wohlhabend gewesen, jetzt kam es langsam wieder in Mode. Nebenan wohnte eine Gruppe cooler Harley-Davidson-Fahrer, deren Motorräder allen den Puls hochtrieben, wenn sie mitten in der Nacht oder früh am Morgen knatternd die Straße hinunterrasten, und auf der anderen Seite, direkt gegenüber von unserem Schlafzimmerfenster, wohnte Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers. Die Häuser standen so dicht nebeneinander, dass sich die Fenster fast berührten. Seine Freundin hatte Tag und Nacht serielle Orgasmen, und wenn sie keinen Orgasmus hatte, klackerte sie in ihren Plateauschuhen so laut über den Hartholzboden im Flur, dass unser Haus erbebte. Eines Nachmittags, ehe ich während einer ihrer routinierten Sex-Arien wie sonst hinüberrufen konnte: »Sie tut nur so!«, fing sie panisch an zu schreien: »Er geht nicht raus!« Diesmal klang ihre Stimme echt.
Weder die Comedian noch ich hatten damals ein festes Einkommen, und das Haus war zu teuer für uns. Als letzten Rettungsversuch nahmen wir das Angebot an, auf gut Glück gemeinsam eine Dramödie zu schreiben. Es sollte um eine Alkoholikerin gehen, eine knallharte, vom Glück verlassene Ex-Tänzerin der Rockettes, die schließlich ihre Dämonen besiegte, Happy End. Die Idee dazu hatten zwei schwule Autoren-Produzenten, die beim Fernsehen mit den Golden Girls berühmt geworden waren. Sie hatten die Shows der Comedian bewundert, ehe der Alkohol sie gemein werden ließ, und wollten uns eine Chance geben. Außerdem mussten sie dem Studio, das ihnen einen lukrativen Deal angeboten hatte, bergeweise Material liefern. Uns war klar, dass nicht jedes Script produziert werden würde, aber einige der Projekte erreichten immerhin das nächste Level, und das bedeutete Geld.
Unser Projekt würde nicht dazugehören. Aber damals hofften wir noch darauf.
Josh und die Comedian unterhielten sich eine Weile, sie hatten gemeinsame Bekannte im Showgeschäft, und rissen ein paar Witze. Wir lachten, mehr oder weniger.
Als ich mit ihm das Haus verließ, fragte die Comedian nicht, wann ich zurück sein würde.
Wir stiegen in seinen schwarzen Range Rover, und beim Losfahren drehte sich Josh zu mir und sagte: »Ich heiße jetzt Eduardo.«
Der Name passte. Eigentlich passte er viel besser zu ihm als sein ursprünglicher Name, den er jetzt wie einen Nom de Plume verwendete, als Pseudonym für seine Filme.
Wir fuhren auf dem Beverly Boulevard Richtung Westen. Er wollte zu Dominick’s, einem exklusiven Restaurant in West Hollywood. Der Laden war so exklusiv, dass nicht einmal ein Schild an der Tür darauf hinwies. Von der Straße aus war der Eingang nicht zu sehen. Ich musste schon tausendmal daran vorbeigelaufen sein, ohne zu bemerken, dass sich dort ein Restaurant befand. Nie hatte ich jemanden hineingehen oder herauskommen sehen. Selbst die Leute vom Parkservice sah man nicht, denn der eigentliche Eingang befand sich in der Alley, wo auch die Mülltonnen standen. Hier nahmen die Leute vom Parkservice die teuren Autos in Empfang und fuhren sie später wieder vor.
Drinnen war es dunkel. Aber ich konnte jede Menge schicke Menschen erkennen, die mit Cocktails herumstanden und auf einen Platz warteten. Wir wurden sofort zu einem Tisch in einer begehrten Ecke des Lokals geführt, die Inhaberin kannte Josh. An einem Ort wie diesem war ich lange nicht gewesen, es fühlte sich gut an, dazuzugehören.
Die Kellnerin kam, Josh bestellte Cola, ich bat um ein Glas Rotwein.
»Für dich haben wir heute das Prime Rib Steak, Josh, halbroh, so, wie du es magst.«
»Hmmm«, sagte er mit erstaunlich samtiger, tiefer Stimme, »voll pervers. Nehm ich.« Sein Lachen klang cool und entspannt.
Während er mit irgendeinem Produzenten scherzte, der an unseren Tisch trat, hatte ich die Gelegenheit, mir meinen alten Freund im Kerzenlicht genauer anzusehen. Er sah anders aus als früher. Sein dunkles, lockiges Haar war einem kurzrasierten Schädel gewichen, die nackte, wuchtige Stirn durchzog ein Netz von Adern, das an den Schläfen hervortrat, und der starke Bartschatten schien dunkler zu werden, je länger wir in diesem schummrigen Lokal saßen. Mit seiner Nase war etwas Ungewöhnliches passiert. Als Kind war sie so flach gewesen wie die von Sammy Davis, Jr. Jetzt wirkte sie schnittig. Sie schien das Resultat eines eher gelungenen Nose-Jobs zu sein, einer jener, bei denen sie einen kleinen Fehler einbauen. Die Lippen waren so voll, wie ich sie in Erinnerung hatte, besonders die untere. Insgesamt sah er attraktiv und männlich aus, trotz der dicken Brillengläser in einem schweren schwarzen Rahmen, die seine schläfrigen Augen vergrößerten.
Nachdem das Bestellen erledigt und der Produzent weitergezogen war, schaute Josh mich an und sagte: »Ich steh nich’ mehr so aufs Ficken.«
Vor solchen Momenten mit ihm hatte ich mich immer gefürchtet. Seit ich ihn kannte, redete er über Sex. Seine Lieblingsgeschichte drehte sich um seine Cousine, die ihm das Herz gebrochen hatte, als sie eines Tages nicht mehr mit ihm hatte reden wollen, und die ihm einige Jahre später noch einmal das Herz brach, als sie es ablehnte, weiterhin Sex mit ihm zu haben. In anderen Geschichten ging es um Rettungssanitäter und darum, was sie mit ihren bewusstlosen Opfern anstellten, ehe sie sie ins Krankenhaus brachten. Als er sagte, dass er »nich’ mehr so aufs Ficken« stand, war ich beinahe erleichtert.
Was mich betraf, wollte ich damit auch nichts zu tun haben. Hatte ich nie gewollt. Jedenfalls nicht mit einem Mann.
Wir aßen, und dann tauchte die Kellnerin wieder auf. »Wie wär’s mit einem Dessert? Wir haben ein dekadentes Soufflé, das trieft nur so vor dunkler Valrhona-Schokolade, oder eine buttrige, warme Tarte Tatin oder frische Beeren mit Sahne.«
»Hmmm, du bringst mich um!« Josh tat so, als würde er sich den Sabber, der ihm aus den Mundwinkeln lief, abwischen. »Du weißt, dass ich keinen Zucker essen soll.« Er sah mich mit tiefernster Miene an. »Das macht mich ballaballa.«
»Oh, wow, ballaballa, cool!« Sie lachte. »Also, Josh, das Übliche?«
»Jawoll, die ganze Palette, aber mit zwei Gabeln.«
Sie ging, und Josh sagte: »Ich darf wirklich keinen Zucker essen.«
»Du trinkst gerade eine Cola.«
»Ich weiß«, sagte er mit gespielter Entrüstung und sang mit einem kastratenähnlichen Falsett: »Call me unreliable«. Seine Stimme klang wunderbar. Sie ähnelte der eines Sängers, der unter dem Namen Prince am bekanntesten gewesen war, nur eine Oktave höher. Er drückte die Knöchel seiner rechten Hand an seine Wange, ließ sie knacken und sagte: »Hast du Lust, ein paar Hexer kennenzulernen?«
Er nahm einen großen Schluck Cola, schob das Glas zur Seite und schaute flüchtig auf sein Blackberry, das neben ihm auf dem Tisch lag. Dann sah er wieder zu mir.
»Aber natürlich, wahnsinnig gern, Josh«, sagte ich. »Ich dachte schon, du würdest nie fragen.«
»Ich mein’s ernst. Und nenn mich Eduardo.«
Wir lachten.
»Wirklich, ich frag, ob sie dich kennenlernen wollen.«
»Nun«, sagte ich in gedehntem Südstaatenenglisch, »I always depended on the kindness of sorcerers.«
»Blanche DuBois«, sagte er in genau demselben Singsang.
Er war groß darin, Leute nachzuahmen.
»Schwörst du, dass du mich nicht verjoshst, Eduardo?«
Er legte seine Hand auf die Brust. »Würde ich dich je anlügen?«
»Dann schwör’s.«
»Okay, ich, Eduardo Junceau, schwöre, dich den Hexern vorzustellen.« Er hob zwei Finger zum Salut. »Ehrenwort!«
Als er mich vor der Haustür absetzte, sagte er: »Ziemlich abgefahren, sich nach all den Jahren wiederzusehen. A blast from the past, wenn du weißt, was ich meine.«
»Allerdings«, sagte ich.
Die Comedian war schon schlafen gegangen.
Blau
Als meine Tochter und ich in die Tierklinik kamen und mir aus dem Karton mit Luftlöchern ein graues, räudiges, dürres Wesen entgegenhopste, war ich bestürzt. Ich sagte so etwas wie: »Sie sieht aus, als ob sie schielt.« Bevor die Katze das Kind erreichen konnte, fragte ich: »Ist sie krank?«
»Das ist nur das Beruhigungsmittel, es lässt jetzt langsam nach«, sagte die Tierärztin. »Ihr fehlt nichts. Aber Sie werden sie in einigen Wochen sterilisieren müssen. Noch ist sie dafür zu schwach.«
»Sie sieht gar nicht aus wie ein Jungtier«, sagte ich.
»Sie ist etwa zwölf Wochen alt. Das lässt sich aber nicht mit Sicherheit sagen, dafür ist sie zu ausgezehrt. Sie könnte auch älter sein.«
Offenbar hatte ich ein weißpfotiges, flaumiges Katzenbaby erwartet. Dabei hätte dieses Kind niemals etwas aufgesammelt, das so süß und so leicht zu lieben war. Als wir zum Auto zurückkamen, sagte ich: »Sie ist Frankenkätzchen«, und wir lachten. Aber zu Hause nahm meine Tochter die Streunerin mit in ihr Zimmer, und ziemlich lange, so schien es mir, bekam ich das Kätzchen nicht mehr zu sehen.
Als sie mir ihren Schützling schließlich vorführte, setzte sie die Katze ohne ein Wort einen halben Meter vor mir auf den Boden. Ich sah, dass sie mit ihrer Arbeit zufrieden war. Die kahlen Stellen waren zugewachsen, das Skelett war nicht mehr sichtbar, und ihr graues Fell war jetzt dicht und samtig und hatte einen blauen Schimmer. Ich konnte nicht widerstehen, mit der Hand durch dieses Fell zu fahren. Das Kätzchen hatte die gleichen grünen Augen wie meine Tochter, was mir in der Klinik nicht aufgefallen war. Sogar die Form ihrer Augen ähnelte sich.
»Die Tierärztin hat gesagt, ihr doppeltes Fell lässt sie manchmal blau aussehen. Sie ist eine ›Russisch Blau‹ und kann Sachen, die keine andere Katze kann, Türen öffnen zum Beispiel«, sagte meine Tochter nach einer Weile.
Ich war beeindruckt. Eine Russisch Blau war offenbar für ihre Intelligenz und ihren Sinn für Humor bekannt und dafür, dass sie tricksen und »direkt vor deinen Augen verschwinden« konnte. Was mich jedoch viel mehr interessierte, war die Trickserei meiner Tochter. Ich wollte wissen, wie sie Frankenkätzchen in dieses anmutige Geschöpf verwandelt hatte. Bisher wusste ich nur vom Hausbesuch der Tierpflegerin, die die Katze rehydriert hatte.
»Ich habe sie dreimal gebadet«, sagte Lola. »Als ich sie zum ersten Mal in die Wanne setzte, krochen ihr ganz viele Käfer ins Gesicht. Sie war über und über mit ihnen bedeckt, außer die Augen. Beim zweiten Bad habe ich den Schorf abgepult, und beim dritten Mal fing sie an zu glänzen.«
Ich stellte mir vor, wie dieses kleine dreieckige Gesicht, überschwemmt von tausenden Insekten, ausgesehen haben musste. Ich hätte eine solche Heldentat nie vollbringen können, aber die Stärke dieses Kindes schien grenzenlos.
»Ist sie nicht schön?«, sagte sie.
Ich schaute den nun wunderbar runden Kopf an und erwiderte: »Wenn du ein Bild von Grace Kelly neben sie halten würdest; ich könnte nicht sagen, wer von beiden wer ist.«
Die Tierärztin in der Klinik hatte meiner Tochter genau erklärt, wie sie das Kätzchen füttern und bürsten sollte, und sie ermahnt, ihm jeden Tag eine Schüssel mit frischem Wasser hinzustellen. Eines aber war am allerwichtigsten: »Ich soll die Katze nicht aus dem Haus lassen, wenn ich möchte, dass sie ein langes und sicheres Leben hat.«
Wir wussten beide, dass das nicht infrage kam.
»Wir machen keine Gefangenen.«
Die goldene Flöte
Normalerweise war ich skeptisch, was Versprechen betraf. Ich hatte schlechte Erfahrungen mit Leuten gemacht, die mir etwas versprachen. Aber diesmal war es anders. Ich glaubte Josh. Hexer in Los Angeles, das war so weit hergeholt, dass es nur wahr sein konnte. Andererseits war die Tatsache, dass etwas weit hergeholt war, noch nie eine Garantie für Wahrheit gewesen.
Nachdem ich mehrere Tage lang nichts von Josh gehört hatte, wurde ich nervös. Es war, als ginge die Sache mit der goldenen Flöte wieder los.
Im Alter von fünf oder sechs Jahren hatte ich Flöte spielen gelernt. Auf Partys meiner Mutter und ihrer Zwillingsschwester gab ich kleine Konzerte auf meiner Kinderflöte, während man plauderte und trank.
Fast immer war »Whitey« da. Er besuchte meine Tante und meine Mutter regelmäßig, gewöhnlich an Feiertagen, und kam immer allein. Sein richtiger Name war Arthur James, aber schon als Kinder hatten sie ihn »Whitey« genannt, weil seine Haut so hell war, sogar seine Wimpern waren weiß. Schon damals war er in die Zwillinge verliebt gewesen, die, wollte man den anderen glauben, atemberaubend aussahen; violettblaue Augen, blauschwarzes Haar, ein doppelter toxischer Cocktail. Damit sich keiner zwischen sie drängen konnte, hatten sie sogar eine eigene Sprache erfunden, aber das hielt »Whitey« nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen.
Wenn er kam, versprach er mir jedes Mal, beim nächsten Mal eine glänzende goldene Flöte mitzubringen. Ich stellte mir die Flöte lebhaft vor, wie sie sich drehte und herumwirbelte wie ein glitzernder Tambourstab, der durch die Luft geschwenkt wurde. Und jedes Mal, wenn »Whitey« wieder vor der Tür stand, sich an die Stirn schlug und sagte: »Es tut mir soo leid, ich hab sie zu Hause vergessen, ich Dussel!«, wurde mein Verlangen nach der Flöte noch größer. Immer war er sichtlich erschüttert von seiner Nachlässigkeit und versprach mir mit Nachdruck, sie das nächste Mal ganz bestimmt nicht zu vergessen.
»Hast du mir die goldene Flöte mitgebracht?«, fragte ich Arthur James.
Den Tränen nahe jammerte er: »O nein, ich habe sie wieder vergessen!«
Einmal rief ein betrunkener Gast aus dem Wohnzimmer: »Warum zum Teufel erlaubst du ihm, dem armen Kind das anzutun? Dass dieser Idiot ein zwanghafter Lügner ist, weiß doch jeder!«
Ich konnte mich nicht erinnern, ob Arthur James mir daraufhin noch einmal versprach, die goldene Flöte mitzubringen, oder ob mir irgendwann endlich jemand erklärte, dass es ein harmloser Witz war, oder ob ihm jemand sagte, dass es jetzt reiche. Ich fragte nicht mehr nach der Flöte und ich wartete auch nicht mehr darauf, und für eine lange Zeit vergaß ich die Sache sogar komplett.
Die goldene Flöte hielt mich davon ab, Versprechungen zu glauben. Dafür glaubte ich so ziemlich alles andere. In der Schule nannten mich die Kinder einen Naivling. Ich musste das Wort im Wörterbuch nachschlagen. Sie hatten recht. Nichts schien je so weit hergeholt, als dass es nicht hätte wahr sein können. Man konnte mir alles Mögliche erzählen, und ich glaubte es. Besonders meine Mutter. Sie erzählte mir beispielsweise, dass unser Telefon verwanzt sei und ich auf keinen Fall etwas sagen solle, das uns in Schwierigkeiten bringen könne. Manchmal legte sie einen Zeigefinger an die Lippen und sah an die Decke, um anzudeuten, dass wir auch in der Wohnung abgehört wurden, was mich darin schulte, gut zuzuhören und den Worten Beachtung zu schenken.
Im Auto hörte ich auf dem Rücksitz aufmerksam zu, wenn sich meine Mutter mit ihrer Schwester in ihrer Privatsprache unterhielt. Schläfrig schaute ich auf ihre Hinterköpfe mit den Kurzhaarschnitten. Sie lachten und rauchten bei geschlossenen Fenstern, und eines Tages merkte ich, dass ich alles, was sie sagten, verstand. Unbeabsichtigt hatte ich den Code der Zwillinge geknackt und nun ebenfalls eine Geheimsprache: »Köllewönnt ihrlewir billeweilltellewe dallewas Fellewensterlewe aulewaufmallewachellewen?«
Irgendwann fand ich es einfacher, mit dem Reden ganz aufzuhören. Es gab keine Worte, die hätten erklären können, warum ich häufig in der Schule fehlte, unterschiedliche Socken trug oder tagelang dasselbe anhatte. Manchmal weckte mich meine Mutter mitten in der Nacht, weil eine Flutwelle aus Honolulu auf uns zurollte oder unser Haus im Treibsand versank oder die Regenfluten die Baldwin Hills hinabströmten und uns überschwemmten. Sie hatte einen kleinen Koffer unter meinem Bett deponiert für den Fall, dass wir in aller Eile packen mussten, um zu fliehen, aber in meiner Panik vergaß ich oft die wichtigsten Dinge, eine Socke, einen Rock, die Zahnbürste.
Einmal sagte meine Mutter, eine riesige Seifenblase sei über den Olympic Boulevard gerollt und gegen ihren Magen geprallt. Solange sie sich von dem Angriff erholte, durfte ich im Haus meiner Großeltern bleiben, fast ein ganzes Jahr.
Das war meine Zuflucht.
Das Schlafzimmerfenster im Haus meiner Großeltern zeigte auf den Garten – Zitronenbäume, Pflaumen und Avocados, Paradiesvögelbüsche, eine Rebe giftiger, lila Beeren, die von der weißen Wand hing, Rosmarin- und Lavendelbüsche und leuchtend rosa Bougainvilleen. In den frühen Morgenstunden war es vollkommen still bis auf die Vögel, die im ersten Morgenlicht zu zwitschern begannen. Ich lag im Bett und lauschte, hypnotisiert von den Staubkörnchen, die in der Luft tanzten.
Es gab einen japanischen Gärtner, der, solange ich mich erinnern konnte, den Garten meiner Großeltern pflegte. Seine Haut war gebräunt und faltig. Manchmal scherzte mein Großvater mit ihm, aber sonst redete der Gärtner mit niemandem. Er kümmerte sich um die Pflanzen und verschnitt die Büsche, legte Fallen mit giftigem Zuckerwasser gegen die Ameisen aus und hängte Netze über die Bäume, damit die Vögel nicht das Obst fraßen. Ich saß meistens im Garten und malte, oft das Gesicht von Abraham Lincoln, aber am häufigsten Menschenopferungen vor flachen Azteken-Pyramiden. Der Gärtner war mein Modell für den aztekischen Hohepriester, der einen blutigen Dolch in die Luft streckte oder ein schlagendes Herz in der Hand hielt, das er gerade aus der Brust des Opfers gerissen hatte, und er war auch mein Modell für Abraham.
Eines Tages sagte der Gärtner zu meinem Großvater, für ihn sei es nun an der Zeit, zu gehen, und übergab ihm »als kleines Zeichen« seiner Dankbarkeit eine Flasche Cognac, in der eine Ballerina steckte. Der Gärtner zog den Flaschenboden auf, und die Ballerina drehte zur Musik langsame Pirouetten. Zufällig saß ich gerade in der Nähe und beobachtete eine Reihe von Ameisen, die auf ihren Tod zumarschierten, als die beiden sich verabschiedeten. Nachdem die Musik aufgehört hatte, nahm mein Großvater die Hand des Gärtners in seine Hände und sagte: »Alles Gute muss irgendwann ein Ende haben, nicht wahr?« Sie standen eine Weile so da, dann kehrte mein Großvater ins Haus zurück, ohne sich noch einmal umzusehen.
Der Gärtner musste an mir vorbei, als er ging, und bevor er das Tor erreichte, blieb er stehen. Ich sah seine Augen. Die Lider waren schwer, der tiefbraune Halbkreis der Iris schwebte über gelblichem Weiß. Er zeigte auf sein vergiftetes Zuckerwasser und sagte: »Geh nicht in die Falle.«
Josh meldete sich nicht.
Nachdem die Flächenbrände abgeklungen waren, kamen die Regenfälle und überschwemmten die Stadt. Ein Gerichtsurteil entzündete erneut Krawalle, die ausgebrochen waren, nachdem ein Polizist einen Schwarzen bei einer einfachen Verkehrskontrolle erschossen hatte. In den Nachrichten warnten sie vor Staus. Es hieß, blinde Verkehrswut bringe immer mehr Leute dazu, ziellos aus den Autofenstern zu schießen. Ich hatte mir Strategien zurechtgelegt, um jederzeit die Flucht antreten zu können: nie Stoßstange an Stoßstange fahren, immer eine Autolänge Abstand fürs Manövrieren halten.
Gegen das dumpfe Gefühl dräuenden Unglücks, das mich wieder überkommen hatte, hatte ich keine Strategie und schrak beim Klingeln des Telefons zusammen.
»Hey, Sis, morgen Abend gibt es einen Kurs. Du bist eingeladen. Sie werden alle da sein.«
»Warte, lass mich kurz in meinen Terminkalender schauen …«, sagte ich mit einem britischen Akzent, der meine Erleichterung überspielen sollte.
»Ach, vergiss es.« Josh war kurz angebunden.
»Natürlich komme ich mit!«
»Gut. Der Kurs beginnt um acht. Ich hole dich um sieben ab.« Dann fügte er hinzu: »Zieh dir was Bequemes an, wir werden ein paar Übungen machen.«
Übungen entsprachen nicht unbedingt meiner Vorstellung von einem Treffen mit Hexern – nicht, dass ich mich damit ausgekannt hätte.
Der Kurs fand über einem RadioShack in Santa Monica statt; wieder so eine unauffällige Ladenfront, an der ich oft vorbeigefahren sein musste, ohne sie wahrzunehmen. Wir parkten um die Ecke an der 5th Street. Josh war aufgeregt: Ich sollte mich unauffällig verhalten, nichts sagen.
Wir stiegen eine lange, schmale Treppe zu einem Tanzstudio hinauf. Oben angekommen, tat sich vor uns ein großer Raum mit hohen Decken auf, wie ein Platz in Venedig, der sich am Ende einer schmalen Gasse öffnet. An der hinteren Wand gab es große Fenster, darunter Ballettstangen für die Tänzer. Über die vordere Wand zogen sich Spiegel. Sie waren beschlagen von der schweren, stickigen Luft im Raum. Eilig wurden die Fenster aufgerissen, während die letzten Tänzer ihre Sachen zusammenpackten und das Studio verließen. Unterwegs hatte Josh erwähnt, dass ein gemeinsamer Bekannter regelmäßig an diesen Kursen teilnahm. Wir waren mit ihm zur Schule gegangen, jetzt war er der Agent des Kursleiters, den alle den Mentor nannten. Er organisierte seine Auftritte und Vorträge und handelte die Buchverträge aus. Durch ihn war Josh vor ein oder zwei Jahren zu der Gruppe gestoßen.
Ich erkannte ihn sofort. Er stand in tristen braunen Jogginghosen und einem ausgeblichenen grauen langärmeligen Shirt, dessen obere drei Knöpfe offen waren, mitten im Raum. Im Gegensatz zu Josh hatte er sich seit der Kindheit nicht sehr verändert. Sein rotbraunes Haar war dicht gelockt, sein Gesicht und die Hände waren bleich und voller Sommersprossen. Allerdings sah er kräftiger aus. Obwohl er und Josh in der Elementaryschool eine Klasse über mir gewesen waren und wir nicht viel Kontakt gehabt hatten, war ich mir dieser beiden schon damals deutlich bewusst gewesen. Ich erinnerte mich, dass der Agent auch an der Highschool noch schüchtern und zurückhaltend gewesen war, ein Einzelgänger. Und auch jetzt hatte er die Ausstrahlung eines Einsiedlers, als würde er im Wald hausen. Eine seltsame Eigenschaft für einen Agenten, dachte ich, aber offenbar war er sehr erfolgreich.
Wir standen zu dritt beisammen und schwelgten in Erinnerungen, obwohl es nicht viel zu erinnern gab. Es ging eher um die Gegend, in der wir aufgewachsen waren, die »Slums von Beverly Hills«, wie die Leute sie nannten. Als Kinder hatten wir drei auf der falschen Seite der Gleise gelebt, und das hatte uns von den anderen Kindern unterschieden.
Josh nannte den Agenten nicht bei dem Namen, unter dem ich ihn kannte. Allerdings klang der neue genauso mädchenhaft und unbestimmt. Wie Josh verwendete auch der Agent in der »richtigen Welt« seinen alten Namen, unter dem er sich beruflich etabliert hatte, bevor er seinem renommiertesten Klienten begegnet war.
Der in diesem Moment das Studio betrat.
Es wurde still.
Ein kleiner dunkelhäutiger Mann mit grauem, bläulich schimmerndem Haar ging durch den Saal. Er sah wie ein Azteke aus, sehr altes Gesicht, gedrungener Körper. Dennoch wirkte er außergewöhnlich lebendig. Sein Gang war jugendlich. Rechts und links flankierten ihn zwei Frauen. Er hatte sich bei ihnen eingehängt, und während er den Saal durchquerte, schaute er konzentriert nach vorn. Die letzte Ballerina, die an ihm vorbei aus dem Raum tänzelte, würdigte er keines Blickes. Seine Entourage bestand aus drei weiteren Leuten, aber ich nahm sie kaum wahr. Etwas an dem dunkelhäutigen Mann zog meine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Ich sah nur ihn. Es war, als hätte ein elektrischer Schlag den Saal unter Strom gesetzt. Auf dem Weg zu den Spiegeln blieb er stehen, ergriff mit beiden Händen meine Hand und lächelte warm. Er führte mich von Josh und dem Agenten weg, wobei er mich leise und mit einem starken, spanisch klingenden Akzent begrüßte und in der Mitte des Raums platzierte. Meine beiden alten Freunde stellten sich in die Reihe hinter mir, jeweils ans äußere Ende.
Wir wurden aufgefordert, die »Pferdestellung« einzunehmen, die der Mentor den neuen Teilnehmern vormachte. Offenbar gab es außer mir noch andere, die den Kurs zum ersten Mal besuchten. Aber ich hätte nicht sagen können, wer neu war. Wir sollten die Knie leicht beugen, den Rumpf aufrecht halten, die Hände an die Hüften legen. Das war die Ausgangsstellung. Ich bemerkte, dass sein kräftiger Oberkörper in keinem Verhältnis zu seiner Größe stand. Er war klein, höchstens eins fünfundsechzig. Er fing an, sich hin und her zu drehen und die Arme dabei so um den Körper wirbeln zu lassen, dass die rechte Handfläche an die linke Schulter und der linke Handrücken an die rechte Hüfte schlug. Das Klatschen von Händen auf Haut war im Studio zu hören, und in Anbetracht der Lautstärke konnten es keine leichten Schläge sein. Zuerst bekam ich den Dreh dieser Bewegung nicht raus, aber nach einer Weile merkte ich, dass es eigentlich ganz einfach war. Der Trick bestand darin, die Arme frei schwingen und sich vom Schwung mitnehmen zu lassen. Als ich das herausgefunden hatte, fiel mir die Bewegung leicht. Es war befreiend, sich schwungvoll um die eigene Achse zu drehen, die Füße fest auf dem Boden. Ich fühlte mich unbeschwert, wie ein unbeschwertes Kind, etwas, das ich noch nie gespürt hatte. Der Mentor nannte diese Übung einen echten Lebensretter, in Stresssituationen sei sie sehr nützlich, um neue Energie zu tanken, und er empfahl, vor wichtigen Meetings eine Toilette aufzusuchen und sie auszuführen.
Die wenigen Übungen, die wir an diesem Abend machten, kamen mir alle seltsam vor. Sie verlangten keine besondere Muskelkraft oder Stärke. Trotzdem waren sie so anstrengend wie eine Kampfsportart. Ich spürte, wie mir der Schweiß den Körper hinabrann. Jede der Übungen setzte eine Art innere Hitze frei, auch wenn es nur darum ging, den Daumen auf die eingeknickten Zeigefinger zu drücken, als wäre der Zeigefinger ein Schalter. Während dieser Übung kam der Mentor zu mir. Er legte seinen Zeigefinger auf eines seiner schweren Augenlider und drückte es nach unten. Lächelnd sagte er: »Wenn das Lid hängt, sieh dich vor!«
Blau
Wenige Monate nachdem das Kätzchen zu uns gekommen war, sahen meine Tochter und ich zufällig eine alte streunende Katze. Für uns stand außer Frage, dass sie die Mutter unseres Kätzchens sein musste. Sie hatte genau die gleichen Merkmale: graublaues Fell, weiße Smokinghemdbrust, weiße Pfoten. Allerdings war diese alte Katze von den vielen Würfen, die sie im Laufe der Jahre gehabt haben musste, sehr korpulent geworden. Sie hatte auch außerordentlich lange und sehr weiße Schnurrbarthaare, die sie wie eine alte Konförderiertengeneralin aussehen ließen, und von da an nannten wir sie die Generalin.
»Von ihr hat unser Kätzchen seine Foltermethoden!«
Da gab es die überraschenden Angriffe auf die Zehen am frühen Morgen oder das Kriegsgeheul, das sich anhörte, als wären ihre Stimmbänder an einen Verstärker angeschlossen. Der Schrei war so unerträglich, dass wir gezwungen waren, Tag und Nacht ein Fenster offenzulassen, damit sie kommen und gehen konnte, wie sie wollte.
Meine Tochter bestand darauf, dass das Kätzchen ein Halsband mit Namensschild in Form eines kleinen pinkfarbenen Herzens trug, um nicht verloren zu gehen. Das bedeutete, dass wir das Halsband irgendwie am Hals befestigen mussten. Das bedeutete auch, dass wir uns einen Namen einfallen lassen mussten.
»Sie ist Sophie«, sagte meine Tochter.
»Zweifellos«, sagte ich, ohne zu zögern.
Der Name passte perfekt. Und ich kannte mich mit Namensgebungen aus. Ich machte das nicht zum ersten Mal. Nachdem das kleine Mädchen zu mir gekommen und klar geworden war, dass sie bleiben würde, fiel es mir zu, ihr einen Namen zu geben. Ich nannte sie Lola. Das war der Name des gütigsten Menschen, der mir je begegnet war.
Sophies Name hingegen war inspiriert von einem Film, den Lola und ich gesehen hatten, bevor sie Englisch sprechen konnte. Es handelte sich um den Zeichentrickfilm eines französischen Filmstudenten, der vor dem Disney-Hauptfilm lief. Der Film war etwa fünf Minuten lang und aus nervös zittrigen Bleistiftstrichen komponiert, die sich unaufhörlich bewegten. Es gab nur zwei Figuren, eine sehr liebenswürdige, senile alte Dame und ihre Katze Sophie. Die alte Dame verwöhnte und verhätschelte ihre Katze maßlos, ständig hieß es Sophie hier, Sophie da, bis die Katze, wahrscheinlich eine Siamesische, eines Tages völlig ausrastete. Am Ende des Films war nur noch die alte Dame zu hören, die auf einer schwarzen Leinwand verzweifelt um ihr Leben kreischte: »Sophie!!! Sophie!!!« Das kleine Mädchen und ich lachten, wir lachten uns schlapp, und wenn es zwischen uns überhaupt jemals eine Sprachbarriere gegeben haben sollte, war sie damit augenblicklich überwunden. Wir hatten genau den gleichen Sinn für Humor.
Die Verabredung
Es war bereits dunkel, als Josh und ich nach dem Kurs auf den Santa Monica Boulevard hinaustraten. Wir gingen zum Auto. Jemand kam uns mit schnellen Schritten hinterher, und eine Frauenstimme rief uns etwas zu. Josh blieb sofort stehen. Er war auf einmal schüchtern. Als die Frau uns erreicht hatte, behandelte er sie voller Ehrfurcht und Bescheidenheit, was mich noch mehr überraschte als die Tatsache, dass die Fremde so plötzlich aus dem Dunkeln auftauchte. Josh so zu sehen war mir fast unheimlich. Mit unterwürfiger Liebenswürdigkeit stellte er uns einander vor und trat dann diskret einen Schritt zurück.
Die Frau wirkte jung trotz ihrer graumelierten kurzen Haare. Ihre Augen blitzten. Mit einem charmanten Lächeln fragte sie mich nach meinem Sternzeichen. In ihrem Tonfall lag kein Funken Ironie. Und sie entsprach auch nicht im Entferntesten dem New-Age-Klischee von L. A. Sie schien aufrichtig interessiert, und als ich sagte: »Ich bin Skorpion«, gab mir ihre zustimmende, unerschrockene Reaktion das Gefühl von Einzigartigkeit, jenseits aller Worte, als wäre ich jemand Besonderes oder zur Abwechslung wenigstens mal nicht das Ungeheuer des Tierkreiszeichens. Dann sagte sie etwas, das mich stark beeindruckte, ich aber kurz darauf schon wieder vergessen hatte.
Ich hätte mich gern länger mit ihr unterhalten. Auf dem Rückweg kam Josh gar nicht darüber hinweg, dass diese Frau wirklich auf uns zugekommen war und mit uns geredet hatte. Offenbar war sie eines der geheimnisvollen und machtvollen »Wesen«, die den Mentor umgaben. Dabei hatte sich die Begegnung wie die natürlichste Sache der Welt angefühlt. Sie hatte auch nicht wie eine Autoritätsperson oder eine von Mysterien umwogte Göttin gewirkt. Eigentlich war sie völlig unscheinbar gewesen, abgesehen von diesem irren Magnetismus, der zu spüren gewesen war, wenn sie einen direkt anschaute.





























