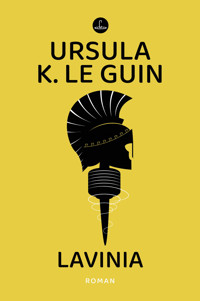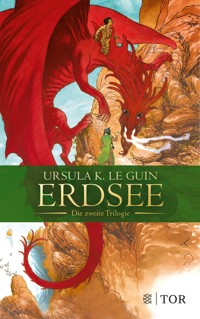
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Erdsee-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die große Fortsetzung des Fantasy-Klassikers erstmals neu übersetzt in einem Band Tenar, die geflohene Priesterin aus den Gräbern von Atuan, hat sich auf der Insel Gont niedergelassen. Sie adoptiert Therru, ein Mädchen, das ein schlimmes Schicksal erlitten hat und dem bestimmt ist, entscheidend in die Geschicke von Erdsee einzugreifen. Als Ged, einstiger Erzmagier und am Ende von »Das letzte Ufer« seiner magischen Kräfte beraubt, nach Gont zurückkehrt, schließt er sich der Dorfgemeinschaft an, und zusammen mit Tenar sorgt er für Therru, um sie vor dem bösen Zauberer Aspen zu schützen. Bald verflicht sich ihr Schicksal mit dem des jungen Dorfzauberers Erle. Dieser wird von Albträumen geplagt, in denen ihn die Toten im Dunklen Land jenseits der Mauer anrufen und auffordern, sie in die Welt zurückzuholen. Auf der Suche nach Deutung dieser Träume und der Erlösung von ihnen führt Erles Weg über die Zauberschule von Rok, den ehemaligen Erzmagier Ged und an den Hof König Lebannens, wo er auch auf Tenar und Tehanu trifft. Gemeinsam mit den Drachen von Erdsee müssen sie versuchen, ihre Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen … Enthält: »Tehanu«, »Das Vermächtnis von Erdsee«, »Rückkehr nach Erdsee« Für alle LeserInnen von J.R.R. Tolkien, Tad Williams und J. K. Rowling »Absolut brillant – einer der Meilensteine der modernen Fantasy!« Patrick Rothfuss
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1226
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ursula K. Le Guin
Erdsee
Die zweite Trilogie
Über dieses Buch
Die große Fortsetzung des Fantasy-Klassikers erstmals neu übersetzt in einem Band
Tenar, die geflohene Priesterin aus den Gräbern von Atuan, hat sich auf der Insel Gont niedergelassen. Sie adoptiert Therru, ein Mädchen, das ein schlimmes Schicksal erlitten hat und dem bestimmt ist, entscheidend in die Geschicke von Erdsee einzugreifen. Als Ged, einstiger Erzmagier und am Ende von »Das letzte Ufer« seiner magischen Kräfte beraubt, nach Gont zurückkehrt, schließt er sich der Dorfgemeinschaft an, und zusammen mit Tenar sorgt er für Therru, um sie vor dem bösen Zauberer Aspen zu schützen.
Bald verflicht sich ihr Schicksal mit dem des jungen Dorfzauberers Erle. Dieser wird von Albträumen geplagt, in denen ihn die Toten im Dunklen Land jenseits der Mauer anrufen und auffordern, sie in die Welt zurückzuholen. Auf der Suche nach Deutung dieser Träume und der Erlösung von ihnen führt Erles Weg über die Zauberschule von Rok, den ehemaligen Erzmagier Ged und an den Hof König Lebannens, wo er auch auf Tenar und Tehanu trifft. Gemeinsam mit den Drachen von Erdsee müssen sie versuchen, ihre Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen …
Enthält: »Tehanu«, »Das Vermächtnis von Erdsee«, »Rückkehr nach Erdsee«
»Absolut brillant – einer der Meilensteine der modernen Fantasy!« Patrick Rothfuss
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ursula K. Le Guin (1929 – 2018) gilt als die Grande Dame der angloamerikanischen Science Fiction. Sie wurde mit zahlreichen Literatur- und Genrepreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem National Book Award für ihr Lebenswerk. Ihre Bücher beeinflussten viele namhafte Autoren, darunter Salman Rushdie und David Mitchell ebenso wie Neil Gaiman und Ian M. Banks.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Neuausgabe
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
»Tehanu«: Die Originalausgabe erschien 1990 bei Victor Gollancz sowie Atheneum, aus dem Amerikanischen übersetzt von Hans-Ulrich Möhring
»Tales from Earthsea«: Die Originalausgabe erschien 2001 bei Harcourt, aus dem Amerikanischen übersetzt von Sara Riffel
»The Other Wind«: Die Originalausgabe erschien 2001 bei Harcourt, aus dem Amerikanischen übersetzt von Hans-Ulrich Möhring
»The Daughter of Odren«: Erstdruck in der vorliegenden Gesamtausgabe (Saga Press, 2018), aus dem Amerikanischen übersetzt von Hans-Ulrich Möhring
»Firelight«: Erstdruck in The Paris Review #225 (Sommer 2018), aus dem Amerikanischen übersetzt von Hans-Ulrich Möhring
»Earthsea Revisioned: Children, Women, Men, and Dragons«: Rede, gehalten 1992 auf der Worlds Apart Conference on Children’s Literature in Oxford; Erstdruck 1993 bei CLNE & Green Bay, aus dem Amerikanischen übersetzt von Karen Nölle
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München, nach einer Idee und unter Verwendung eines Motivs von Charles Vess
ISBN 978-3-10-491248-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Karte von Erdsee]
Tehanu
1 Etwas sehr Schlimmes
2 Unterwegs zum Falkenhorst
3 Ogion
4 Kalessin
5 Besserung
6 Verschlechterung
7 Mäuse
8 Raubvögel
9 Sprachlos
10 Die Delphin
11 Zu Hause
12 Winter
13 Herren und Meister
14 Tehanu
Nachwort
Geschichten von Erdsee
Vorwort
Der Finder
I. In der dunklen Zeit
II. Otter
III. Schwalbe
IV. Medra
Schwarzrose und Diamant
Die Knochen der Erde
Im Hochmoor
Libelle
I. Iria
II. Elfenbein
III. Asver
IV. Irian
Nachwort
Der andere Wind
1 Der grüne Krug
2 Paläste
3 Der Drachenrat
4 Die Delphin
5 Die Vereinung
Nachwort
Die Tochter des Fürsten von Odren
Feuerschein
Erdsee mit neuen Augen
Tehanu
1Etwas sehr Schlimmes
Nachdem Bauer Flint aus dem Mitteltal gestorben war, blieb seine Witwe auf dem Hof wohnen. Ihr Sohn fuhr zur See, und ihre Tochter hatte einen Kaufmann aus Valmünde geheiratet, so dass sie allein auf dem Eichenhof lebte. Die Leute erzählten sich, sie sei im Ausland, wo sie herkam, irgendwie eine große Persönlichkeit gewesen, und tatsächlich kam der Magier Ogion sie gelegentlich auf dem Eichenhof besuchen. Doch das hatte nicht viel zu besagen, denn Ogion besuchte alle möglichen obskuren Existenzen.
Sie hatte einen fremdländischen Namen, aber Flint hatte sie Goha genannt; so nennt man auf Gont eine kleine weiße Webspinne. Der Name passte recht gut zu ihr, denn sie war weißhäutig und klein und verstand sich gut auf das Spinnen von Ziegen- und Schafwolle. Nun also, als Flints Witwe, war Goha die Herrin über eine Herde Schafe und das zugehörige Weideland, vier Felder, einen Pfirsichgarten, zwei Pächterhäuser, das steinerne alte Bauernhaus unter den Eichen und den Familienfriedhof hinter dem Hügel, wo Flint lag, Erde in seiner Erde.
»Ich habe lange in der Nähe von Grabsteinen gelebt«, sagte sie zu ihrer Tochter.
»Ach, Mutter, zieh doch zu uns in die Stadt!«, sagte Apfel, aber die Witwe wollte ihr Alleinleben nicht aufgeben.
»Vielleicht später, wenn Kinder da sind und du Hilfe brauchst«, sagte sie und blickte ihre grauäugige Tochter mit Wohlgefallen an. »Aber jetzt noch nicht. Du brauchst mich nicht. Und mir gefällt es hier.«
Als Apfel sich auf den Heimweg zu ihrem jungen Ehemann gemacht hatte, schloss die Witwe die Tür und stand eine Weile versonnen auf dem Steinboden der Bauernküche. Der Abend dämmerte, doch sie zündete die Lampe nicht an. Sie sah ihren Mann vor sich, wie er immer die Lampe angezündet hatte: die Hände, den Funken, das konzentrierte dunkle Gesicht im aufscheinenden Licht. Das Haus war still.
Ich habe einst allein in einem stillen Haus gelebt, dachte sie. Das werde ich wieder tun. Sie zündete die Lampe an.
In den ersten heißen Tagen kam ihre alte Freundin Lerche an einem Spätnachmittag auf der staubigen Feldstraße aus dem Dorf herbeigeeilt. »Goha«, sagte sie, als sie die Freundin im Bohnenbeet jäten sah, »Goha, es ist etwas Schlimmes passiert. Etwas sehr Schlimmes. Kannst du mitkommen?«
»Ja«, sagte die Witwe. »Was ist denn so schlimm?«
Lerche musste sich kurz verschnaufen. Sie war eine einfache, füllige Frau mittleren Alters, deren Name nicht mehr zu ihrem Körper passte. Aber früher war sie einmal ein schmächtiges, hübsches Mädchen gewesen, und sie hatte sich mit Goha angefreundet, ohne sich um die anderen im Dorf zu scheren und um ihr Getuschel über die bleichgesichtige kargische Hexe, die Flint sich ins Haus geholt hatte. Seitdem waren sie Freundinnen geblieben.
»Ein verbranntes Kind«, sagte sie.
»Wem gehört es?«
»Landstreichern.«
Goha machte die Haustür zu, dann gingen sie los, und Lerche erzählte. Sie war außer Atem und schwitzte. Winzige Samen der vollen Gräser, die am Wegrand wuchsen, klebten ihr auf Backen und Stirn, und beim Reden wischte sie sich ständig übers Gesicht. »Sie haben den ganzen Monat auf den Flusswiesen gelagert. Ein Mann, angeblich Kesselflicker, aber in Wirklichkeit ein Dieb, mit einer Frau dabei. Dazu noch ein zweiter Mann, jünger, der die meiste Zeit mit ihnen herumlungert. Arbeitsscheu, einer wie der andere. Stehlen und betteln und lassen die Frau anschaffen. Bauernjungen von weiter unten am Fluss haben Sachen von ihren Höfen angebracht, damit sie es mit ihr treiben können. Du weißt ja, wie das heute läuft. Dazu Banden auf den Straßen, die gucken, wo bei Bauern was zu holen ist. An deiner Stelle würde ich dieser Tage meine Tür abschließen. Dieser eine jedenfalls, der Jüngere, kommt ins Dorf, und ich war gerade draußen vorm Haus, und er sagt: ›Dem Kind geht’s nicht gut.‹ Ich hatte bei denen kaum je was gesehen von einem Kind, so ein kleines Frettchen und immer so rasch davongehuscht, dass ich mir gar nicht sicher war, ob es das wirklich gab. Ich sag: ›Nicht gut? Hat es Fieber?‹ Und der Bursche sagt: ›Sie hat sich beim Feuermachen verletzt‹, und bevor ich so weit war mitzukommen, hatte er sich schon aus dem Staub gemacht. Weg war er. Und als ich dann hin bin zum Fluss, waren die andern zwei auch weg. Getürmt. Niemand mehr da. Mitsamt ihrem ganzen Plunder. Nur ihr Lagerfeuer hat noch geschwelt, und direkt daneben … halb drin … auf dem Boden …«
Lerche blieb einen Moment wortlos stehen, den Blick starr geradeaus gerichtet, nicht auf Goha.
»Sie hatten nicht mal eine Decke über sie getan«, sagte sie schließlich.
Sie ging weiter.
»Sie war ins Feuer gestoßen worden, als es noch gebrannt hat«, sagte sie. Sie schluckte und wischte wieder Samen weg, die ihr im heißen Gesicht klebten. »Hätte sein können, dass sie reingefallen war, aber wenn sie bei Sinnen gewesen wäre, hätte sie versucht, sich zu retten. Nein, die haben sie geschlagen, bis sie dachten, sie wäre tot, denke ich mal, und damit man nicht sieht, was sie mit ihr gemacht hatten, haben sie …«
Sie blieb wieder stehen, ging wieder weiter.
»Vielleicht war er’s gar nicht selber. Vielleicht hat er sie rausgezogen. Immerhin ist er Hilfe holen gekommen. Muss der Vater gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wer weiß das schon? Wen kümmert das schon? Wer kümmert sich jetzt um das Kind? Warum machen Menschen so was?«
Goha fragte leise: »Wird sie’s überleben?«
»Kann sein«, sagte Lerche. »Kann sein, dass sie überlebt.«
Als sie kurz vor dem Dorf waren, sagte sie: »Ich weiß nicht, warum ich zu dir kommen musste. Eppich ist bei ihr. Es gibt nichts zu tun.«
»Ich könnte nach Valmünde gehen, zu Buche.«
»Er könnte nichts tun. Es ist zu … zu schlimm. Ich hab sie warm eingepackt. Eppich hat ihr einen Trank und einen Schlafzauber verabreicht. Ich hab sie mit zu mir genommen. Sie muss sechs oder sieben sein, aber sie wiegt kaum so viel wie eine Zweijährige. Sie ist beim Tragen gar nicht richtig wach geworden. Aber sie macht so Schnapptöne … Ich weiß, du kannst gar nichts tun. Aber ich wollte dich dahaben.«
»Ich komme gern«, sagte Goha. Doch bevor sie in Lerches Haus traten, schloss sie die Augen und hielt einen Moment angstvoll die Luft an.
Lerches Kinder waren nach draußen geschickt worden, und das Haus war still. Das Kind lag bewusstlos auf Lerches Bett. Die Dorfhexe Eppich hatte eine Heilsalbe aus Zaubernuss und Ziest auf die kleineren Verbrennungen gestrichen, aber die rechte Gesichts- und Kopfhälfte und die rechte Hand, die bis auf die Knochen verkohlt waren, hatte sie nicht angerührt. Sie hatte die Rune Pirr über das Bett gezeichnet und es dabei belassen.
»Kannst du etwas tun?«, fragte Lerche im Flüsterton.
Goha besah sich das verbrannte Kind. Ihre Hände regten sich nicht. Sie schüttelte den Kopf.
»Du hast doch heilen gelernt da oben auf dem Berg, oder?« Schmerz, Scham und Wut sprachen aus Lerche, flehten um Linderung.
»Nicht einmal Ogion könnte das heilen«, sagte die Witwe.
Lerche biss sich auf die Lippe, wandte sich ab und weinte. Goha nahm sie in den Arm, strich ihr über die grauen Haare. Sie hielten sich umschlungen.
Die Hexe Eppich kam aus der Küche und blickte finster, als sie Goha sah. Obwohl die Witwe in keiner Weise zauberisch tätig war, hieß es von ihr, sie habe in ihrer ersten Zeit auf Gont als Mündel des Magiers in Re Albi gelebt und sie kenne den Erzmagier von Rokh und verfüge zweifellos über unheimliche fremdländische Kräfte. Eifersüchtig auf ihr Vorrecht bedacht trat die Hexe ans Bett, häufte dort geschäftig etwas in einer flachen Schüssel auf und steckte es an. Es qualmte und stank, während sie immer wieder einen Heilzauber vor sich hin murmelte. Der beißende Kräuterrauch brachte das verbrannte Kind zum Husten, und mit Zucken und Schaudern erwachte es halb. Es fing an, scharfe, kurze, raue Schnappgeräusche zu machen. Sein eines Auge schien Goha anzublicken.
Goha trat vor und nahm die linke Hand des Kindes. Sie redete in ihrer eigenen Sprache. »Ich habe ihnen gedient, und ich habe sie verlassen«, sagte sie. »Ich werde nicht dulden, dass sie dich kriegen.«
Das Kind starrte auf sie oder ins Nichts. Es versuchte zu atmen, versuchte es wieder, versuchte es wieder.
2Unterwegs zum Falkenhorst
Über ein Jahr darauf, in den endlosen heißen Tagen nach dem Langen Tanz, kam auf der Straße von Norden ein Bote ins Mitteltal und fragte nach der Witwe Goha. Die Leute im Dorf wiesen ihm den Weg, und spät am Nachmittag erreichte er den Eichenhof. Ein Mann mit spitzem Gesicht und flinken Augen. Sein Blick wanderte von Goha zu den Schafen in der Hürde hinter ihr, und er sagte: »Feine Lämmer. Der Magier von Re Albi schickt nach dir.«
»Er hat dich geschickt?«, erkundigte sich Goha ungläubig und belustigt. Wenn Ogion sie sehen wollte, hatte er schnellere und bessere Boten: einen rufenden Adler etwa, oder es reichte schon, dass er einfach leise ihren Namen sagte: Kommst du?
Der Mann nickte. »Er ist krank«, sagte er. »Verkaufst du welche von den weiblichen Lämmern?«
»Könnte sein. Sprich den Hirten drauf an, wenn du magst. Drüben am Zaun. Möchtest du was zu Abend essen? Du kannst hier übernachten, wenn du willst, aber ich bin dann weg.«
»Heute Abend noch?«
Diesmal war ihr Blick nicht belustigt, sondern leicht geringschätzig. »Ich werde keine Zeit vertrödeln«, sagte sie. Sie besprach sich kurz mit dem alten Hirten Klarbach und ging dann zum Haus hinauf, das am Rand des Eichenhains am Hang stand. Der Bote folgte ihr.
Ein Kind, das er einmal kurz ansah, um sofort wieder wegzuschauen, setzte ihm in der Steinbodenküche Milch, Brot, Käse und Lauchzwiebeln vor, dann ging es hinaus, ohne ein Wort zu sagen. An der Seite der Frau tauchte es wieder auf, beide mit Reiseschuhen an den Füßen und mit leichten Lederranzen auf dem Rücken. Der Bote folgte ihnen nach draußen, und die Witwe schloss die Haustür ab. Sie brachen gemeinsam auf, er noch in anderen Geschäften, denn Ogions Botschaft auszurichten war nur eine kleine Gefälligkeit gewesen neben der wichtigen Pflicht, für den Fürsten von Re Albi einen Zuchtwidder zu kaufen. Wo der Gehweg zum Dorf abbog, sagten ihm die Frau und das verbrannte Kind Lebewohl. Sie schritten die Straße bergan, die er gekommen war, nordwärts und dann westlich in die Ausläufer des Gontbergs.
Sie marschierten, bis das lange sommerliche Abendlicht zu schwinden begann. Da verließen sie die schmale Straße und suchten sich einen Schlafplatz in einem kleinen Tal an einem Flüsschen, das flink und still dahinlief und in dem sich zwischen dichtem Weidengestrüpp der fahle Abendhimmel spiegelte. Goha richtete ein Lager aus trockenen Gräsern und Weidenblättern, im Dickicht versteckt wie eine Hasenkuhle, und wickelte auf dieser Unterlage das Kind in eine Decke ein. »So«, sagte sie, »jetzt bist du ein Kokon. Am Morgen wirst du ein Schmetterling sein und ausschlüpfen.« Sie machte kein Feuer, sondern legte sich einfach im Mantel neben das Kind und beobachtete, wie einer nach dem anderen die Sterne erschienen, lauschte, was der Fluss leise erzählte, bis sie einschlief.
Als sie in der Kälte vor Tagesanbruch erwachten, machte sie über einem kleinen Feuer einen Topf Wasser heiß, um für sie beide Haferschleim zu kochen. Der kleine verunglückte Schmetterling kam zitternd aus seinem Kokon, und Goha ließ den Topf im taufeuchten Gras abkühlen, damit das Kind ihn halten und daraus trinken konnte. Über dem hohen, dunklen Rücken des Berges hellte es im Osten auf, als sie ihren Weg fortsetzten.
Sie gingen den ganzen Tag im Tempo eines Kindes, das rasch ermüdete. Das Herz der Frau drängte zur Eile, doch sie ging langsam. Sie war nicht fähig, das Kind länger zu tragen, und um ihm den Weg zu erleichtern, erzählte sie ihm Geschichten.
»Wir gehen einen Mann besuchen, einen alten Mann, der Ogion heißt«, erzählte sie ihm, während sie die schmale Straße entlangstapften, die sich immer höher hinauf durch den Wald wand. »Er ist ein weiser Mann und ein Magier. Weißt du, was ein Magier ist, Therru?«
Falls das Kind vorher einen Namen gehabt hatte, kannte es ihn entweder nicht oder wollte ihn nicht verraten. Goha nannte es Therru.
Es schüttelte den Kopf.
»Tja, ich eigentlich auch nicht«, sagte die Frau. »Aber ich weiß, was sie können. Als ich jung war – älter als du jetzt, aber noch jung –, war Ogion mein Vater, so wie ich jetzt deine Mutter bin. Er hat sich um mich gekümmert und versucht, mir beizubringen, was ich wissen musste. Er ist bei mir geblieben, obwohl er manchmal lieber allein umhergeschweift wäre. Er ist gern gewandert – auf den Straßen so wie wir jetzt und auch im Wald, in der Wildnis. Er ist über den ganzen Berg gestreift, hat geschaut, gelauscht. Weil er immer am Lauschen war, haben sie ihn den Schweigsamen genannt. Aber mit mir hat er geredet. Er hat mir Geschichten erzählt. Nicht nur die großen Geschichten, die alle lernen, von Helden und Königen und Begebenheiten vor langer Zeit und in weiter Ferne, sondern auch Geschichten, die nur er gekannt hat.« Sie ging ein Stück weiter, bevor sie fortfuhr. »Ich erzähle dir mal eine von diesen Geschichten.
Zu den Fähigkeiten, die Magier haben, gehört, dass sie sich in etwas anderes verwandeln können, eine andere Form annehmen können. Gestaltwandel nennen sie das. Ein gewöhnlicher Zauberer bringt es fertig, dass er wie jemand anderes aussieht oder wie ein Tier, so dass du erst mal nicht weißt, was du vor dir hast – als ob er eine Maske aufgesetzt hätte. Aber die Magier können mehr. Sie können selbst die Maske werden, sie können sich wirklich in ein anderes Wesen verwandeln. Wenn also ein Magier das Meer überqueren will und kein Schiff hat, kann er sich in eine Möwe verwandeln und hinüberfliegen. Aber er muss aufpassen. Wenn er ein Vogel bleibt, beginnt er zu denken, was ein Vogel denkt, und vergisst, was ein Mensch denkt, und dann kann es passieren, dass er als Möwe davonfliegt und nie wieder ein Mensch wird. Es heißt, es gab einmal einen großen Magier, der sich gern in einen Bären verwandelte und das zu häufig machte, und er wurde ein Bär und tötete seinen eigenen kleinen Sohn, und sie mussten ihn jagen und töten. Aber Ogion hat auch Scherze damit gemacht. Als einmal die Mäuse in seine Speisekammer einfielen und sich über den Käse hermachten, fing er eine mit einem kleinen Mausefallenzauber, und er hielt die Maus hoch, so, und sah ihr ins Auge und sagte: ›Habe ich dir nicht gesagt, du sollst nicht Maus spielen!‹ Und im ersten Moment dachte ich, er meint es ernst.
Die Geschichte jetzt handelt von etwas Ähnlichem wie Gestaltwandel, aber Ogion meinte, dass es über alles hinausging, was er an Gestaltwandel kannte, denn in dem Fall waren zwei Wesen gleichzeitig in ein und derselben Gestalt, und das, sagte er, würde die Macht von Magiern übersteigen. Aber er hat es selbst erlebt, und zwar in einem kleinen Dorf an der Nordwestküste von Gont, das Kemay heißt. Dort lebte eine Frau, eine alte Fischersfrau, keine Hexe, nicht ausgebildet; aber sie dichtete Lieder. Dass Ogion von ihr erfuhr, kam so. Er streifte dort an der Küste entlang, wie es seine Gewohnheit war, und lauschte, und er hörte Leute singen, die gerade ein Netz flickten oder ein Boot kalfaterten, und dabei sangen sie:
Jenseits des westlichsten Westens,
wo kein Land mehr ist,
tanzt mein Volk
auf dem anderen Wind.
Ogion hörte die Melodie und die Worte, und da ihm beides völlig unbekannt war, fragte er, wo das Lied her war. Zur Antwort wurde er hierhin und dorthin geschickt, bis er schließlich an jemanden kam, der sagte: ›Ach, das ist eines der Lieder von der Frau aus Kemay.‹ Darauf zog er weiter nach Kemay, dem kleinen Fischerdorf, wo die Frau lebte, und er fand ihr Haus unten am Hafen. Da klopfte er mit seinem Magierstab an die Tür. Und sie kam und machte ihm auf.
Du erinnerst dich vielleicht, wie wir über Namen gesprochen haben, dass Kinder Kindernamen haben und dass jeder einen Rufnamen hat und vielleicht auch einen Spitznamen. Manche nennen einen so, andere so. Du bist meine Therru, aber wenn du älter wirst, bekommst du vielleicht einen hardischen Rufnamen. Außerdem wirst du, wenn du ins Frauenalter kommst und alles mit rechten Dingen zugeht, deinen wahren Namen erhalten. Du wirst ihn von jemandem erhalten, der wahre Macht besitzt, einem Magier der einen oder anderen Art, denn das ist ihre Kraft, ihre Kunst: dass sie einem den Namen geben. Und weil dein innerstes Wesen in deinem wahren Namen liegt, kann es sein, dass du den Namen niemals einem anderen Menschen verrätst. Er ist deine Stärke, deine Macht, aber für jemand anders ist er eine Gefahr und eine Last, und er darf nur in höchster Not und größtem Vertrauen verraten werden. Aber ein großer Magier, der alle Namen kennt, kann ihn auch erkennen, ohne dass du ihn verrätst.
Ogion also, der ein großer Magier ist, stand vor der Tür des kleinen Hauses dort am Deich, und die alte Frau machte die Tür auf. Da wich Ogion zurück, und er hielt seinen Eichenstab hoch und hob auch die Hand, so, wie um sich vor Feuershitze zu schützen, und in seinem Erstaunen und Erschrecken sprach er ihren wahren Namen aus: ›Drache!‹
In diesem ersten Moment, erzählte er mir, sah er gar keine Frau dort im Eingang, sondern ein feuriges Lodern und Leuchten und ein Glitzern goldener Schuppen und Klauen und die großen Augen eines Drachen. Einem Drachen, heißt es, darf man nicht in die Augen schauen.
Dann war es vorbei, und er sah keinen Drachen mehr, sondern eine alte Frau dort im Eingang stehen, ein bisschen gebückt, eine hochgewachsene alte Fischersfrau mit großen Händen. Sie sah ihn an und er sie. Und sie sagte: ›Tritt ein, Meister Ogion.‹
Also trat er ein. Sie setzte ihm Fischsuppe vor, und sie aßen, und dann unterhielten sie sich am Feuer. Er dachte, sie müsste eine Gestaltwandlerin sein, aber er wusste nicht, nicht wahr, ob sie eine Frau war, die sich in einen Drachen verwandeln konnte, oder ein Drache, der sich in eine Frau verwandeln konnte. Schließlich fragte er sie: ›Bist du eine Frau oder ein Drache?‹ Und sie sagte es nicht, sie sagte nur: ›Ich werde dir eine Geschichte vorsingen, die ich kenne.‹«
Therru hatte einen kleinen Stein im Schuh. Sie hielten an, um ihn herauszuholen, und gingen dann ganz langsam weiter, denn jetzt kam ein steiler Anstieg zwischen gehauenen Felswänden mit überhängendem Gestrüpp, wo die Zikaden in der Sommerhitze sangen.
»Die Geschichte, die sie Ogion vorsang, geht so.
Als Segoy am Anfang der Zeit die Inseln der Welt aus dem Meer hob, waren die Drachen die Erstgeborenen des Landes und des Windes, der über dem Land wehte. So berichtet es das Schöpfungslied. Aber das Lied der Frau erzählte auch davon, dass damals, am Anfang, Drache und Mensch eins waren. Sie waren ein Volk, ein Geschlecht, hatten Flügel und sprachen die Wahre Sprache.
Sie waren schön und stark und klug und frei.
Doch was in der Zeit ist, entwickelt sich weiter. So wurden unter den Drachenmenschen einige immer besessener vom Fliegen und dem wilden Leben und wollten immer weniger mit Arbeiten und Herstellen zu tun haben, mit Bildung und Lernen, mit Häusern und Städten. Sie wollten nur immer weiter fliegen, jagen und ihre Beute verzehren, unwissend und sorglos, nur darauf aus, immer freier zu werden.
Andere der Drachenmenschen verloren das Interesse am Fliegen, dafür horteten sie Schätze, Reichtümer, hergestellte Dinge, erlernte Dinge. Sie bauten Häuser, Burgen zur Aufbewahrung ihrer Schätze, damit sie alles, was sie erwarben, an ihre Kinder weitergeben konnten, immer darauf bedacht, alles zu vermehren. Und sie begannen die Wilden zu fürchten, die angeflogen kommen und aus reiner Sorglosigkeit und Unbändigkeit ihre ganze teure Habe mit einem Flammenstoß verbrennen und zerstören konnten.
Die Wilden fürchteten nichts. Sie lernten nichts. Weil sie unwissend und furchtlos waren, konnten sie sich nicht retten, wenn die Flugunfähigen sie wie Tiere fingen und töteten. Aber andere Wilde kamen angeflogen und steckten die schönen Häuser in Brand und zerstörten und mordeten. Es waren die Stärksten, bei den Wilden wie bei den Klugen, die sich gegenseitig zuerst umbrachten.
Die Ängstlichsten versteckten sich vor dem Streit, und als es keine Verstecke mehr gab, flohen sie davor. Sie benutzten ihre praktischen Fertigkeiten und bauten Schiffe und segelten nach Osten, nur fort von den westlichen Inseln, wo die großen Geflügelten sich zwischen den gestürzten Türmen bekriegten.
Sie, die Drache und Mensch zugleich gewesen waren, wandelten sich und wurden zwei Völker. Die Drachen, von jeher weniger und wilder, zerstreuten sich in ihrer grenzenlosen unvernünftigen Gier und Wut auf den fernen Inseln der Westmarken, und die Menschen, von jeher zahlreicher in ihren reichen Städten, besiedelten die Binnenlande und den ganzen Süden und Osten. Unter ihnen aber waren einige, die das Wissen der Drachen bewahrten – die Wahre Sprache der Schöpfung –, und das sind heute die Magier.
Doch außerdem, hieß es im Lied, gibt es unter uns solche, die wissen, dass sie einmal Drachen waren, und unter den Drachen gibt es einige, die um ihre Verwandtschaft mit uns wissen. Und die erzählen, dass damals, als aus dem einen Volk zwei wurden, einige, die noch Mensch und Drache zugleich und noch geflügelt waren, nicht nach Osten gingen, sondern nach Westen, immer weiter hinaus über das Offene Meer, bis sie zur anderen Seite der Welt gelangten. Dort leben sie in Frieden, große Flugwesen mit Menschenverstand und Drachenherz, wild und klug zugleich. Und darum sang sie:
Jenseits des westlichsten Westens,
wo kein Land mehr ist,
tanzt mein Volk
auf dem anderen Wind.
Dies also war die Geschichte, die das Lied der Frau aus Kemay erzählte, und es endete mit ebendiesen Worten.
Da sagte Ogion zu ihr: ›Beim allerersten Blick auf dich habe ich dein wahres Wesen gesehen. Diese Frau, die mir gegenüber am Feuer sitzt, ist nichts weiter als das Kleid, das sie trägt.‹
Sie aber schüttelte den Kopf und lachte, und sie sagte nicht mehr dazu als: ›Wenn es nur so einfach wäre!‹
Nach einer Weile kehrte Ogion dann nach Re Albi zurück. Und als er mir die Geschichte erzählte, sagte er zu mir: ›Seit jenem Tag frage ich mich, ob irgendjemand, sei es Mensch oder Drache, jenseits des westlichsten Westens gewesen ist, und ich frage mich, wer wir sind und worin unsere Ganzheit liegt.‹ … Kriegst du langsam Hunger, Therru? Da oben, wo die Straße kehrt, ist ein guter Sitzplatz, wie es aussieht. Vielleicht können wir von dort oben Gonthafen sehen, weit unten am Fuß des Berges. Es ist eine große Stadt, noch größer als Valmünde. Dort an der Kurve setzen wir uns und rasten ein wenig.«
Von der hohen Straßenbiegung aus konnten sie in der Tat über die weiten Waldhänge und felsigen Wiesen bis hinunter zur Stadt an der Bucht blicken und die hohen Klippen sehen, die die Einfahrt zur Bucht bewachten, und die Boote, die wie Holzspäne oder Schwimmkäfer auf dem dunklen Wasser lagen. Weit vor ihnen ragte etwas oberhalb der Straße ein steiles Felsplateau aus der Flanke des Berges: das Oberfenn, auf dem das Dorf Re Albi lag, der Falkenhorst.
Therru saß still zwischen der Straße und den Weiten von Himmel und Meer und beklagte sich nicht, aber als Goha fragte: »Na, sollen wir weitergehen?«, schüttelte das Kind den Kopf. Die Sonne schien warm, und seit ihrem Frühstück im kleinen Tal hatten sie eine tüchtige Strecke zurückgelegt.
Goha holte ihre Wasserflasche aus dem Ranzen, und sie tranken wieder. Dann holte sie einen Beutel mit Rosinen und Walnüssen heraus und gab ihn dem Kind.
»Wir können unser Ziel schon sehen«, sagte sie, »und ich wäre gern vor dem Dunkelwerden da, wenn es sich machen lässt. Ich mache mir Sorgen wegen Ogion. Es wird dich anstrengen, aber wir werden nicht schnell gehen. Und dort werden wir es heute Nacht sicher und warm haben. Behalte den Beutel, steck ihn dir in den Gürtel. Rosinen machen kräftige Beine. Hättest du gern einen Stab – wie ein Magier – als Gehhilfe?«
Therru kaute und nickte. Goha zückte ihr Messer und schnitt dem Kind eine starke Haselrute ab, und als sie eine über die Straße gefallene Erle erblickte, brach sie sich einen Ast ab und schnitt sich daraus einen festen, leichten Stock.
Sie machten sich wieder auf den Weg, und von den Rosinen geködert, trottete das Kind mit. Um sie beide aufzuheitern, sang Goha Liebeslieder, Hirtenlieder und Balladen, die sie im Mitteltal gelernt hatte, aber mitten in einem Lied erstarb ihr plötzlich die Stimme. Sie blieb stehen und streckte warnend die Hand aus.
Die vier Männer vor ihnen auf der Straße hatten sie gesehen. Es hatte keinen Zweck, sich im Wald zu verstecken, bis sie vorbeigegangen waren.
»Streuner«, sagte sie leise zu Therru und ging weiter. Sie fasste ihren Erlenstock fester.
Was Lerche über Banden und Diebe gesagt hatte, war nicht nur die übliche Klage, die jede Generation darüber führt, dass alles nicht mehr so ist wie früher und die Welt vor die Hunde geht. In den letzten paar Jahren waren auf Gont in Stadt und Land Friede und Vertrauen geschwunden. Junge Männer führten sich im heimischen Umfeld wie Fremde auf, sie missbrauchten die Gastfreundschaft, stahlen und verkauften weiter, was sie gestohlen hatten. Bettelei, früher selten, war gang und gäbe, und der unzufriedene Bettler drohte Gewalt an. Frauen gingen nicht gern allein auf die Straße, und diese Einbuße an Freiheit gefiel ihnen keineswegs. Einige der jungen Frauen rissen aus und schlossen sich den Diebes- und Wildererbanden an. Häufig kehrten sie binnen eines Jahres nach Hause zurück, mürrisch, blaugeschlagen und schwanger. Auch unter den dörflichen Zauberern und Hexen war von misslichen Entwicklungen in ihrem Metier die Rede: Heilzauber, die immer gewirkt hatten, heilten nicht mehr, Findezauber fanden nichts mehr oder das Falsche, Liebestränke trieben Männer nicht in leidenschaftliche Ekstase, sondern zu mörderischer Eifersucht. Noch schlimmer war, sagten sie, dass Leute, die keine Ahnung hatten von der Kunst der Magie, von ihren Gesetzen und Grenzen und den Gefahren der Übertretung, sich selbst als machterfüllt bezeichneten und ihren Anhängern Wunder an Reichtum und Gesundheit, ja sogar die Unsterblichkeit versprachen.
Eppich, die Hexe in Gohas Dorf, hatte dunkle Äußerungen über diesen Niedergang der Magie getan, ebenso Buche, der Zauberer von Valmünde. Dieser gescheite und bescheidene Mann war Eppich zur Hilfe gekommen, um Therrus Schmerzen wenigstens ein bisschen zu lindern und ihre Brandnarben etwas zu glätten. Er hatte zu Goha gesagt: »Ich glaube, in einer Zeit, wo solche Dinge geschehen, da stehen die Zeichen auf Untergang, da geht eine Epoche zu Ende. Wie viele hundert Jahre ist es her, dass es einen König in Havnor gegeben hat? So kann es nicht weitergehen. Wir müssen uns wieder der Mitte zuwenden, oder wir gehen unter, Insel gegen Insel, Mann gegen Mann, Vater gegen Sohn …« Mit etwas Scheu in seinem klaren, klugen Blick hatte er sie angesehen. »Erreth-Akbes Ring ist wieder an seinem Platz im Turm von Havnor«, sagte er. »Ich weiß, wer ihn dort hingebracht hat … Das war gewiss das Zeichen, das war das Zeichen, dass das neue Zeitalter kommt! Aber wir haben nicht danach gehandelt. Wir haben keinen König. Wir haben keine Mitte. Wir müssen unser Herz finden, unsere Stärke. Vielleicht wird der Erzmagier zu guter Letzt ja doch tätig werden.« Und er fügte zuversichtlich hinzu: »Schließlich stammt er von Gont.«
Aber nichts war verlautet von einer Tat des Erzmagiers oder einem Thronerben in Havnor, und alles nahm weiter seinen schlimmen Lauf.
Mit Furcht und bitterem Zorn sah Goha nun, wie die vier Männer vor ihr zu je zweien links und rechts an den Straßenrand traten, damit sie und das Kind zwischen ihnen hindurchmussten.
Während sie festen Schritts weitergingen, hielt sich Therru ganz dicht neben ihr, den Kopf gesenkt, nahm aber nicht ihre Hand.
Einer der Männer, ein breitbrüstiger Bursche, dem die schwarzen Borsten von der Oberlippe über den Mund hingen, grinste ein wenig und setzte an, etwas zu sagen. »He, ihr da«, sagte er, aber Goha erhob gleichzeitig die Stimme, und sie erhob sie lauter. »Aus dem Weg!«, sagte sie und reckte ihren Erlenstock, als ob er ein Magierstab wäre. »Ich bin zu Ogion bestellt!« Sie schritt schnurstracks zwischen den Männern hindurch, Therru an ihrer Seite. Die Männer hielten ihre Dreistigkeit für Hexenkraft und rührten sich nicht. Ogions Name hatte vielleicht immer noch Macht. Oder vielleicht war auch eine Macht in Goha oder in dem Kind. Denn als die beiden vorbeigegangen waren, sagte einer der Männer: »Habt ihr das gesehen?«, und er spuckte aus und machte das Zeichen zur Abwehr des Bösen.
»Eine Hexe und ihre Missgeburt«, sagte ein anderer. »Lasst sie gehen!«
Ein Dritter, ein Mann mit Ledermütze und Lederwams, blickte den beiden einen Moment hinterher, während die anderen losschlurften. Trotz seiner elenden und bedrückten Miene schien er kehrtmachen und der Frau und dem Kind folgen zu wollen, doch der Schnurrbärtige rief ihm zu: »Komm schon, Handmann!«, und er gehorchte.
Hinter der nächsten Kurve nahm Goha Therru auf den Arm und eilte mit ihr fort, bis sie sie absetzen und keuchend stehen bleiben musste. Das Kind stellte keine Fragen und machte keine Umstände. Sobald Goha weitergehen konnte, schritt es neben ihr her, so schnell es konnte, und hielt ihre Hand.
»Du bist ganz rot«, sagte es. »Wie Feuer.«
Es sagte selten etwas und wenn, dann undeutlich, da seine Stimme sehr rau war. Aber Goha konnte es verstehen.
»Ich bin zornig«, sagte Goha mit einem halben Lachen. »Wenn ich zornig bin, werde ich rot. So wie ihr, ihr Rotgesichtigen, ihr Barbaren der westlichen Lande … Schau, da vorn ist eine Ortschaft, das wird Eichenbrunn sein. Es ist das einzige Dorf auf dieser Straße. Wir werden dort ein wenig rasten. Vielleicht bekommen wir etwas Milch. Und wenn wir dann weitergehen können, wenn du meinst, du schaffst es bis hinauf zum Falkenhorst, werden wir vor Einbruch der Dunkelheit dort sein, hoffe ich.«
Das Kind nickte. Es öffnete seinen Beutel mit Rosinen und Walnüssen und aß ein paar. Sie trotteten weiter.
Die Sonne war schon lange untergegangen, als sie durch das hochgelegene Dorf und zu Ogions Haus kamen. Die ersten Sterne schimmerten im Westen über einer dunklen Wolkenmasse am Meereshorizont. Das kurze Gras bog sich im Seewind. Auf der Weide hinter dem niedrigen kleinen Haus meckerte eine Ziege. Das einzige Fenster war schwach erleuchtet.
Goha stellte ihren Stock und den Therrus an die Wand neben der Tür, nahm das Kind an der Hand und klopfte einmal.
Keine Antwort.
Sie drückte die Tür auf. Das Feuer im Kamin war ausgebrannt, nur graue Asche, aber eine Öllampe auf dem Tisch machte einen winzigen Lichtfleck, und von seinem Bett in der hinteren Ecke des Raums sagte Ogion: »Komm rein, Tenar.«
3Ogion
Sie brachte das Kind im westlichen Alkoven zu Bett. Sie fachte das Feuer an. Sie setzte sich mit übergeschlagenen Beinen neben Ogions niedrige Pritsche auf den Fußboden.
»Niemand, der sich um dich kümmert!«
»Hab sie weggeschickt«, röchelte er.
Sein Gesicht war so dunkel und hart wie immer, aber seine Haare waren dünn und weiß, und das trübe Licht gab keinen Widerschein in seinen Augen.
»Du hättest sterben können so ganz allein«, sagte sie entrüstet.
»Dabei hilf mir«, sagte der alte Mann.
»Noch nicht«, bat sie, beugte sich vor und legte die Stirn auf seiner Hand ab.
»Nicht heute Nacht«, stimmte er zu. »Morgen.«
Er hob die Hand, um ihr einmal übers Haar zu streichen, so viel Kraft hatte er noch.
Sie richtete sich wieder auf. Das Feuer war angegangen. Sein Licht spielte auf den Wänden und der niedrigen Decke und warf Schatten, die in den Ecken des langen Raums tiefer wurden.
»Wenn Ged doch kommen würde«, murmelte der alte Mann.
»Hast du ihn gerufen?«
»Verschollen«, sagte Ogion. »Er ist verschollen. Eine Wolke. Ein Dunst über dem Land. Er ist in den Westen gezogen. Mit dem Zweig der Eberesche. In den dunklen Nebel. Ich habe meinen Sperber verloren.«
»Nein, nein, nein«, flüsterte sie. »Er wird wiederkommen.«
Sie schwiegen. Die Wärme des Feuers drang beiden langsam unter die Haut, und Ogion entspannte sich und nickte immer wieder mal ein, während Tenar nach dem langen Tag auf den Beinen die Erholung genoss. Sie rieb sich die Füße und die schmerzenden Schultern. Sie hatte Therru auf dem letzten langen Anstieg zeitweise getragen, denn bei dem Versuch, Schritt zu halten, war das Kind vor Anstrengung ganz außer Atem gekommen.
Tenar erhob sich, machte Wasser warm und wusch sich den Straßenstaub ab. Sie machte Milch warm, aß Brot, das sie in Ogions Vorratsschrank fand, und setzte sich wieder zu ihm. Während er schlief, beobachtete sie gedankenversunken sein Gesicht und den Feuerschein und die Schatten.
Sie dachte daran, wie vor langer Zeit und in weiter Ferne ein Mädchen schweigend und gedankenversunken nächtens in einem fensterlosen Raum gesessen hatte, ein Mädchen, dem beigebracht worden war, sich selbst nur als die Verzehrte zu begreifen, Priesterin und Dienerin der Mächte, die in der Dunkelheit der Erde herrschen. Und es hatte eine Frau gegeben, die, während Mann und Kinder schliefen, in der friedlichen Stille eines Bauernhauses wach saß, um nachzudenken, um eine Stunde allein zu sein. Und es gab die Witwe, die ein verbranntes Kind hierhergebracht hatte, die an der Seite des Sterbenden saß, die auf die Rückkehr eines Mannes wartete. Wie alle Frauen überall tat sie, was Frauen tun. Aber nicht mit den Namen der Dienerin oder der Ehefrau oder der Witwe hatte Ogion sie angeredet. So wenig wie Ged damals in der Dunkelheit der Gräber. So wenig wie – länger zurückliegend und weiter weg als alles andere – ihre Mutter, die Mutter, die sie nur als die Wärme und die Löwenfarbe des Feuerscheins erinnerte, die Mutter, die ihr den Namen gegeben hatte.
»Ich bin Tenar«, flüsterte sie. Das Feuer erfasste einen trockenen Kiefernzweig und schoss in einer hellgelben Flammenzunge empor.
Ogions Atem wurde unruhig, und er rang nach Luft. Sie half ihm, so gut sie konnte, bis er sich etwas beruhigte. Beide schliefen sie eine Weile. Dämmernd lag sie neben seiner traumbenommenen, von seltsamen Worten unterbrochenen Stille. Einmal in tiefer Nacht sagte er laut, als begegnete ihm ein Freund auf der Straße: »Wie kommst du denn hierher? Hast du ihn gesehen?« Und als Tenar sich aufrappelte, um Holz nachzulegen, sprach er wieder, diesmal aber wie mit jemandem aus ferner Erinnerung, denn er sagte deutlich im Ton eines Kindes: »Ich wollte ihr helfen, aber das Dach ist eingestürzt. Es ist auf sie alle draufgefallen. Es war das Erdbeben.« Tenar lauschte. Auch sie hatte ein Erdbeben erlebt. »Ich wollte helfen!«, sagte der Junge im Leidenston mit der Stimme des alten Mannes. Dann begann wieder das keuchende Ringen nach Atem.
Im Morgengrauen erwachte Tenar von einem Geräusch, das sie zuerst für das Meer hielt. Es war ein großes Flügelrauschen. Ein Vogelschwarm flog über sie hinweg, so niedrig und so viele, dass ihre Flügel einen regelrechten Sturm veranstalteten und das Fenster von ihren schnellen Schatten verfinstert wurde. Wie es schien, umkreisten sie das Haus einmal und waren dann verschwunden. Sie riefen und schrien nicht, und Tenar wusste nicht, was es für Vögel gewesen waren.
Leute kamen am Morgen aus dem Dorf Re Albi; Ogions Haus stand davon abgesondert ein Stück weiter nördlich. Ein Ziegenmädchen kam und eine Frau wegen der Milch von Ogions Ziegen und andere, um zu fragen, was sie für ihn tun konnten. Moos, die Dorfhexe, befingerte den Erlenstock und die Haselrute neben der Tür und spähte hoffnungsvoll hinein, doch nicht einmal sie traute sich einzutreten, und Ogion knurrte auf seiner Pritsche: »Schick sie fort! Schick sie alle fort!«
Er wirkte kräftiger und gelassener. Als die kleine Therru wach wurde, sprach er mit ihr auf die trockene, gütige, ruhige Art, an die sich Tenar erinnerte. Das Kind ging zum Spielen in die Sonne hinaus, und er sagte zu Tenar: »Was bedeutet der Name, mit dem du sie rufst?«
Er kannte die Wahre Sprache der Schöpfung, aber er hatte niemals Kargisch gelernt.
»Therru bedeutet Brand, das Brennen des Feuers«, sagte sie.
»Ah, ah«, sagte er, und seine Augen glänzten, und er runzelte die Stirn. Er schien einen Moment nach Worten zu suchen. »So eine«, sagte er. »Vor der werden sie sich fürchten.«
»Sie fürchten sich jetzt schon vor ihr«, sagte Tenar bitter.
Der Magier schüttelte den Kopf.
»Lehre sie, Tenar«, flüsterte er. »Lehre sie alles! … Nicht Rokh. Die haben Angst … Warum habe ich dich gehen lassen? Warum bist du gegangen? Um sie herzubringen? Zu spät.«
»Sei still, sei still«, bat sie ihn zärtlich, denn er rang nach Worten und nach Atem und fand weder noch. Er schüttelte den Kopf und keuchte: »Lehre sie!« Dann lag er still.
Er wollte nichts essen und trank nur ein wenig Wasser. Um die Mittagszeit schlief er. Als er am späten Nachmittag aufwachte, sagte er: »Jetzt, Tochter«, und setzte sich auf.
Tenar nahm seine Hand und lächelte ihn an.
»Hilf mir aufstehen.«
»Nein, nein.«
»Doch«, sagte er. »Ins Freie. Ich kann nicht im Haus sterben.«
»Wo willst du hin?«
»Ganz gleich wo. Aber wenn’s geht, zum Waldweg«, sagte er. »Zur Buche hinter der Wiese.«
Als sie sah, dass er aufstehen konnte und entschlossen war, nach draußen zu gehen, half sie ihm. Gemeinsam gelangten sie zur Tür, wo er anhielt und sich in dem einen Raum seines Hauses umschaute. In der dunklen Ecke rechts vom Eingang lehnte sein langer Stab an der Wand, leicht schimmernd. Tenar wollte ihm den Stab geben, doch er schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, »nicht den.« Er schaute sich abermals um wie nach etwas Vermisstem, Vergessenem. »Komm«, sagte er schließlich.
Als ihm der frische Wind von Westen ins Gesicht blies und er zum fernen Horizont blickte, sagte er: »Das ist gut.«
»Ich gehe ein paar Leute aus dem Dorf holen, dass sie dir eine Sänfte machen und dich tragen«, sagte sie. »Sie warten alle darauf, etwas für dich tun zu können.«
»Ich will selbst gehen«, sagte der alte Mann.
Therru kam ums Haus gebogen und beobachtete ernst, wie Ogion und Tenar Schritt für Schritt über die verwilderte Wiese zum Wald gingen, der sich vom Hochplateau aus steil den Berghang hinaufzog, wie sie alle fünf oder sechs Schritte stehen blieben, damit Ogion sich verschnaufen konnte. Die Sonne war heiß, und der Wind war kalt. Sie brauchten sehr lange, um die Wiese zu überqueren. Ogions Gesicht war grau, und seine Beine flatterten wie das Gras im Wind, als sie schließlich zum Fuß einer hohen jungen Buche kurz hinter dem Waldsaum gelangten, ein kleines Stück den Bergpfad hinauf. Dort sank er zwischen den Wurzeln des Baumes nieder, den Rücken an den Stamm gelehnt. Lange konnte er sich nicht bewegen und nichts sagen, und der hämmernde und stockende Herzschlag schüttelte seinen ganzen Körper. Endlich nickte er und flüsterte: »Gut.«
Therru war ihnen in einiger Entfernung gefolgt. Tenar ging zu ihr, nahm sie in den Arm und sprach ein wenig mit ihr. Sie kehrte zu Ogion zurück. »Sie holt eine Decke«, sagte sie.
»Nicht kalt.«
»Mir ist kalt.«
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.
Das Kind schleppte eine dicke Ziegenwolldecke an. Es flüsterte mit Tenar und lief wieder fort.
»Heide lässt sie die Ziegen mit melken und hat ein Auge auf sie«, sagte Tenar zu Ogion. »Damit ich hier bei dir bleiben kann.«
»Bei dir gibt’s nie nur eine Sache«, sagte er in dem rauen pfeifenden Flüsterton, in dem er nur noch reden konnte.
»Nein. Immer wenigstens zwei Sachen, meistens mehr«, sagte sie. »Aber ich bin hier.«
Er nickte.
Lange sagte er nichts, sondern saß einfach an den Baumstamm gelehnt, die Augen geschlossen. Tenar beobachtete, wie sein Gesicht sich mit dem Wechsel des Lichts im Westen langsam veränderte.
Er öffnete die Augen und blickte durch eine Lücke im Gezweig zum Himmel im Westen auf. Er schien in dem fernen, klaren, goldenen Lichtraum etwas zu beobachten, irgendein Geschehen. Zögernd, wie unsicher, röchelte er einmal: »Der Drache …«
Die Sonne war untergegangen, der Wind eingeschlafen.
Ogion sah Tenar an.
»Vorbei«, flüsterte er freudig. »Alles gewandelt! … Gewandelt, Tenar! Warte … warte hier … auf …« Ein Beben erfasste seinen Körper, rüttelte und schüttelte ihn wie den Ast eines Baumes im Sturm. Er schnappte nach Atem. Seine Augen gingen zu und wieder auf, blickten durch sie hindurch. Er legte die Hand auf ihre; sie beugte sich zu ihm nieder; er sagte ihr seinen Namen, damit man ihn nach seinem Tod so nannte, wie er in Wirklichkeit hieß.
Er fasste ihre Hand und schloss die Augen und rang abermals nach Atem, bis kein Atem mehr kam. Er lag da wie eine der Wurzeln des Baumes, während die Sterne herauskamen und durch die Blätter und Zweige des Waldes schienen.
Tenar saß in der Dämmerung und Dunkelheit bei dem Toten. Eine Laterne schimmerte wie ein Glühwürmchen auf der Wiese. Sie hatte die Wolldecke über sie beide gebreitet, doch ihre Hand, die seine Hand hielt, war kalt geworden, als hielte sie einen Stein. Noch einmal legte sie die Stirn auf seine Hand. Steif und schwindlig stand sie auf, ganz fremd im eigenen Körper, und ging dem näher kommenden Licht entgegen, um seinen Träger zu führen.
In jener Nacht saßen die Nachbarn bei Ogion, und er schickte sie nicht fort.
Der Herrensitz des Fürsten von Re Albi stand auf einem Felssporn an der Bergflanke über dem Oberfenn. Früh am Morgen, lange bevor die Sonne über den Berg gestiegen war, kam der Magier, der im Dienst des Fürsten stand, durchs Dorf geschritten, und wenig später schleppte sich ein anderer Magier die steile Straße von Gonthafen hinauf, nachdem er schon in der Nacht aufgebrochen war. Entweder hatten sie gehört, dass Ogion im Sterben lag, oder ihre Macht war solcherart, dass sie vom Tod eines großen Magiers wussten.
Das Dorf Re Albi hatte keinen Zauberer, nur seinen Magier sowie eine Hexe für das gewöhnliche Finden und Flicken und Knochenrenken, womit die Leute den Magier nicht behelligen wollten. Tante Moos war eine griesgrämige Person, unverheiratet wie die meisten Hexen und ungewaschen, die grau werdenden Haare in absonderliche Zauberknoten geflochten und die Augen vom Kräuterrauch rotgerändert. Sie war es gewesen, die mit der Laterne über die Wiese gekommen war, und mit Tenar und den anderen hatte sie die Nacht über bei Ogions Leiche gewacht. Sie hatte dort im Wald eine Wachskerze in einen Glasschirm gestellt und in einer Tonschale süße Öle verbrannt; sie hatte die Worte gesprochen, die gesprochen gehörten, und getan, was getan gehörte. Bevor sie den Leichnam anfasste, um ihn zur Bestattung herzurichten, hatte sie einmal wie zur Erlaubnis Tenar angeblickt und dann weiter ihres Amtes gewaltet. Dorfhexen waren gewöhnlich für die Heimführung zuständig, wie sie es nannten, und häufig auch für die Bestattung.
Als der Magier vom Herrensitz herabkam, ein hochgewachsener junger Mann mit einem silbrigen Kiefernstab, und der andere aus Gonthafen heraufkam, ein stämmiger Mann mittleren Alters mit einem kurzen Eibenstab, blickte Tante Moos sie gar nicht an mit ihren blutunterlaufenen Augen, sondern sammelte rasch ihre armseligen Hexenutensilien ein und zog sich katzbuckelnd zurück.
Als sie den Leichnam so hingelegt hatte, wie es sich zur Bestattung gehörte, mit angezogenen Knien auf der linken Seite, hatte sie ihm etwas in die offene linke Hand gelegt, eingewickelt in weiches Ziegenleder und zugeknotet mit einer bunten Schnur – ein winziges Zauberbündel. Der Magier von Re Albi schnippte es mit der Stabspitze fort.
»Ist das Grab ausgehoben?«, fragte der Magier von Gonthafen.
»Ja«, sagte der Magier von Re Albi. »Auf dem Familienfriedhof meines Fürsten.« Er deutete zum Herrenhaus am Berghang hinauf.
»Aha«, sagte Gonthafen. »Ich hatte gedacht, unser Magier sollte mit allen Ehren in der Stadt beigesetzt werden, die er einst vor dem Erdbeben rettete.«
»Mein Fürst begehrt die Ehre«, sagte Re Albi.
»Aber mir scheint …«, begann Gonthafen, dann hielt er inne. Er wollte zwar nicht streiten, war aber auch nicht bereit, dem dreisten Anspruch des Jüngeren nachzugeben. Er blickte auf den Toten. »Er muss namenlos bestattet werden«, sagte er mit Bedauern und Bitterkeit in der Stimme. »Ich bin die ganze Nacht gegangen, aber zu spät gekommen. Das macht den schweren Verlust noch schwerer.«
Der junge Magier sagte nichts.
»Sein Name war Aihal«, sagte Tenar. »Es war sein Wunsch, hier zu liegen, wo er jetzt liegt.«
Beide Männer blickten sie an. Da er nur ein älteres Dorfweib vor sich sah, wandte sich der junge Mann einfach wieder ab. Der Mann aus Gonthafen stutzte einen Moment und sagte: »Wer bist du?«
»Man nennt mich Flints Witwe Goha«, sagte sie. »Es ist an euch zu wissen, wer ich bin, denke ich, nicht an mir, es zu sagen.«
Die Bemerkung war dem Magier von Re Albi einen kurzen scharfen Blick wert. »Gib acht, Frau, wie du mit Männern der Macht sprichst!«
»Warte, warte«, sagte Gonthafen mit beschwichtigender Geste, um den empörten Re Albi zu beruhigen, den Blick weiter auf Tenar gerichtet. »Du warst … du warst einmal seine Schülerin?«
»Und seine Freundin«, sagte Tenar. Sie drehte den Kopf zur Seite und schwieg, hatte sie doch in ihrer Stimme den Zorn gehört, mit dem sie das Wort »Freundin« ausgesprochen hatte. Sie blickte auf ihren Freund, einen Leichnam, bereit für die Erde, starr und still. Lebendig und voller Macht standen die anderen beiden vor ihm und hatten ihr keine Freundschaft zu bieten, nur Verachtung, Rivalität, Entrüstung.
»Entschuldigt«, sagte sie. »Es war eine lange Nacht. Ich war bei ihm, als er starb.«
»Es ist nicht –«, begann der junge Magier, wurde aber unerwartet von der alten Tante Moos unterbrochen, die laut sagte: »Das stimmt. Sie war bei ihm. Niemand sonst. Er hat nach ihr geschickt. Er hat den jungen Stadler geschickt, den Schafhändler, den ganzen Weg den Berg runter, hat ihr ausrichten lassen, sie soll kommen, und er hat mit dem Sterben gewartet, bis sie da war, und dann ist er gestorben, und er ist dort gestorben, wo er beerdigt werden wollte, hier.«
»Und …«, sagte der ältere Mann, »und er nannte dir …?«
»Seinen Namen.« Tenar blickte die beiden an, und sie konnte nichts machen, die Ungläubigkeit im Gesicht des Älteren, die Verachtung in dem des anderen erregten in ihr eine entsprechende Geringschätzung. »Ich habe den Namen genannt«, sagte sie. »Muss ich ihn euch wiederholen?«
Zu ihrer Bestürzung erkannte sie an ihren Mienen, dass sie den Namen tatsächlich nicht gehört hatten, Ogions wahren Namen. Sie hatten gar nicht auf sie geachtet.
»Oh!«, sagte sie. »Was ist das für eine schlimme Zeit, wo sogar ein solcher Name überhört werden kann, wo er fallen kann wie ein Stein! Ist Hören nicht auch Macht? Also hört her: Sein Name war Aihal. Sein Name im Tod ist Aihal. In den Liedern wird er als Aihal von Gont fortleben. Falls überhaupt noch Lieder gemacht werden. Er war ein stiller Mann. Jetzt ist er sehr still. Vielleicht wird es gar keine Lieder geben, nur Stille. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr müde. Ich habe meinen Vater und meinen lieben Freund verloren.« Ihr versagte die Stimme; ihre Kehle zog sich mit einem Schluchzen zu. Sie wandte sich zum Gehen. Auf dem Waldweg sah sie das kleine Zauberbündel, das Tante Moos gemacht hatte. Sie hob es auf, kniete sich neben den Leichnam, küsste die offene linke Hand und legte das Bündel wieder hinein. Kniend blickte sie noch einmal zu den beiden Männern auf. Sie sprach leise.
»Werdet ihr dafür Sorge tragen«, sagte sie, »dass er hier sein Grab bekommt, wo er es wünschte?«
Erst nickte der ältere Mann, dann der jüngere.
Sie stand auf, strich sich den Rock glatt und schritt im Morgenlicht über die Wiese davon.
4Kalessin
»Warte«, hatte Ogion, der jetzt Aihal war, zu ihr gesagt, kurz bevor der Wind des Todes ihn geschüttelt und vom Leben losgerissen hatte. »Vorbei … alles gewandelt«, hatte er gehaucht, und dann: »Tenar, warte …« Aber er hatte nicht gesagt, worauf sie warten sollte. Vielleicht auf den Wandel, den er gesehen oder gespürt hatte; aber welchen Wandel? Meinte er damit seinen eigenen Tod, sein eigenes abgeschlossenes Leben? Er hatte es freudig gesagt, geradezu euphorisch. Er hatte ihr aufgetragen zu warten.
»Was hätte ich sonst zu tun?«, sagte sie zu sich selbst, während sie sein Haus ausfegte. »Was hätte ich jemals anderes getan?« Und an ihr Erinnerungsbild von ihm gerichtet sagte sie: »Soll ich hier warten, in deinem Haus?«
»Ja«, sagte Aihal der Schweigsame still und lächelte.
Also fegte sie das Haus aus und machte die Herdstelle sauber und lüftete die Matratzen aus. Sie warf angeschlagenes Geschirr und einen undichten Topf weg, doch sie ging sanft damit um. Sie legte sogar die Wange an einen gesprungenen Teller, während sie ihn hinaus zum Abfallhaufen trug, denn er zeugte ihr von der Krankheit des alten Magiers in diesem letzten Jahr. So asketisch er auch gelebt hatte, anspruchslos wie ein armer Bauer, hätte er doch in Zeiten, wo seine Augen noch gut und er noch bei Kräften war, niemals von einem kaputten Teller gegessen oder einen Topf nicht wieder heilgemacht. Diese Zeichen seiner Schwäche grämten sie, und sie wünschte, sie wäre da gewesen, um für ihn zu sorgen. »Ich hätte es gern getan«, sagte sie zu ihrem Erinnerungsbild von ihm, doch er erwiderte nichts. Er hatte nie gewollt, dass jemand anders für ihn sorgte. Hätte er zu ihr gesagt: »Du hast Besseres zu tun«? Sie wusste es nicht. Er war still. Aber dass sie jetzt hier in seinem Haus blieb, das war richtig, da war sie sich sicher.
Schanty und Klarbach, ihr alter Mann, die beide schon länger auf dem Hof im Mitteltal lebten als sie, würden nach den Tieren und dem Obstgarten sehen; Tiff und Sis, das andere Paar auf dem Hof, würden die Felder abernten. Ansonsten würde alles eine Zeitlang sich selbst überlassen bleiben. Ihre Himbeeren würden sich die Nachbarskinder pflücken. Das war schade; sie liebte Himbeeren. Hier oben auf dem Oberfenn, wo immer der Seewind wehte, war es zu kalt, um Himbeeren anzubauen. Aber Ogions altes Pfirsichbäumchen in der geschützten Südecke am Haus trug achtzehn Pfirsiche, und Therru beobachtete sie wie eine Katze auf Mäusejagd, bis sie eines Tages hereinkam und mit ihrer heiseren, undeutlichen Stimme sagte: »Zwei Pfirsiche sind ganz rot und gelb.«
»Ah«, sagte Tenar. Sie gingen zusammen zum Pfirsichbaum und pflückten die ersten beiden reifen Pfirsiche und aßen sie ungeschält an Ort und Stelle. Der Saft lief ihnen übers Kinn. Sie leckten sich die Finger ab.
»Kann ich den pflanzen?« Therru blickte auf den runzligen Stein ihres Pfirsichs.
»Ja. Das ist eine gute Stelle hier, nahe beim alten Baum. Aber nicht zu nahe. Damit sie beide Platz für ihre Wurzeln und Äste haben.«
Das Kind suchte sich einen Fleck und grub das winzige Grab. Es legte den Stein hinein und bedeckte ihn. Tenar beobachtete es. In den wenigen Tagen, die sie hier wohnten, hatte sich Therru verändert, fand sie. Sie zeigte immer noch keine Gefühle, weder Zorn noch Freude, doch seit sie hier waren, hatten sich ihre furchtbare ängstliche Wachsamkeit und ihre Antriebslosigkeit ein ganz klein wenig gebessert. Sie hatte die Pfirsiche haben wollen. Sie hatte sich überlegt, den Stein zu pflanzen, die Zahl der Pfirsiche in der Welt zu vermehren. Auf dem Eichenhof fürchtete sie sich nur vor zwei Leuten nicht, Tenar und Lerche, hier aber hatte sie sich ganz selbstverständlich Heide angeschlossen, der Ziegenhirtin von Re Albi, einer geistesschwachen Zwanzigjährigen, polterig, aber freundlich, die das Kind wie eine ihrer Ziegen behandelte, ein lahmes Kitz. Das war in Ordnung. Und Tante Moos war auch in Ordnung, einerlei wie sie roch.
Als Tenar seinerzeit in Re Albi gelebt hatte, vor fünfundzwanzig Jahren, war Moos noch eine junge Hexe gewesen, keine alte. Grinsend hatte sie vor der »jungen Herrin«, der »Weißen Frau« gekatzbuckelt, Ogions Mündel und Schülerin, und nur mit größter Ehrerbietung das Wort an sie gerichtet. Tenar hatte die Ehrerbietung als falsch empfunden. Diese Maske, hinter der sich Neid, Missgunst und Misstrauen verbargen, kannte sie nur allzu gut von Frauen, denen sie einst übergeordnet gewesen war, Frauen, die sich selbst als gewöhnlich begriffen und sie als ungewöhnlich, als privilegiert. Priesterin der Gräber von Atuan oder fremdländisches Mündel des großen Magiers von Gont, sie war höhergestellt, etwas Besonderes. Männer hatten ihr Macht verliehen, Männer hatten ihre Macht mit ihr geteilt. Frauen betrachteten sie aus der Distanz, manchmal mit Rivalität, häufig mit einem gewissen Spott.
Sie hatte sich als die einsame Außenseiterin, die Ausgeschlossene gefühlt. Sie war vor den Mächten der Wüstengräber geflohen, und dann hatte sie die Wissensmacht und Wirkmacht ausgeschlagen, die ihr Vormund Ogion ihr geboten hatte. Sie hatte dem allem den Rücken gekehrt, war zur anderen Seite gewechselt, in den anderen Raum, wo die Frauen leben, um eine von ihnen zu sein. Als Ehefrau, Bauersfrau, Mutter, Hausherrin übte sie die Macht aus, für die eine Frau geboren war, die Herrschaftsgewalt, die ihr nach der Einteilung der Menschen zufiel.
Und dort im Mitteltal war Flints Frau Goha alles in allem angenommen gewesen unter den Frauen, eine Fremdländerin, gewiss, hellhäutig und mit etwas merkwürdiger Aussprache, aber eine vorzügliche Hausfrau und hervorragende Spinnerin mit anständigen, wohlgeratenen Kindern und einem florierenden Hof: ehrbar. Und unter den Männern war sie die Frau von Flint, die halt machte, was Frauen so machen: verkehren, gebären, backen, kochen, putzen, spinnen, nähen, dienen. Eine gute Frau. Sie fand ihre Zustimmung. Flint hat es nicht schlecht getroffen, sagten sie. Wie eine weiße Frau wohl so sein mag, so weiß am ganzen Leib?, sagten ihre Augen, wenn sie sie ansahen, bis sie älter wurde und die Männer sie nicht mehr sahen.
Hier nun war alles anders, hier gab es nichts mehr von alledem. Seit sie und Moos gemeinsam die Totenwache für Ogion gehalten hatten, gab die Hexe deutlich zu verstehen, dass sie ihre Freundin, Gefolgsfrau, Dienerin sein wollte, alles, was Tenar von ihr verlangte. Tenar war sich durchaus nicht sicher, was sie von Tante Moos verlangen wollte, die in ihren Augen unberechenbar, unzuverlässig, unverständlich, jähzornig, unwissend, verschlagen und schmutzig war. Aber Moos verstand sich mit dem verbrannten Kind. Vielleicht war es Moos, die diese Veränderung in Therru bewirkte, diese leichte Entspannung. Therru verhielt sich ihr gegenüber wie gegen jedermann: stumpf, teilnahmslos, willenlos, vergleichbar einem unbelebten Ding, einem Stein. Aber die alte Frau ließ nicht locker und schmeichelte ihr, lockte sie und bestach sie mit kleinen Süßigkeiten und Schätzen. »Komm mit, Herzchen, komm mit Tante Moos! Komm mit, und Tante Moos zeigt dir so etwas Schönes, wie du es noch nie gesehen hast …«
Die Nase der Alten ragte über ihren zahnlosen Mund und die dünnen Lippen hinaus, sie hatte eine kirschkerngroße Warze auf der Backe, ihre Haare waren ein grauschwarzes Gezottel aus Zauberknoten und wirren Strähnen, und sie strömte einen Geruch wie ein Fuchsbau aus, so stark und weittragend, tief und vielschichtig. »Komm mit in den Wald, Herzchen!«, sagten die alten Hexen in den Märchen, die man den Kindern auf Gont erzählte. »Komm mit, und ich zeige dir etwas Wunderschönes!« Und dann steckte die Hexe das Kind in den Backofen und buk es braun und aß es auf, oder sie warf es in den Brunnen, wo es für alle Zeit herumhüpfte und kläglich quakte, oder sie ließ es hundert Jahre in einem großen Stein schlafen, bis der Königssohn kam, der magische Prinz, und den Stein mit einem Wort sprengte, die Jungfrau mit einem Kuss erweckte und die böse Hexe totschlug.
»Komm mit, Herzchen!« Und sie nahm das Kind mit auf die Felder und zeigte ihm ein Lerchennest im grünen Gras, nahm Therru mit ins Moor, um Weißes Weihkraut, wilde Minze und Blaubeeren zu sammeln. Sie musste das Kind nicht in einen Backofen stecken oder in ein Scheusal verwandeln oder in einen Stein bannen. Dies alles war schon geschehen.
Sie war freundlich zu Therru, doch es war eine schmeichelnde Freundlichkeit, und wenn sie zusammen waren, schien sie viel auf das Kind einzureden. Tenar wusste nicht, was Moos ihm erzählte oder beibrachte, ob sie es zulassen sollte, dass die Hexe dem Kind irgendwelche Sachen in den Kopf setzte. Schwach wie Frauenzauber, böse wie Frauenzauber, hatte sie hundertmal sagen hören. Und sie hatte es selbst erlebt, dass die Hexenkunst solcher Frauen wie Moos oder