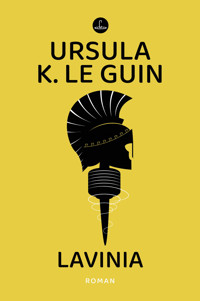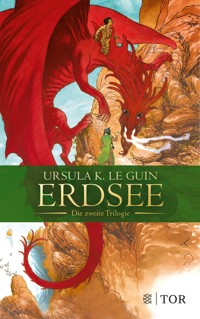37,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 37,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Carcosa
- Sprache: Deutsch
Die Kesh, Überlebende einer Katastrophe, durch die halb Kalifornien im Meer versunken ist, leben im Tal der Na, einem Napa Valley der Zukunft. Sie verfügen über moderne Technologie, nutzen diese aber nur insoweit, wie sie ihrer bescheidenen Art zu leben und zu wirtschaften dient. Mehr als alles andere zählen bei ihnen der Respekt für das Miteinander von Tier und Mensch und ein wohlüberlegter, sorgsamer Umgang mit der Erde. Die Hinterlassenschaft einer Wirtschaftsform, die zur Zerstörung der Zivilisation geführt hat, verfolgt die Kesh jedoch weiter; ganze Gebiete sind kontaminiert, vieles leidet an genetischen Veränderungen. Die Frage nach gedeihlichen Lebensformen durchzieht alles, was sie tun und denken. Angelegt als phantastisches Projekt einer Archäologie der Zukunft ist Immer nach Hause eine einzigartige Sammlung von Fundsachen: Mythos und Historie, Dichtung und Drama, Erzählung, Information und Lied, aufgelesen aus einer Zukunft in unbekannter Ferne – von einer Autorin auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft zu einer schlüssigen Vision verwoben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1209
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Aus dem amerikanischen Englisch
übersetzt von Matthias Fersterer, Karen Nölle & Helmut W. Pesch
Impressum
Titel der Originalausgabe: Always Coming Home
Erstmals erschienen 1985 bei Harper and Row in New York
Die Arbeit der Übersetzer:innen am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
© 1985 by Ursula K. Le Guin
© der Übersetzung 2023 by Matthias Fersterer, Karen Nölle & Helmut W. Pesch
© der Illustration auf Vor- und Nachsatz 2019 by Patrick H. Wynne
© dieser Ausgabe 2023 by Carcosa Verlag, Wittenberge
Alle Rechte vorbehalten
Published by arrangement with the Ursula K. Le Guin Estate // Die vorliegende Übersetzung folgt der 2019 innerhalb der Library of America in New York erschienenen, von der Autorin durchgesehenen und erweiterten Ausgabe // Verlag und Herausgeber danken dem Nachlassverwalter Theo Downes-Le Guin sowie Christian Dittus bei der Literaturagentur Paul & Peter Fritz für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit // Die Übersetzer und die Übersetzerin danken dem Deutschen Übersetzerfonds für die großzügige Unterstützung ihrer Arbeit // Auf Seite 860 findet sich ein Pfad zur Musik und zu den Gedichten der Kesh
Carcosa Verlag ist ein verschwistertes Imprint von
Memoranda Verlag | Hardy Kettlitz | Ilsenhof 12 | 12553 Berlin
www.carcosa-verlag.de | www.memoranda.eu
Lektorat: Hannes Riffel
Korrektorat: Anne-Marie Wachs
Umschlaggestaltung: s.BENeš [www.benswerk.com]
Layout & Satz: Hardy Kettlitz
ISBN: 978-3-910914-00-1 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-910914-01-8 (E-Book)
INHALT
Eine Anmerkung vorweg9
Das Wachtellied12
Hin zu einer Archäologie der Zukunft13
ERZÄHLSTEIN, Erster Teil17
Der Serpentin-Codex59
Schautafel der Neun Häuser70
Wo es liegt67
Pandora in Sorge darum, was sie tut: das Muster71
EIN PAAR GESCHICHTEN …72
Ein paar Geschichten, mündlich vorgetragen an einem Abend 72
Shahugoten 76
Die Hüterin 78
Gedörrte Mäuse 81
Dira 83
GEDICHTE, Erste Abteilung88
Sterben im Tal102
Pandora sitzt am Fluss117
VIER AMOUREN118
Der Müller 119
Verschollen 122
Der mutige Mann 126
An der Orlu-Quelle 130
GEDICHTE, Zweite Abteilung136
VIER HISTORIEN146
Alte hasserfüllte Frauen 146
Ein Krieg gegen die Schweineleute 155
Die Ortschaft Chumo 161
Probleme mit den Baumwollleuten 162
Pandora wendet sich, in Sorge darum, was sie tut, aufgewühlt an die Lesende175
STADT UND ZEIT177
Die Stadt 177
Ein Loch in der Luft 183
Großer Mann und kleiner Mann 186
Anfänge 190
Zeit im Tal 193
ERZÄHLSTEIN, Zweiter Teil206
DRAMATISCHE WERKE241
Eine Anmerkung zur Bühne im Tal 241
Der Hochzeitsabend in Chukulmas 241
Der Schreihals, die rote Frau und die Bären 253
Tabetupah 259
Das fiedrige Wasser 262
Chandi 268
Pandora findet, in Sorge darum, was sie tut, einen Weg durch die Straucheichen ins Tal282
Den Mond tanzen285
GEDICHTE, Dritte Abteilung295
ACHT LEBENSERZÄHLUNGEN307
Die Bahn 308
Sie-hört-zu 309
Junko 311
Die helle Leere des Windes 315
Weißbaum 317
Die Geschichte des dritten Kindes 320
Der Hund an der Tür 324
Die Seherin: Flirre vom Serpentin in Telina-na erzählt ihr Leben 326
EINIGE KURZE TEXTE AUS DEM TAL353
Eule, Kojotin, Seele 353
Person und Selbst 354
Eine Liste mit Dingen, die in vier Tagen gebraucht werden 355
Krähen, Gänse, Steine 356
Die schwarze Käferseele 358
Lob der Eichen 359
Worte/Vögel 359
Den Katzen hier ist das egal 360
Pandora unterhält sich mit der Archivarin der Bibliothek der Madronenhütte in Wakwaha-na363
GEFÄHRLICHE LEUTE367
Eine Anmerkung zum Roman 367
Zweites Kapitel 368
Pandora sanft zum geneigten Leser390
ERZÄHLSTEIN, Dritter Teil391
Nachrichten über das Kondorvolk 433
Über eine Versammlung der Krieger wegen 438
GEDICHTE, Vierte Abteilung445
Von den Leuten der Häuser der Erde im Tal 463
DER HINTERE TEIL DES BUCHS466
Die langen Namen der Häuser468
Einige der anderen Leute des Tals474
I. Tiere des Obsidian 474
II. Tiere des Blauton 483
Verwandtschaft488
Hütten, Gesellschaften, Künste496
Was die Leute im Tal trugen500
Was sie aßen504
Musikinstrumente der Kesh513
Landkarten520
Der Welttanz524
Der Sonnentanz534
Über die Bahn544
Ein paar Anmerkungen zu medizinischen Praktiken547
Ein Traktat über Praktiken556
Spiele558
Einige generative Metaphern562
Drei Gedichte von Pandora565
An der Küste leben, Energie und Tanzen567
Liebe573
Lesen und Schreiben574
Das Kesh-Alphabet 577
Die Modi von Erde und Himmel581
Anmerkung und Schaubild zu Erzählformen582
Gesprochene und geschriebene Literatur584
Pandora nicht mehr in Sorge590
Wörterbuch592
Zahlwörter 593
Stotterlied623
ANHANG625
Pandora besucht die Kesh erneut und kehrt mit neuen Texten zurück (Le Guins Erweiterungen von 2017)626
Gefährliche Leute (vollständiger Roman) 627
Einige Kesh-Meditationen 674
Bluthüttenlieder 677
Kesh-Syntax 687
Weitere Schriften mit Bezug zu Immer nach Hause693
Mays Löwe 694
Navna: Das Flussfließen, von Intrumo aus Sinshan702
Essays703
Welten bauen 703
Ein nicht-euklidischer Blick auf Kalifornien als kalten Ort in spe 706
Die Tragetaschentheorie des Erzählens 732
Text, Stille, Vortrag 739
Legenden für ein neues Land 749
Die Entstehung von Immer nach Hause767
Indianische Onkel 788
KARTEN
1. In die Binnensee mündende Flüsse
2. Bekannte Völker und Orte im Umkreis der Kesh
3. Die Ortschaft Sinshan
4. Die Namen der Häuser von Sinshan
5. Die neun Ortschaften am Fluss I
6. Die neun Ortschaften am Fluss II
7. Einige der Wege um den Fluss Sinshan
8. Das Flusssystem der Sinshan
Die handgezeichnete Schrift des englischen Originals wurde für die deutsche Fassung der Karten typografisch nachempfunden.
Eine Anmerkung vorweg
Die Leute in diesem Buch könnten einst lang, lang nach unserer Zeit in Nordkalifornien gelebt haben werden.[1]
Der Hauptteil des Buchs besteht aus ihren Stimmen, die in Erzählungen und Lebensgeschichten, Schauspielen, Gedichten und Liedern für sich selbst sprechen. Wer sie liest, wird sich mit einigen unbekannten Begriffen abfinden müssen, aber am Ende alle verstehen. Als Romanschriftstellerin hielt ich es für das Beste, viele der erklärenden und beschreibenden Texte in die Anhänge im »hinteren Teil des Buchs« zu packen, wo diejenigen, die nur die Erzählung lesen wollen, sie ignorieren, und diejenigen, die Erklärungen mögen, sie finden können. Auch das beigefügte Glossar mag nützlich oder amüsant sein.
Die Schwierigkeit, aus einer Sprache zu übersetzen, die es noch nicht gibt, ist beträchtlich, sollte aber nicht überbewertet werden. Schließlich kann die Vergangenheit ebenso dunkel sein wie die Zukunft. Das alte chinesische Buch namens Daodejing ist Dutzende Male ins Englische übersetzt worden, und selbst die Chinesen müssen es in jedem Zyklus des dynastischen Wandels wieder neu ins Chinesische übersetzen, aber keine Übersetzung kann uns das Buch schenken, das Laozi (den es vielleicht nie gegeben hat) geschrieben hat. Wir haben nur das Daodejing, das es hier, jetzt gibt. Das Gleiche gilt für Übersetzungen von Literatur aus der (oder einer) Zukunft. Die Tatsache, dass sie noch nicht geschrieben wurde, das bloße Fehlen eines zu übersetzenden Texts macht keinen wesentlichen Unterschied. Was war und was sein könnte, liegt, wie Kinder, deren Gesichter wir nicht sehen können, in den Armen der Stille. Alles, was wir jemals haben, ist hier, jetzt.
[1] Der erste Satz – The People in this book might be going to have lived a long, long time from now in Northern California – stellt nicht nur uns Übersetzende, sondern auch denkerische und grammatikalische Konventionen auf eine harte Probe. Als Archäologin und Kulturanthropologin kann die Erzählerin sich qua Profession nur in der Vergangenheitsform äußern, allerdings liegt ihr Forschungsgegenstand in der fernen Zukunft, sodass hier das Futur II auf das ethnografische Perfekt trifft. Wir haben uns entschieden, den Satz eng an der Grammatik des englischen Originals entlang zu übersetzen und dabei die Geschenke, die die deutsche Sprache bereithält – etwa das sowohl auf Vergangenes wie Zukünftiges verweisende Wörtchen »einst« –, aufzugreifen. Durch die abenteuerlich anmutende Verschränkung der Zeitformen, die, vom Scharnier der Gegenwart ausgehend, eine Doppelspirale andeutet, ist vom ersten Satz an diese Frage in Ursula K. Le Guins Roman implizit enthalten: »Was werden wir getan haben, damit einmal ein gutes Leben sei?« A. d. Ü.
IMMER NACH HAUSE
Illustratorin: Margaret Chodos-Irvine
Geomant: George Hersh
Kartenzeichnungen von der Verfasserin
Das Wachtellied
Aus dem Sommertanz.
In den Feldern am Fluss
aus den Wiesen am Fluss
aus den Feldern am Fluss
in den Wiesen am Fluss
laufen zwei Wachteln
Zwei Wachteln laufen
zwei Wachteln steigen
laufen zwei Wachteln
steigen zwei Wachteln
aus den Wiesen am Fluss
Hin zu einer Archäologie der Zukunft
Wie die geduldige Wissenschaftlerin sich fühlt, wenn die unförmigen Büschel und die kaum erkennbaren Mulden unter den Disteln und dem Gestrüpp Gestalt annehmen und klar zu erkennen geben: Das war die äußere Umfriedung – hier das Tor – dort der Kornspeicher! Hier werden wir graben und hier, und dann will ich mir das buckelige Hangstück anschauen … Wie ihr die Augen aufgehen, wenn beim Sandsieben eine dünne Scheibe durch die Finger gleitet, mit einem Daumenstrich gereinigt wird und, in die spröde Bronze eingeprägt, den gehörnten Gott zeigt! Wie sehr beneide ich sie um ihre Schaufeln, Siebe und Maßbänder, um all ihre Werkzeuge und ihre klugen, erfahrenen Hände, die berühren und halten, was sie finden! Nicht lange, denn natürlich wird sie es dem Museum übergeben, aber für einen Moment hat sie es tatsächlich in Händen gehalten.
Ich habe endlich die Siedlung gefunden, die ich suchte. Nachdem ich über ein Jahr an einigen falschen Stellen gegraben und mich an einige fixe Ideen geklammert hatte – zum Beispiel, dass sie von einer Mauer umgeben sein müsse, mit einem Tor –, studierte ich ein weiteres Mal die Höhenlinien meiner Karte der Gegend, als es mir so langsam und sicher aufging wie die Sonne selbst, dass der Ort hier war, zwischen den Bächen, die ganze Zeit schon unter meinen Füßen. Und dass es nie eine Mauer gegeben hatte; wozu, um alles in der Welt, hätten sie eine Mauer gebraucht? Was ich für das Tor gehalten hatte, war die Brücke über den Zusammenfluss der beiden Wasserläufe. Und die Sakralbauten und der Tanzplatz lagen nicht in der Mitte des Ortes, denn die Mitte ist das Scharnier, sondern drüben an ihrem Arm der Doppelspirale, dem rechten Arm natürlich, dort auf der Weide unterhalb der Scheune. Und so ist es, und so ist es.
Aber ich kann nicht einfach dort losgraben und hoffen, das gewölbte Bruchstück eines Dachziegels zu finden, den schillernden Fuß eines Weinkelchs, die Keramikkappe einer Solarbatterie oder eine kleine Münze aus kalifornischem Gold. Dieselbe Münze – denn Gold rostet nicht –, die in Placerville gewogen und in Frisco für Huren oder Grundbesitz ausgegeben wurde, dann vielleicht eine Weile als Ehering diente, dann in einem Tresor versteckt wurde, tiefer als die Mine, aus der sie kam, bis sich alles Sicherheitsdenken als sinnlos erwies und sie nun, rund dieses Mal, in eine Sonne mit gewellten Strahlen verwandelt, in Ehren einem kundigen Handwerker gegeben wurde: Nein, die werde ich nicht finden. So etwas gibt es hier nicht. Diese kleine goldene Sonne wohnt, wie die Kesh sagen, nicht in den Häusern der Erde. Sie wohnt in der Luft, in der Wildnis, die hinter Tag und Nacht liegt, den Häusern des Himmels. Mein Gold ist in den Scherben des zerbrochenen Topfes am Ende des Regenbogens. Grab dort! Was wirst du finden? Samen. Samen von wildem Hafer.
Ich kann durch den wilden Hafer und die Disteln wandern, zwischen den Häusern der kleinen Ortschaft, die ich gesucht habe: Sinshan. Ich kann über das Scharnier zum Tanzplatz gehen. Dort, etwa an der Stelle, wo jetzt die große Weißeiche steht, wird einmal das Obsidianhaus sein, im Nordosten; nicht weit davon das Blauton, in den Hang gegraben, im Nordwesten; näher bei mir, zur Mitte hin, das Serpentin, das Haus der vier Himmelsrichtungen; dann Rot- und Gelblehm an einer Biegung, die zum Bach hinabführt, im Südosten und Südwesten. Sie werden diese Wiese entwässern müssen, wenn sie die Heyimas so bauen, wie ich sie mir vorstelle, unterirdisch, sodass nur die pyramidenförmigen Dächer mit ihren Lichtgaden und die verzierten Enden der Zugangsleitern oben herausschauen. Das kann ich klar und deutlich sehen. Mir sind hier alle Arten, mit dem geistigen Auge zu sehen, erlaubt. Ich kann hier auf dem alten Weidegrund stehen, wo es nichts gibt als Sonne und Regen, wilden Hafer und Disteln und wirren Bocksbart, wo kein Vieh, sondern nur Wild weidet – hier stehen und die Augen schließen und sehen: den Tanzplatz, die abgestuften Pyramidendächer, einen Mond aus gehämmertem Kupfer auf einer hohen Stange über dem Obsidian. Wenn ich lausche, höre ich dann Stimmen mit meinem inneren Ohr? Hast du, Schliemann, auf den Straßen Trojas Stimmen gehört? Wenn ja, dann warst auch du wirre. Die Trojaner waren alle seit dreitausend Jahren tot. Wer ist uns ferner, wer unerreichbarer, stummer – die Toten oder die Ungeborenen? Jene, deren Gebeine unter den Disteln, dem Staub und den Grabsteinen der Vergangenheit ruhen, oder jene, die schwerelos zwischen den Molekülen hindurchgleiten und dort weilen, wo an einem Tag ein Jahrhundert vergeht, beim Feenvolk, unter dem großen glockenförmigen Hügel der Möglichkeit?
Es ist völlig aussichtslos, sie durch Grabungen finden zu wollen. Sie haben keine Knochen. Die einzigen menschlichen Gebeine unter dieser Wiese wären die der Erstbesiedler, und sie haben hier weder Grabstätten errichtet noch Ziegel, Scherben, Mauern oder Münzen hinterlassen. Falls es hier eine Ortschaft gab, wäre sie aus dem gemacht gewesen, woraus die Wälder und Felder bestehen, und heute verschwunden. Man kann lauschen, aber alle Worte ihrer Sprache sind verklungen, restlos verklungen. Sie haben Obsidian bearbeitet, und der vergeht nicht; da unten am Rand des Flugplatzes eines reichen Anwohners war eine Werkstatt, und dort lassen sich noch haufenweise abgeschlagene Splitter aufklauben, auch wenn seit Jahren niemand mehr eine vollständige Spitze gefunden hat. Andere Spuren haben sie nicht hinterlassen. Sie hielten ihr Tal mit leichter Hand in Besitz, bewegten sich mit leichtem Schritt darin. Auch jene anderen, nach denen ich suche, werden so gelebt haben.
Der einzige Weg, sie zu finden, die einzige hier praktikable Archäologie, ist nach meinem Dafürhalten folgende: Nimm dein Kind oder Enkelkind auf den Arm, einen Säugling, noch kein Jahr alt, und gehe hinunter zum wilden Hafer auf der Wiese unterhalb der Scheune. Stelle dich unter die Eiche am letzten Ausläufer des Hügels über dem Bach. Verharre schweigend. Vielleicht wird das Kind dort etwas sehen oder eine Stimme hören oder mit jemandem sprechen, jemandem von zu Hause.
Die kleine Winzerei von Sinshan
ERZÄHLSTEIN
Erster Teil
Erzählstein[2] ist mein Letztname. Ich habe ihn selbst gewählt und angenommen, weil ich eine Geschichte zu erzählen habe, darüber, wohin ich gegangen bin, als ich jung war; aber jetzt gehe ich nirgendwohin, sondern sitze wie ein Stein auf einer Stelle an diesem Ort in diesem Tal. Ich bin dorthin gekommen, wohin ich ging.
Mein Haus ist das Blauton, mein Haushalt das Hochaltan in Sinshan.
Meine Mutter hieß Ammer, Weide und Asche. Der Name meines Vaters, Abhao, bedeutet im Tal »Töter«.
In Sinshan werden Kinder oft nach Vögeln benannt, da diese Boten sind. Im Monat, bevor meine Mutter mich gebar, kam jede Nacht eine Eule in die Gairga-Eichen vor den Fenstern auf der Nordseite von Haus Hochaltan und sang dort das Eulenlied; darum lautete mein Erstname Nordeule.
Hochaltan ist ein altes Anwesen, solide gebaut, mit großen Räumen; Skelett und Gebälk sind aus Mammutbaum, die Wände aus verputzten Lehmziegeln, die Fenster aus klarem Glas in kleinen quadratischen Scheiben, und der Fußboden ist aus Eichenholz. Die Balkone von Hochaltan sind breit und schön. Die Urgroßmutter meiner Großmutter war die Erste, die in unseren Räumlichkeiten im ersten Stock unter dem Dach wohnte; als die Familie größer wurde, belegte sie das ganze Stockwerk, aber meine Großmutter war die Einzige ihrer Generation, und so lebten wir nur in den beiden westlichen Zimmern. Wir hatten nicht viel zu geben. Wir konnten zehn wilde Olivenbäume und einige andere Bäume auf dem Sinshan-Kamm und ein Saatbeet auf der Ostseite von Wakyahum nutzen, und auf einer der Parzellen am Bach südöstlich des Lehmhügels bauten wir Kartoffeln, Mais und Gemüse an, aber wir nahmen uns viel mehr Mais und Bohnen aus den Vorratshäusern, als wir gaben. Meine Großmutter Unverzagt war Weberin. Als ich ein kleines Kind war, hatten wir keine Schafe in der Familie, und sie tauschte den größten Teil dessen, was sie webte, für neue Wolle ein. In meiner allerersten Erinnerung flogen die Finger meiner Großmutter auf dem Webstuhl hin und her, und jedes Mal blinkte ein silberner Halbreif an ihrem Handgelenk unter dem roten Ärmel auf.
Das Zweite, woran ich mich erinnere, ist, wie ich eines Wintermorgens im Nebel zur Quelle unseres Baches hinaufstieg. Es war das erste Mal, dass ich als Blautonkind Wasser für das Neumond-Wakwa schöpfte. Mir war so kalt, dass mir die Augen tränten. Die älteren Kinder lachten mich aus und sagten, ich hätte mit meinen Tränen das Wasser verdorben. Ich glaubte ihnen und fing an zu weinen, weil ich das Wasser verdorben hatte. Meine Großmutter leitete das Ritual und sagte mir, dass das Wasser in Ordnung sei, und ließ mich den Mondkrug bis in den Ort zurück tragen, aber ich heulte und schniefte die ganze Zeit, weil mir kalt war und ich mich schämte und der Krug mit dem Quellwasser kalt und schwer war. Ich kann diese Kälte und Nässe und das Gewicht noch jetzt in meinem Alter spüren und die toten Arme der schwarzen Manzanitas im Nebel sehen und die Stimmen lachen und reden hören, vor mir und hinter mir auf dem steilen Weg neben dem Bach.
Ich gehe dort, ich gehe dort,
ich gehe, wo ich ging,
weinend am Wasser.
Er geht dort, er geht dort,
der Nebel am Wasser.[3]
Ich habe nicht lange geweint, vielleicht nicht lange genug. Der Vater meiner Mutter sagte: »Wer erst weint, lacht später; wer erst lacht, weint später.« Er war ein Serpentinmann aus Chumo und war dorthin zurückgegangen, um bei der Familie seiner Mutter zu wohnen. Für meine Großmutter war das in Ordnung. Sie sagte einmal: »Mit meinem Mann zu leben ist wie ungewässerte Eicheln zu essen.« Aber sie ging von Zeit zu Zeit nach Chumo hinunter, um ihn zu besuchen, und er kam und wohnte im Sommer, wenn die Sonne Chumo im Talgrund wie einen Zwieback ausdörrte, mit uns zusammen in den Hügeln. Seine Schwester Grüntrommel war eine berühmte Sommertänzerin, aber seine Familie gab nie etwas. Er sagte, sie seien arm, weil seine Mutter und seine Großmutter in den letzten Jahren alles gegeben hätten, um die Sommertänze in Chumo aufzuführen. Meine Großmutter sagte, sie seien arm, weil sie nicht gerne arbeiteten. Vielleicht hatten beide recht.
Die einzigen anderen Menschen aus meiner engeren Familie lebten in Madidinou. Die Schwester meiner Großmutter war dorthin gezogen, und ihr Sohn hatte dort eine Rotlehmfrau geheiratet. Wir besuchten sie oft, und ich spielte mit meiner Kusine und meinem Vetter zweiten Grades, einem Mädchen namens Pelikan und einem Jungen namens Hopfen.
Als ich klein war, lebten wir mit Himpis, Hühnern und einer Katze. Unsere Katze war schwarz ohne den kleinsten weißen Fleck, ein anmutiges und manierliches Geschöpf und eine großartige Jägerin. Die Kätzchen, die sie warf, tauschten wir gegen Himpis ein, und so hatten wir eine Zeit lang einen großen Stall voller Himpis. Ich kümmerte mich um sie und die Hühner und hielt die Katze von den Gehegen und Ställen unter der Veranda fern. Als ich anfing, die Tiere zu hüten, war ich noch so klein, dass ich Angst vor dem grünschwänzigen Hahn hatte. Er wusste das und rannte immer mit ruckendem Hals schimpfend auf mich los, und ich kletterte über die Trennwand in das Gehege der Himpis, um ihm zu entkommen. Die Himpis kamen heraus, setzten sich hin und pfiffen. Sie waren mir ein Trost, mehr als die kleinen Katzen. Ich lernte, ihnen keine Namen zu geben und sie nicht lebend zum Essen herzugeben, sondern ihnen vorher schnell den Hals umzudrehen, denn manche Menschen töten Tiere ohne Rücksicht und Geschick und bereiten ihnen Angst und Schmerzen. Als eines Nachts ein Schäferhund Amok lief, in das Gehege eindrang und alle Himpis bis auf ein paar Junge totbiss, weinte ich so sehr, dass es sogar meinem Großvater genügte. Danach konnte ich monatelang mit keinem Hund reden. Aber für meine Familie war es gut, denn die Leute des Schäferhunds gaben uns als Entschädigung für den Verlust unserer Himpis ein trächtiges Schaf. Das Schaf brachte Zwillingslämmer zur Welt, und so wurde meine Mutter wieder Schäferin, und meine Großmutter hatte Familienwolle zum Spinnen und Weben.
Himpi
Ich erinnere mich nicht daran, Lesen und Tanzen gelernt zu haben; meine Großmutter brachte es mir bei, bevor ich sprechen und laufen konnte. Mit fünf begann ich morgens mit den anderen Blautonkindern zum Heyima zu gehen, und später wurde ich von den Lehrenden im Heyima und in den Blut-, Eichen- und Maulwurfshütten unterwiesen; ich lernte die Salzreise; ich ging kurz bei der Dichterin Zorn und lange bei der Töpferin Tonsonne in die Lehre. Ich war nicht schnell im Lernen und dachte nie daran, eine Schule in einem der großen Orte zu besuchen wie einige andere Kinder aus Sinshan. Ich lernte gerne im Heyima, als Teil eines geordneten Ganzen, das größer war als mein begrenztes Wissen und in dem ich von Gefühlen der Angst und Wut Erleichterung fand, die ich ohne Hilfe nicht verstehen oder überwinden konnte. Aber ich habe nicht so viel gelernt, wie es mir vielleicht möglich gewesen wäre, sondern hielt mich immer zurück und sagte: »Das kann ich nicht.«
Einige Kinder nannten mich, ob aus Bosheit oder Unwissenheit, Hwikmas, »Halbhaus«. Ich hörte auch Leute über mich sagen: »Sie ist eine Halbperson.« Ich verstand es auf meine eigene Weise, und zwar als Beleidigung, da mir zu Hause niemand erklärte, was es damit auf sich hatte. Ich hatte nicht den Mut, im Heyima Fragen zu stellen oder dorthin zu gehen, wo ich vielleicht etwas über Dinge außerhalb des Ortes Sinshan hätte erfahren und beginnen können, das Tal als Teil eines Ganzen und zugleich als Ganzes zu sehen. Da weder meine Mutter noch ihre Mutter von ihm sprach, wusste ich in den ersten Jahren meines Lebens über meinen Vater nur, dass er von außerhalb des Tals gekommen und wieder fortgegangen war. Das bedeutete für mich lediglich, dass ich keine Vatersmutter, kein Vaterhaus hatte und daher eine Halbperson war. Ich hatte noch nicht einmal vom Kondorvolk gehört. Ich hatte acht Jahre gelebt, als wir das erste Mal zu den heißen Quellen von Kastoha-na gingen, um das Rheuma meiner Großmutter zu lindern, und dort, wo die Menschen zusammenkamen, erstmals Kondormänner sahen.
Diese Reise will ich erzählen. Es war eine kleine Reise vor vielen Jahren. Eine Reise durch die stille Luft.
Wir standen eines Morgens, etwa einen Monat nach dem Welttanz, noch im Dunkeln auf. Ich gab der schwarzen Katze Sidi, die alt wurde, etwas Fleisch, das ich für sie aufgehoben hatte. Ich dachte mir, sie würde gewiss Hunger kriegen, während wir weg waren, und das hatte mir tagelang keine Ruhe gelassen. Meine Mutter sagte zu mir: »Du isst das. Die Katze fängt sich, was sie braucht!« Meine Mutter war streng und sah die Dinge nüchtern. Meine Großmutter sagte: »Das Kind gibt seiner Seele Nahrung. Lass es gut sein.«
Wir löschten das Feuer im Kamin und ließen die Tür für die Katze und den Wind einen Spalt offen. Unter den letzten Sternen gingen wir die Treppe hinunter; die Häuser sahen in der Dämmerung wie Hügel aus, dunkel. Draußen auf dem Gemeinplatz schien es heller zu sein. Wir überquerten das Scharnier und gingen zum Blauton-Heyima. Dort wartete Muschel auf uns; sie war Mitglied der Medizinhütte und hatte die Beschwerden meiner Großmutter behandelt, und sie waren alte Freunde. Sie füllten das Wasserbecken und sangen gemeinsam die Rückkehr. Als wir zum Tanzplatz kamen, begann es hell zu werden. Muschel begleitete uns zurück über das Scharnier und durch den Ort, und nachdem wir die Brücke über die Sinshan überquert hatten, hockten wir uns alle dort unter die immergrünen Eichen zum Pinkeln und sagten lachend: »Gehen ist gut! Bleiben ist gut!« So machten es früher die Menschen im Unteren Tal, wenn sie auf eine Reise gingen, aber heute erinnern sich nur noch die Alten daran. Dann ging Muschel wieder zurück, und wir zogen weiter, vorbei an den Scheunen und zwischen den Bächen, über die Felder von Sinshan. Der Himmel über den Hügeln begann sich gelb und rot zu färben; wo wir waren, in der Mitte, waren die Wälder und Hügel grün; hinter uns erhob sich blau und dunkel der Sinshan-Berg. So gingen wir, vom Arm des Lebens gehalten.[4] In der Luft, in den Bäumen und auf den Feldern sangen Vögel. Als wir zum Amiou-Pfad kamen und nach Nordwesten abbogen, auf den Großmutterberg zu, ließen die südöstlichen Berge den Sonnenrand los, weiß. Jetzt gehe ich in diesem Licht in diese Richtung.
Meine Großmutter Unverzagt war an diesem Morgen guter Dinge und gut zu Fuß, und sie sagte: »Lasst uns bei unserer Familie in Madidinou vorbeischauen.« So gingen wir weiter der Sonne entgegen, den Sinshan-Fluss entlang, wo die heimischen Wildgänse und Enten in großer Zahl in den Sumpfgebieten schnäbelten und schnatterten. Ich war natürlich schon oft in Madidinou gewesen, aber diesmal wirkte der Ort ganz anders auf mich, da ich auf einer Reise war, die noch weiter führen sollte. Ich fühlte mich ernst und wichtig und wollte nicht mit meinen Rotlehmverwandten spielen, obwohl es die Kinder waren, die ich am liebsten hatte. Meine Großmutter stattete ihrer Schwiegertochter und dem Stiefvater ihrer Enkelkinder – ihr Sohn ist vor meiner Geburt gestorben – einen Besuch ab, und dann setzten wir unseren Weg fort, durch die Pflaumen- und Aprikosenpflanzungen zur Alten Geraden Straße.
Ich hatte mit meinen Madidinou-Verwandten schon früher die Alte Gerade Straße überquert, aber jetzt sollte ich sie entlanggehen. Ich kam mir wichtig vor, empfand aber auch Ehrfurcht und flüsterte bei den ersten neun Schritten Heya. Es hieß, die Straße sei das älteste Menschenwerk im ganzen Tal, und niemand wusste, wie lange es sie schon gab. Teile davon verliefen tatsächlich schnurgerade, aber dann wand sie sich auch zum Fluss hinunter und kehrte wieder zur Geraden zurück. Im Staub waren Spuren zu sehen, von Schafsklauen, Eselshufen, Hundepfoten, genagelten Schuhen, nackten menschlichen Füßen, so viele Spuren, dass ich dachte, es müssten die Spuren all derer sein, die seit fünfzigtausend Jahren auf dieser Straße gegangen waren. Am Straßenrand standen große Taleichen, die vor dem Wind schützten und Schatten spendeten, und an manchen Stellen Ulmen, Pappeln oder riesige weiße Eukalyptusbäume, die so groß und verwachsen waren, dass sie älter aussahen als die Straße; aber sie war so breit, dass nicht einmal die Morgenschatten sie ganz bedeckten. Ich dachte, sie sei so breit, weil sie so alt war, aber meine Mutter erklärte mir, sie sei breit, weil die großen Herden aus dem Oberen Tal darauf zu den Salzgraswiesen an der Mündung der Na getrieben wurden, nach dem Welttanz hinunter und nach dem Grastanz wieder hinauf, und dass manche dieser Herden aus tausend und mehr Schafen bestanden. Der Abtrieb war schon lange vorbei, und wir trafen nur noch auf ein paar Mistkarren, die Nachhut der Herde, mit einer Horde dreckiger und wilder Burschen aus Telina, die Mist für die Felder sammelten. Sie riefen uns alle möglichen Scherze zu, und meine Mütter antworteten lachend, aber ich verbarg mein Gesicht. Es waren noch andere Reisende auf der Straße, und jedes Mal, wenn sie uns grüßten, verbarg ich mein Gesicht, aber sobald sie vorbei waren, blickte ich ihnen nach und stellte so viele Fragen: Wer sind sie? Woher kommen sie? Wohin gehen sie? – dass Unverzagt anfing, über mich zu lachen und mich zu necken.
Weil ihr die Beine wehtaten, gingen wir langsam, und weil für mich alles neu war, erschien mir der Weg ungemein lang, aber am Vormittag kamen wir durch die Weinberge nach Telina-na. Ich sah, wie sich der Ort am Ufer der Na erhob, die großen Scheunen, die Mauern und Fenster ihrer Häuser zwischen den Eichen, die Dächer der Heyimas, hoch gestaffelt, rot und gelb um den von Bannern gesäumten Tanzplatz, ein Ort wie eine Weintraube, wie ein Fasan, reich, kunstvoll, erstaunlich, schön.
Der Sohn der Halbschwester meiner Großmutter lebte in Telina-na in einem Rotlehmhaushalt, und diese Familie hatte uns eine Nachricht geschickt, wir sollten unterwegs bei ihnen einkehren. Telina war so viel größer als Sinshan, dass ich dachte, es hätte kein Ende, und der Haushalt war so viel größer als unserer, dass ich dachte, auch der hätte kein Ende. Eigentlich wohnten nur sieben oder acht Leute im Erdgeschoss des Hartschlackehauses, aber ständig kamen und gingen andere Verwandte und Freunde, und es gab so viel Arbeit und Reden und Kochen und Bringen und Holen, dass ich dachte, dieser Haushalt müsse der wohlhabendste der Welt sein. Sie hörten, wie ich meiner Großmutter zuflüsterte: »Guck mal! Sie haben sieben Kochtöpfe!« Darüber mussten alle lachen. Zuerst schämte ich mich, aber sie wiederholten immer wieder, was ich gesagt hatte, und lachten so freundlich, dass ich anfing, Dinge zu sagen, um sie noch mehr zum Lachen zu bringen. Nachdem ich gesagt hatte: »Dieser Haushalt ist riesig, wie ein Berg«, sagte Rebe, die Frau meines Halbonkels: »Dann komm und bleib eine Weile bei uns in diesem Berg, kleine Nordeule. Wir haben sieben Töpfe, aber keine Tochter. Wir könnten eine brauchen!« Sie meinte es ehrlich; sie war das Zentrum allen Gebens und Nehmens und Fließens, ein Mensch voller Großmut. Aber meine Mutter verschloss die Ohren vor diesen Worten, und meine Großmutter lächelte nur schweigend.
An diesem Abend führten mich meine Rotlehmverwandten, die beiden Söhne von Rebe und einige andere Kinder des Haushalts durch Telina-na. Hartschlacke ist eines der inneren Häuser linker Hand vom Gemeinplatz. Auf dem Platz in der Ortsmitte fand ein Pferderennen statt, was mir als ein Wunder erschien, da ich mir nicht einmal im Traum einen Gemeinplatz vorgestellt hätte, der groß genug für ein Pferderennen war. Ich hatte auch noch nicht viele Pferde gesehen; in Sinshan gab es Eselsrennen auf einer Kuhweide. Der Kurs führte linksherum um den Platz, dann kam eine Wende, und dann ging es rechtsherum wieder zurück, um das Heyiya-if zu bilden. Die Menschen standen auf den Balkonen und auf den Dächern, mit Öl- und Batterielampen, wetteten und tranken und schrien, und die Pferde rannten durch Schatten und blinkende Lichter, wendeten flink wie Schwalben, und die Reitenden kreischten und schrien. Auf einigen Balkonen auf der rechten Seite des Platzes sangen die Leute und brachten sich in Stimmung für den Sommertanz.
»Zwei Wachteln laufen.
Zwei Wachteln steigen …«
Drüben am Tanzplatz wurde auch unten im Serpentin-Heyima gesungen, aber wir kamen nur auf dem Weg zum Fluss dort vorbei. Unten zwischen den Weiden, wo die Lichter des Ortes matt zwischen den Zweigen hindurchblinkten, hatten sich Paare abgesondert, um ein wenig ungestört zu sein. Wir Kinder schlichen durch das Weidengestrüpp und suchten nach ihnen, und wenn wir ein Paar fanden, schrien meine Kusinen. »Schwanz, da schau doch, Sand im Loch!«, oder machten ungehörige Geräusche, und das Paar sprang fluchend auf und jagte uns, aber wir stoben auseinander und rannten davon. Wenn meine Kusinen das jede warme Nacht so machten, dürfte es in Telina keinen großen Bedarf an Verhütungsmitteln geben. Als wir müde wurden, gingen wir zurück ins Haus, aßen kalte Bohnen und legten uns auf den Balkonen und Veranden schlafen. Die ganze Nacht hörten wir die Leute von gegenüber das Wachtellied singen.
Am nächsten Morgen machten wir drei uns früh auf den Weg, aber nicht vor Tagesanbruch und einem guten Frühstück. Als wir auf der gewölbten Steinbrücke die Na überquerten, hielt meine Mutter meine Hand. Das tat sie nicht oft. Ich dachte, sie täte es, weil es heilig war, den Fluss zu überqueren. Inzwischen glaube ich, dass sie Angst hatte, mich zu verlieren. Sie dachte, sie sollte mir erlauben, bei diesen reichen Verwandten in diesem reichen Ort zu bleiben.
Als wir Telina-na hinter uns gelassen hatten, sagte ihre Mutter zu ihr: »Vielleicht den Winter über, Weide?«
Meine Mutter schwieg.
Ich machte mir keine Gedanken darüber. Ich war glücklich und redete den ganzen Weg nach Chumo von den wunderbaren Dingen, die ich in Telina-na gesehen und gehört und getan hatte. Die ganze Zeit, während ich redete, hielt meine Mutter meine Hand.
Als wir in Chumo ankamen, merkten wir kaum, dass wir dort waren, weil die Häuser so verstreut und unter Bäumen versteckt lagen. Wir sollten die Nacht dort in unserem Heyima verbringen, aber zuerst besuchten wir den Mann meiner Großmutter, den Vater meiner Mutter. Er hatte bei einigen seiner Gelblehmverwandten in einem einstöckigen Haus unter Eichen ein eigenes Zimmer mit Blick auf den Bach. Es war schön dort. Sein Zimmer, wo er auch arbeitete, war groß und klamm. Bis dahin hatte ich meinen Großvater immer unter seinem Mittelnamen – Töpfer – gekannt, aber er hatte seinen Namen geändert: Er sagte, wir sollten ihn Moder nennen.
Ich fand den Namen verrückt, und da ich noch vom Lachen der Familie in Telina über meine Witze ganz aufgeplustert war, sagte ich ziemlich laut zu meiner Mutter: »Stinkt er?« Meine Großmutter hörte es und sagte: »Sei still. Das ist kein Grund zum Scherzen.« Ich schämte mich, aber meine Großmutter schien mir nicht böse zu sein. Als die anderen Leute des Hauses in ihre Zimmer gegangen und wir mit meinem Großvater allein waren, sagte sie zu ihm: »Was ist das für ein Name, den du da angenommen hast?«
Er sagte: »Ein wahrer Name.«
Er sah anders aus als im Sommer zuvor in Sinshan. Er war schon immer ein düsterer und mürrischer Mann gewesen. Nichts war ihm jemals recht, und niemand machte je etwas richtig außer ihm selbst, obwohl er nie viel tat, weil es nie der richtige Zeitpunkt war. Jetzt sah er immer noch finster und grimmig aus, tat sich aber wichtig. Er sagte zu Unverzagt: »Es hat keinen Sinn, zu den heißen Quellen zu gehen, um Heilung zu finden. Du solltest besser zu Hause bleiben und denken lernen.«
»Wie lernt man das?«, fragte sie.
Er sagte: »Du musst lernen, dass deine Beschwerden und Wehwehchen nur Denkfehler sind. Dein Körper ist nicht real.«
»Und ob er das ist«, sagte Unverzagt, und sie lachte und schlug sich auf die Hüften.
»So?«, sagte Moder. Er hielt ein Holzpaddel hoch, mit dem er die Außenseite der großen Tongefäße glättete, die er herstellte. Das Paddel war aus Olivenholz geschnitten, so lang wie mein Arm und handbreit. Er hielt es in seiner Rechten, bewegte die linke Hand darauf zu und führte es durch seine Linke. Das Paddel glitt durch Muskeln und Knochen hindurch wie ein Messer durch Wasser.
Unverzagt und Weide betrachteten entgeistert das Paddel und die Hand. Er forderte sie auf, dasselbe mit sich machen zu lassen. Sie zögerten, aber ich war neugierig und wollte, dass man mir weiter Aufmerksamkeit schenkte, also hielt ich den rechten Arm hoch. Moder reckte das Paddel und fuhr damit zwischen Handgelenk und Ellbogen durch meinen Arm. Ich spürte den sanften Strich des Paddels; es fühlte sich an wie eine Kerzenflamme, wenn man einen Finger hindurchführte. Ich musste vor Überraschung lachen. Mein Großvater sah mich an und sagte: »Diese Nordeule würde sich gut bei den Kriegern machen.«
Es war das erste Mal, dass ich dieses Wort hörte.
Unverzagt sagte, und ich konnte erkennen, dass sie wütend war: »Vergiss es. Deine Krieger sind alle Männer.«
»Sie kann einen heiraten«, sagte mein Großvater. »Wenn es so weit ist, kann sie den Sohn von Schaftot heiraten.«
»Du kannst dir deine toten Schafe sonst wohin stecken!«, sagte Unverzagt, was mich wieder zum Lachen brachte, aber Weide fasste sie am Arm, um sie zu beruhigen. Ich weiß nicht, ob meine Mutter Angst vor der Autorität hatte, die ihr Vater an den Tag legte, oder vor einem Streit zwischen den beiden; jedenfalls stellte sie zwischen ihnen wieder Ruhe her. Wir tranken ein Glas Wein mit meinem Großvater, und dann gingen wir mit ihm zum Tanzplatz von Chumo und zum Blauton-Heyima. Dort übernachteten wir im Gästezimmer. Ich schlief zum ersten Mal unter der Erde. Ich mochte die Ruhe und die Stille der Luft, war sie aber nicht gewohnt, wachte immer wieder auf und lauschte und konnte erst wieder einschlafen, wenn ich das Atmen meiner Mutter hörte.
Es gab noch ein paar andere Leute, die Unverzagt in Chumo besuchen wollte, wo sie gelebt hatte, als sie das Weberhandwerk erlernte, und so verließen wir den Ort erst gegen Mittag. Wir wanderten an der nordöstlichen Seite des Flusses durch das enger werdende Tal, und die Straße verlief zwischen Obstgärten mit Oliven-, Pflaumen- und Nektarinenbäumen und terrassierten Hügeln, die mit Weinreben bepflanzt waren. Ich war dem Berg noch nie so nah gewesen, er füllte mein ganzes Blickfeld aus. Als ich zurückschaute, konnte ich den Sinshan-Berg nicht mehr sehen; seine Form hatte sich verändert, oder er wurde von anderen Bergen im Südwesten verdeckt. Das beunruhigte mich. Schließlich sprach ich meine Mutter darauf an, die meine Angst verstand und mir versicherte, der Berg werde, wenn wir nach Sinshan zurückkehrten, dort sein, wo er hingehörte.
Nachdem wir den Hammelbach überquert hatten, konnten wir oben in den Hügeln über dem Tal Chukulmas erkennen. Der Feuerturm, erbaut aus farbigen Steinen, rot, orange und gelblich-weiß, so fein gemustert wie ein Korb oder eine Schlange, war nicht zu übersehen. In den gelben Weidegründen am Fuß der Hügel, zwischen den Waldausläufern, grasten Rinder. Auf dem eng begrenzten, flachen Talgrund gab es viele Weinkellereien und Scheuern zum Trocknen von Obst, und die Streuobstwiesenleute aus Chukulmas waren dabei, Sommerlauben aufzustellen. Am Ufer der Na ragten zwischen den Eichen dunkle Mühlen empor, deren Räder ein Geräusch machten, das schon von Weitem zu hören war. Wachteln ließen ihren dreistufigen Ruf erschallen, Lerchen stiegen von den Feldern auf, und hoch oben kreisten Bussarde am Himmel. Das Sonnenlicht war klar, die Luft still.
Meine Mutter sagte: »Heute ist ein Tag des Neunten Hauses.«
Meine Großmutter sagte nur: »Ich bin froh, wenn wir in Kastoha sind.« Seit wir Chumo verlassen hatten, war sie still und hinkte ein wenig.
Vor den Füßen meiner Mutter lag eine Feder auf dem Weg, die grau gestreifte, blaue Flügelfeder eines Hähers. Sie war die Antwort auf das, was sie gesagt hatte. Meine Mutter hob sie auf und behielt sie in der Hand, als sie weiterging. Sie war eine kleine Frau, mit rundem Gesicht und zartgliedrigen Händen und Füßen. An diesem Tag ging sie barfuß, bekleidet mit einer alten Wildlederhose und einem ärmellosen Hemd, das Haar geflochten, einen kleinen Rucksack auf dem Rücken und eine blaue Feder in der Hand. So geht sie im Sonnenlicht in der stillen Luft dahin.
Von den westlichen Hügeln her legten sich, als wir nach Kastoha-na kamen, Schatten über das Tal. Unverzagt sah die Dächer über den Streuobstwiesen und sagte: »Aha, da ist Omas Fut!« So nannten die Alten früher Kastoha, weil es zwischen den gespreizten Beinen des Bergs liegt. Als ich den Namen zum ersten Mal hörte, hatte ich mir den Ort als eine Höhle zwischen Tannen und Mammutbäumen vorgestellt, eine dunkle, geheimnisvolle Höhle, aus der der Fluss fließt. Als wir über die Na-Brücke kamen und ich sah, dass es ein großer Ort wie Telina-na war, nur noch größer, mit Hunderten von Häusern und mehr Menschen, als ich auf der ganzen Welt vermutet hatte, begann ich zu weinen. Vielleicht war es die Scham, die mich zum Weinen brachte, weil ich sah, wie dumm ich gewesen war, zu meinen, dass ein Ort eine Höhle sein könnte; vielleicht war ich verängstigt oder ermüdet von allem, was ich in den Tagen und Nächten unserer Reise gesehen hatte. Unverzagt nahm meinen rechten Arm in ihre Hände, befühlte und betrachtete ihn. Das hatte sie nicht getan, nachdem Moder das Paddel hindurchgeführt hatte; darüber war überhaupt nicht mehr geredet worden. »Er ist ein alter Dummkopf«, sagte sie jetzt, »und ich auch.« Sie nahm den silbernen Halbmondreif ab, den sie immer trug, und schob ihn mir über die Hand auf den rechten Arm. »Da«, sagte sie. »Er wird nicht abfallen, Nordeule.«
Ihr Handgelenk war so dünn, dass der Reif für meinen Unterarm nur ein bisschen zu groß war; doch das war nicht das, was sie meinte. Ich hörte auf zu weinen. In der Herberge an den heißen Quellen schlief ich in dieser Nacht tief und fest, aber wusste die ganze Nacht im Schlaf, dass der Mond an meinem Arm war, unter meinem Kopf.
Am nächsten Tag sah ich zum ersten Mal die Kondore. Alles in Kastoha-na war mir fremd, alles war neu, alles war anders als zu Hause; aber sobald ich diese Männer sah, wurde mir klar, dass Sinshan und Kastoha ganz und gar eins waren und das hier etwas anderes.
Ich war wie eine Katze, die eine Klapperschlange riecht, oder wie ein Hund, der einen Geist sieht. Meine Beine wurden steif, und ich konnte die Luft an meinem Kopf spüren, weil meine Haare sich aufrichten wollten. Ich blieb stehen und flüsterte: »Was sind das für Leute?«
Meine Großmutter sagte: »Kondore. Hauslose Männer.«
Meine Mutter war neben mir. Sie trat unvermittelt vor und sprach die vier großen Männer an. Sie wandten sich ihr, geschnäbelt und geflügelt, zu und sahen auf sie herab. Ich spürte, wie meine Beine schwach wurden, und meine Blase drückte. Ich sah Mönchsgeier, die sich zu meiner Mutter hinunterbeugten, ihre roten Hälse, ihre spitzen Schnäbel ausstreckten und sie mit weiß umrandeten Augen anstarrten. Sie zogen ihr Dinge aus dem Mund und dem Bauch.
Meine Mutter kam zu uns zurück, und wir gingen weiter zu den heißen Quellen. Sie sagte: »Er war im Norden, im Vulkanland. Diese Männer sagen, dass die Kondore zurückkommen. Sie kannten seinen Namen, und als ich ihn nannte, sagten sie, er sei eine wichtige Persönlichkeit. Hast du gesehen, wie sie gelauscht haben, als ich seinen Namen nannte?« Meine Mutter lachte. Ich hatte sie noch nie so lachen hören.
Unverzagt sagte: »Wessen Namen?«
Weide sagte: »Den Namen meines Mannes.«
Sie hatten wieder angehalten und standen sich gegenüber.
Meine Großmutter zuckte mit den Achseln und wandte sich ab.
»Ich sage dir, er kommt zurück«, sagte meine Mutter.
Ich sah weiße Funken um ihr Gesicht, wie Glühwürmchen. Ich schrie auf, und dann begann ich mich zu erbrechen und kauerte mich auf den Boden. »Ich will nicht, dass es dich frisst!«, sagte ich immer wieder.
Meine Mutter trug mich auf dem Arm zurück in die Herberge. Ich schlief eine Weile, und am Nachmittag ging ich mit Unverzagt zu den heißen Quellen. Wir lagen lange im heißen Wasser. Es war bräunlich-blau und voller Schlamm und roch nach Schwefel, was anfangs sehr unangenehm war, aber sobald man hineingestiegen war, wollte man am liebsten ewig drin bleiben. Das Becken war flach, breit und lang, mit Rändern aus blau-grün glasierten Kacheln. Es gab keine Wände, nur ein hohes Dach aus Holz und verstellbare Wandschirme gegen den Wind. Es war wunderschön dort. Alle Leute waren zur Heilung gekommen und unterhielten sich flüsternd oder lagen allein im Wasser und sangen leise Heilgesänge. Das blau-braune Wasser verbarg ihre Leiber, sodass beim Blick auf das lange Becken nur Köpfe sichtbar waren, die auf dem Wasser ruhten und sich im Dunst, der über den heißen Quellen hing, an die Kacheln lehnten, einige mit geschlossenen Augen, andere singend.
Ich liege da, ich liege da,
ich liege, wo ich lag,
treibe im flachen Wasser.
Er treibt da, er treibt da,
der Nebel über dem Wasser.
Die Unterkunft an den heißen Quellen von Kastoha-na war einen Monat lang unser Zuhause. Unverzagt badete im Wasser und ging täglich zur Medizinhütte, um die Kupferschlange zu lernen. Meine Mutter ging allein auf den Berg, zur Quelle des Flusses, nach Wakwaha und auf den Spuren des Berglöwen weiter zum Gipfel.[5] Ein Kind konnte nicht den ganzen Tag im heißen Wasserbecken und in der Medizinhütte verbringen, aber ich hatte Angst vor den Plätzen des großen Ortes, wo sich die Leute drängten, und wir hatten keine Verwandten in den Häusern, also blieb ich hauptsächlich bei den heißen Quellen und half bei der Arbeit. Als ich herausfand, wo der Geysir war, ging ich oft dorthin. Ein alter Mann, der dort lebte und die Besucher über den Heya-Platz führte und die Geschichte der unterirdischen Flüsse sang, sprach immer mit mir und ließ mich ihm helfen. Er lehrte mich ein Schlamm-Wakwa, das erste Lied, das mir allein geschenkt wurde. Schon damals kannten nicht viele Leute dieses Lied, das sehr alt sein muss. Es hat eine alte Form und wird allein gesungen, zu einer Zweiton-Schlitztrommel, und der Text besteht größtenteils aus Matrixwörtern, sodass es sich nicht gut aufschreiben lässt. Der alte Mann sagte: »Vielleicht singen die Leute aus den Häusern des Himmels dieses Lied, wenn sie herkommen, um in den Schlammbädern zu baden.« An einer Stelle im Lied mitten in der Matrix tauchen die anderen Wörter auf und lauten:
Von den Rändern einwärts zur Mitte,
abwärts, aufwärts zur Mitte
kamen sie alle hier herein,
kommen sie alle hier herein.
Ich denke, der alte Mann hatte recht, und es ist ein Erdlied. Es war mein erstes Geschenk, und ich habe es vielen weitergegeben.
Da ich mich aus dem Ort fernhielt, sah ich keine Männer des Kondors mehr und vergaß sie. Nach einem Monat kehrten wir rechtzeitig nach Sinshan zurück, um die Sommertänze zu tanzen. Unverzagt ging es gut, und so gelangten wir an einem Vormittag bis nach Telina-na hinunter und am Abend weiter nach Sinshan. Als wir an der Brücke über den Sinshan-Fluss ankamen, sah ich alles verkehrt herum. Die Hügel im Norden waren dort, wo die südlichen Hügel sein sollten, die Häuser auf der rechten Seite waren dort, wo die Häuser zur Linken sein sollten. Selbst in unserem Haus war es so. Ich suchte alle Orte auf, die ich kannte, und alles war umgekehrt. Es war seltsam, aber ich genoss die Seltsamkeit, auch wenn ich hoffte, dass es nicht so bleiben würde. Als ich am Morgen aufwachte und Sidi mir ins Ohr schnurrte, war alles da, wo es hingehörte, Norden im Norden und links links, und ich habe die Welt nie wieder verkehrt herum gesehen oder nur für einen kurzen Moment.
Nachdem der Sommer zu Ende getanzt war, zogen wir in unsere Sommerlaube, und dort sagte Unverzagt zu mir: »Nordeule, in ein paar Jahren wirst du anfangen, zur Frau zu werden und wie eine Frau zu bluten. Letztes Jahr warst du nur ein Grashüpfer, aber jetzt bist du hier in der Mitte, in einer guten Zeit, in deinen Klarwasserjahren. Was möchtest du hier tun?«
Ich dachte einen Tag lang darüber nach und sagte ihr: »Ich möchte hinaufgehen und der Spur des Löwen folgen.«
Sie sagte: »Gut.«
Meine Mutter stellte keine Fragen und schwieg. Seit wir aus Kastoha-na zurückgekehrt waren, schien sie immer auf ein Wort zu horchen, in die Ferne zu lauschen, stillzuhalten.
Also machte mich meine Großmutter zum Aufbruch bereit. Neun Tage lang aß ich kein Fleisch, und die letzten vier der neun nahm ich nur rohe Kost zu mir, einmal täglich zur Mittagszeit, und trank viermal am Tag Wasser in vier Zügen. Am zehnten Tag erwachte ich früh, vor Sonnenaufgang. Ich stand auf und nahm den Beutel mit den Gaben. Unverzagt schlief, aber meine Mutter lag, glaube ich, wach. Ich flüsterte ihnen und dem Haus Heya zu und ging hinaus.
Unsere Sommerlaube stand auf einer Wiese oben in den Hügeln über dem Hartschluchtbach, etwa eine Meile flussaufwärts von Sinshan. Wir hatten mein ganzes Leben lang mit einer Familie von Obsidianleuten aus dem Chimbam-Haus jeden Sommer dort verbracht und gemeinsam unsere Schafe gehütet; auf den Hügeln es gab es gute Weideplätze für sie, und der Bach führte in den meisten Jahren bis zur Regenzeit durchgehend Wasser. Die Wiese hieß Gahheya, wegen des großen blauen Serpentin-Heyiya-Felsens an ihrem nordwestlichen Ende. Als ich fortging, kam ich an dem Gahheya-Felsen vorbei. Ich wollte anhalten und mit ihm sprechen, aber er sprach zu mir; er sagte: »Halt nicht an, geh weiter, steig hoch hinauf, ehe die Sonne kommt.« Also stieg ich über die hohen Hügel hinauf, in gemäßigtem Schritt, solange es noch dunkel war, und weiter im Laufschritt, als es hell wurde, und als sich der Erdbogen und der Sonnenbogen trennten, stand ich auf dem hohen Grat des Sinshan-Bergs. Ich sah Licht auf die Südostseite aller Dinge fallen und die Dunkelheit über das Meer hinschwinden.
Nachdem ich dort Heya gesungen hatte, wanderte ich von Nordwesten nach Südosten den Bergrücken entlang, folgte Hirschpfaden durch das Chaparral und suchte mir meinen eigenen Weg, wo das Unterholz unter den Tannen- und Kiefernwäldern spärlicher war. Ich ging nicht schnell, sondern sehr langsam, blieb immer wieder stehen und lauschte und suchte nach Hinweisen und Zeichen. Den ganzen Tag lang machte ich mir Sorgen darum, wo ich die Nacht schlafen würde. Ich lief kreuz und quer über die Bergkämme und dachte dabei ständig: »Ich muss einen guten Platz finden, einen guten Platz.« Kein Ort erschien mir gut. Ich sagte mir: »Es sollte ein Heya-Platz sein. Du wirst ihn erkennen, wenn du hinkommst.« Aber was ich im Kopf hatte, ohne mir dessen bewusst zu sein, waren der Puma und der Bär, wilde Hunde, Männer von der Küste, Fremde aus dem Strandgebiet. In Wirklichkeit suchte ich nach einem Versteck. Also wanderte ich den ganzen Tag, und jedes Mal, wenn ich irgendwo anhielt, zitterte ich.
Als ich bei Einbruch der Dunkelheit oberhalb der Quellen ankam, hatte ich Durst. Ich aß vier Samenpollenkugeln aus meinem Gabenbeutel, war aber nach dem Essen noch durstiger, und mir war ein wenig übel. Die Dämmerung war den Berg hinaufgekrochen, bevor ich den Platz gefunden hatte, den ich suchte; also war ich dort geblieben, wo ich war, in einer Mulde unter einigen Manzanita-Bäumen. Die Mulde schien mir Schutz zu bieten, und Manzanitas sind reines Heyiya. Lange blieb ich aufrecht sitzen. Ich versuchte, Heya zu singen, aber der Klang meiner Stimme so allein gefiel mir nicht. Schließlich legte ich mich hin. Jedes Mal, wenn ich mich irgendwie bewegte, riefen die trockenen Laubblätter: »Hört! Sie bewegt sich!« Ich versuchte stillzuliegen, aber die Kälte zwang mich immer wieder dazu, mich zusammenzurollen; es war kalt da oben, und der Wind trieb den Nebel vom Meer über die Berge heran. Nebel und Dunkelheit nahmen mir, obwohl ich immer wieder in die Nacht starrte, die Sicht. Das Einzige, was ich erkennen konnte, war die Tatsache, dass ich den Berg hatte besteigen wollen und erwartet hatte, alles richtig zu machen, den Spuren des Löwen zu folgen; stattdessen war ich zu nichts gekommen und den ganzen Tag vor Löwen weggelaufen. Das lag daran, dass ich nicht hergekommen war, um der Löwe zu sein, sondern um den Kindern, die mich eine Halbperson nannten, zu zeigen, dass ich besser war als sie, dass ich eine mutige und heilige Achtjährige war. Ich fing an zu weinen. Ich drückte mein Gesicht in den Boden zwischen den Blättern und weinte in die Erde, die Mutter meiner Mütter. So schuf ich mit meinen Tränen einen kleinen salzigen Schlammtümpel oben auf diesem kalten Berg. Und mir fiel das Lied ein, das mir der alte Mann am Geysir geschenkt hatte, das Schlamm-Wakwa, und ich sang es im Stillen. Das half mir ein bisschen. So ging die Nacht dahin. Durst und Kälte ließen mich nicht schlafen, und Müdigkeit ließ mich nicht wachen.
Sobald der Morgen graute, stieg ich vom Bergrücken hinunter, um Wasser zu finden, und kletterte durch dichtes Gebüsch in einen Talschluss hinab. Ich musste lange suchen, bevor sich mir eine Quelle darbot. Ich durchstreifte ein Labyrinth von Schluchten und verlor die Orientierung, und als ich wieder auf höheres Gelände kam, befand ich mich zwischen dem Sinshan-Berg und der Wächterin. Ich stieg weiter hinauf, bis ich einen großen, kahlen Vorberg erreichte, von dem aus ich zurückblicken und den Sinshan-Berg von der falschen Seite, der Außenseite, sehen konnte. Ich hatte das Tal hinter mir gelassen.
Ich wanderte den ganzen Tag so weiter wie am Vortag. Ich ging langsam und hielt oft an, aber mein Empfinden hatte sich verändert. Mein Kopf dachte nicht und war dennoch klar. Das Einzige, was ich mir sagte, war: »Halte dich möglichst auf einem Weg, der um die Wächterin herumführt, ohne viel auf oder ab zu gehen, damit du am Ende an diese kahle Stelle zurückkehrst.« Hier auf dem Hügel, wo der Wildhafer im Sonnenschein hellgelb leuchtete, herrschte ein gutes Gefühl. Ich dachte, ich würde sie wiederfinden. Also ging ich weiter. Alles, was mir begegnete, sprach ich mit Namen an oder indem ich Heya sagte – die Bäume: Tanne, Diggerkiefer, Rosskastanie, Redwood, Manzanita, Madrone und Eiche; die Vögel: Blauhäher, Schwanzmeise, Specht, Phoebetyrann und Bussard; die Blätter von Scheinheide, Buscheiche, Gifteiche und Bergweißdorn; die Gräser; einen Wapitischädel; Kaninchenkot; den Wind, der vom Meer wehte.
Dort drüben auf der Jagdseite gab es nicht viele Hirsche, die bereit waren, sich einem Menschen zu nähern. Wapitis sichtete ich fünf Mal und einmal einen Kojoten. Zu den Hirschen sagte ich: »Ich gebe euch meinen Segen, soweit ich das kann, ihr Sprachlosen, gebt mir euren Segen, soweit ihr das könnt!« Den Kojoten, ein Weibchen, nannte ich Sängerin. Ich habe mein Leben lang Kojoten gesehen, wie sie zur Ablammzeit herumschlichen und aus der Sommerlaube stahlen, und auch tote, als schmutziges Häuflein Fell, aber niemals eine Kojotin in ihrem Haus.
Die Kojotin stand zwischen zwei Weißkiefern, etwa zehn Schritte von mir entfernt, und sie kam näher, um mich besser in Augenschein zu nehmen. Den Schwanz um die Füße gelegt, setzte sie sich hin und sah mich an. Ich glaube, sie konnte sich nicht erklären, was ich war. Vielleicht hatte sie noch nie ein Kind gesehen. Vielleicht hatte sie, jung wie sie war, noch nie einen Menschen gesehen. Ich mochte ihr Aussehen, schlank und gepflegt, die Farbe von Wildhafer im Winter, mit hellen Augen. Ich sagte: »Sängerin! Ich werde deinen Weg gehen!« Sie saß da und sah mich an und schien zu lächeln, denn das Maul der Kojoten ist wie ein Lächeln; dann stand sie auf, streckte sich ein wenig und war fort – wie ein Schatten. Ich sah sie nicht gehen, also konnte ich auch nicht mit ihr gehen. Aber in jener Nacht sangen sie und ihre Familie die halbe Nacht lang Kojote-Wakwa in meiner Nähe. Der Nebel kam in jener Nacht nicht; die Dunkelheit blieb mild und klar, und am Himmel zeigten sich alle Sterne. Ich fühlte mich leicht, lag am Rand einer kleinen Lichtung unter alten Lorbeerbäumen und blickte auf die Muster der Sterne; ich begann zu schweben, dem Himmel anzugehören. So ließ Yowayo mich in ihr Haus ein.
Am nächsten Tag gelangte ich zurück auf den Wildhaferhügel, der mich die falsche Seite des Sinshan-Bergs sehen ließ, und dort leerte ich meinen Beutel und gab dem Ort meine Gaben. Ohne den Hügel zu überqueren, um den Kreis zu schließen, kehrte ich zurück in die Schluchten zwischen den Bergen, in der Absicht, den Sinshan-Berg von Südosten her zu umrunden und so das Heyiya-if zu vervollständigen. In den Schluchten verirrte ich mich wieder. Einem Bach folgte ich, weil es sich an seinem Rand einfacher gehen ließ und alle Seiten der Schlucht steil und von Gifteiche überwuchert waren. Ich stieg immer weiter abwärts und hatte keine Ahnung mehr, wo ich war. Man nennt diese Schluchten die alten Fuchshöhlen, aber niemand, den ich später fragte, ob Jäger oder Leute der Lorbeerhütte, hatte jemals den Ort gesehen, an den dieser Bach mich führte. Es war ein langer, dunkler Teich, in dem der Bach anscheinend zu fließen aufhörte. Um den Teich herum wuchsen Bäume, die ich sonst nirgendwo gesehen habe, mit glatten Stämmen und Ästen und dreieckigen, gelblichen Blättern. Das Wasser des Teichs war gesprenkelt und von diesen Blättern bedeckt. Ich steckte meine Hand ins Wasser und fragte es nach der Richtung. Ich spürte die Kraft darin, und sie machte mir Angst. Es war dunkel und still. Es war nicht das Wasser, das ich kannte, nicht das Wasser, das ich wollte. Es war schwer, wie Blut, und schwarz. Ich trank nicht davon. Ich hockte mich in den heißen Schatten unter den Bäumen am Rand des Teichs und suchte nach einem Zeichen oder einem Wort, das mir weiterhelfen könnte. Auf dem Teich kam etwas auf mich zu: ein Wasserläufer. Es war ein großer, der auf seinen blinkenden Tritten flink über die Haut des Wassers huschte. Ich sagte: »Ich gebe dir meinen Segen, soweit ich das kann, Sprachloser, gib mir deinen Segen, soweit du das kannst!« Das Insekt blieb noch eine Weile still dort stehen, wo Luft und Wasser sich trafen, an seinem Ort des Seins, und dann huschte es in den Uferschatten des Teichs. Das war alles. Ich stand auf, sang Heya-na-no, suchte mir einen Weg an der Gifteiche vorbei zur Felskante der Schlucht hinauf und gelangte dann durch die alten Fuchshöhlen zur Hinteren Schlucht und in der Spätnachmittagshitze wieder auf meinen eigenen Berg. Die Grillen zirpten wie tausend Glocken, und aus dem Wald erscholl von überallher das Geschrei und Geschimpfe der Blau- und Diademhäher. In dieser Nacht schlief ich unter Steineichen am Hang meines Bergs. Am nächsten Tag, dem vierten, machte ich mir Federstäbe aus den Federn, die auf meiner Wanderung zu mir gekommen waren, und aus Stöcken aus Steineiche, und an einer kleinen Sickerquelle zwischen Felsen und Wurzeln an einem Talschluss vollzog ich so viel von dem Quellen-Wakwa, wie ich kannte. Dann machte ich mich nach Hause auf. Ich erreichte Gahheya etwa um die Zeit, als die Sonne unterging, und kam zur dreiwandigen Sommerlaube. Weide war nicht da; Unverzagt saß im Freien am Herd und spann Wolle. »Na?«, sagte sie. »Vielleicht solltest du lieber erst mal baden.«
Ich wusste, dass sie sehr froh war, dass ich wohlbehalten wieder zu Hause war, aber sie lachte, weil ich vor lauter Eile, nach Hause zu kommen und zu essen, vergessen hatte, mich nach dem Wakwa zu waschen. Ich war ganz verschwitzt und dreckig.
Als ich zum Hartschluchtbach hinunterging, fühlte ich mich alt, als wäre ich länger als vier Tage fort gewesen, länger als der Monat in Kastoha-na, länger als die acht Jahre meines Lebens. Ich wusch mich im Bach und stieg in der Dämmerung wieder den Hang hinauf. Da war der Gahheya-Felsen, und ich ging zu ihm hin. Er sagte: »Berühre mich.« Das tat ich, und so kehrte ich heim. Ich wusste, dass mir an diesem seltsamen Ort mit dem Teich und dem Wasserläufer etwas zuteilgeworden war, das ich nicht begriff und vielleicht auch nicht begreifen wollte; aber das Scharnier meiner Wanderung war der goldene Hügel gewesen; die Kojotin hatte für mich gesungen; und solange meine Hand und der Felsen sich berührten, wusste ich, dass ich nicht fehlgegangen war, selbst wenn ich nichts Greifbares erreicht hatte.
Da ich nur eine Großmutter und einen Großvater im Tal hatte, hatte ein Blautonmann namens Neunpunkt sich angeboten, mir ein Neben-Großvater zu sein. Als ich knapp neun Jahre alt war, kam er aus seiner Sommerlaube in der Bärenbachschlucht herüber, um mir die Lieder der Väter beizubringen. Bald darauf kehrten wir mit ihm nach Sinshan zurück, um uns darauf vorzubereiten, das Wasser zu tanzen, während die Obsidianfamilie in Gahheya sich um die Schafe kümmerte. Es war das erste Mal, dass ich im Sommer in unseren Ort zurückkehrte. Außer Blautonleuten war kaum jemand dort. Während ich den ganzen Tag lang in dem weiten, leeren Ort Heyiya sang und verrichtete, begann ich zu spüren, wie sich meine Seele öffnete und zusammen mit den anderen Seelen der Tänzer ausbreitete, um die Leere zu füllen. Das Wasser strömte aus der Schale aus blauem Ton, und die Lieder waren Flüsse und Teiche in der großen Hitze des Sommers. Die anderen Häuser kamen aus ihren Sommerquartieren, und wir tanzten das Wasser. Weil in Tachas Touchas der Bach ausgetrocknet war, kamen die Leute von dort herauf, um mit uns zu tanzen, wobei diejenigen, die Verwandte hatten, zu ihnen gingen und die anderen auf den Feldern kampierten oder auf Veranden schliefen. Bei so vielen Menschen hörte der Tanz nie auf, und das Blauton-Heyima war so voller Gesang und Kraft, dass es, wenn man das Dach berührte, war, als berührte man einen Löwen. Es war ein großartiges Wakwa. Am dritten und vierten Tag des Tanzes hatten die Menschen in Madidinou und Telina vom Wasser in Sinshan gehört und gesellten sich hinzu. In der letzten Nacht waren die Balkone voller Menschen, und das Heyiya-if erfüllte den ganzen Tanzplatz, am Himmel tanzten im Südosten und Nordwesten die Hitzeblitze, man konnte die Trommeln nicht vom Donner unterscheiden, und wir tanzten den Regen bis hinab zum Meer und wieder hinauf zu den Wolken.