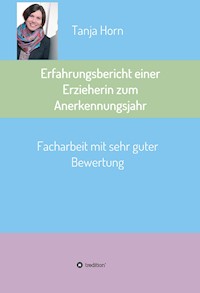
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Bei der hier angebotenen Facharbeit handelt es sich um einen originalen Erfahrungsbericht einer Erzieherin zum Anerkennungsjahr, der mit der Note Eins bewertet wurde. Er unterstützt angehende Erzieherinnen und Erzieher bei dem Anfertigen ihres eigenen Erfahrungsberichts zum Anerkennungsjahr, indem er ihnen verdeutlicht, wie der Bericht aufgebaut sein muss, welche Formkriterien einzuhalten sind und wie der Inhalt konkret zu gestalten ist. Probleme im Zusammenhang mit dem Erstellen einer Institutionsbeschreibung, dem Darstellen einer Handlungssituation oder der Projektplanung gehören damit nun der Vergangenheit an. Mit dieser Facharbeit steht einem erfolgreichen Erfahrungsbericht zum Anerkennungsjahr nichts mehr im Wege!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
www.tredition.de
Das Buch
Liebe angehende Erzieherin, lieber angehender Erzieher,
nun steht Ihnen Ihr letztes Ausbildungsjahr - das Anerkennungsjahr - bevor, das sowohl spannende Momente für Sie bereit hält, als auch einige Hürden, die es zu überwinden gilt. Eine dieser Hürden stellt der Erfahrungsbericht zum Anerkennungsjahr dar: Wie muss dieser aufgebaut sein, welche Formkriterien sind einzuhalten und wie ist der Inhalt konkret zu gestalten?
Mit Ihrem Bericht möchte die Autorin Ihnen beim Beantworten Ihrer Fragen behilflich sein und Sie so auf Ihrem Weg unterstützen und begleiten. Da es sich bei der vorliegenden Facharbeit um einen originalen Erfahrungsbericht handelt, erfahren Sie unmittelbar beim Lesen, was Sie beim Erstellen Ihres eigenen Berichts beachten müssen und worauf es Ihrer Lehrerschaft ankommt.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden kleine textliche Veränderungen vorgenommen.
Die Autorin
Tanja Horn wurde am 08.12.1983 in Völklingen geboren und lebt und arbeitet in Saarbrücken. Im Anschluss an ihr Studium der Pädagogik, das sie nach erfolgreich abgeschlossener Diplomvorprüfung im Jahr 2008 beendete, absolvierte sie die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin als Jahrgangsbeste. Im Dezember 2015 schließlich folgte nach 2-jähriger Weiterbildung der Abschluss zur Geprüften Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK).
Tanja Horn
Erfahrungsbericht einer Erzieherin zum Anerkennungsjahr
Facharbeit mit sehr guter Bewertung
www.tredition.de
© 2016 Tanja Horn
Umschlag, Illustration: Tanja Horn
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7345-2558-2
Hardcover
978-3-7345-2559-9
e-Book
978-3-7345-2560-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Erfahrungsbericht
zum Anerkennungsjahr in der Einrichtung X
- Von Ihr Name -
Es folgt eine Leerseite.
Name der Erzieherschule
Adresse
Telefonnummer
Anerkennungsjahr in der Einrichtung X im Zeitraum xx.xx.20xx-xx.xx.20xx- Erfahrungsbericht -
Ihr Name
Betreut durch Name Lehrer
Schuljahr 20xx/xx
Es folgt das Formular „Bericht über die fachpraktische Ausbildung“, das Sie von Ihrer Schule erhalten.
Dieses umfasst…
- den Zeitraum Ihres Anerkennungsjahres,
- Name und Anschrift der Einrichtung,
- das Thema Ihrer Projektarbeit und
- die jeweiligen Unterschriften von der Leitung Ihrer Praxisstelle, von Ihrer Praxisanleitung sowie der betreuenden Lehrperson Ihrer Erzieherschule.
Je nach Erzieherschule kann das Formular einen anderen Namen tragen.
Inhaltsverzeichnis
1. Strukturelle Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit
1.1 Institutionsbeschreibung
1.1.1 Name und Adresse der Einrichtung
1.1.2 Träger
1.1.3 Größe
1.1.4 Personalstruktur
1.1.5 Öffnungszeiten
1.2 Beschreibung des räumlichen und sozialen Umfeldes der Einrichtung
1.2.1 Lage der Einrichtung/Infrastruktur
1.2.2 Soziales Umfeld der Einrichtung/Einzugsgebiet der Kinder
2. Darstellung der pädagogischen Arbeit
2.1 Darstellung und Umsetzung der pädagogischen Konzeption der Einrichtung in der Einsatzgruppe
2.1.1 Darstellung der pädagogischen Konzeption der Einrichtung
2.1.2 Umsetzung der pädagogischen Konzeption der Einrichtung in der Einsatzgruppe
2.2 Darstellung einer Handlungssituation
2.3 Erörterung der aus der Handlungssituation abgeleiteten Erziehungsund Bildungsarbeit
3. Projektplanung
3.1 Darstellung der beobachteten Ausgangssituation
3.2 Überprüfung der beobachteten Situation auf ihre Bedeutsamkeit hinsichtlich der Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe
3.3 Vorstellung des Projektgedankens und Ideensammlung mit der Zielgruppe
3.4 Auswertung der Ideensammlung
3.5 Formulierung eines gemeinsamen Projektthemas oder einer Projektfrage mit Erläuterung des Vorhabens
3.6 Beschreibung der Arbeitsgruppe
3.7 Erstellung einer Projektskizze mit grobem Zeitraster
3.8 Theoretische Erarbeitung
3.9 Lernchancen
3.9.1 Ich-Kompetenz
3.9.2 Sozial-Kompetenz
3.9.3 Sach-Kompetenz
3.9.4 Lern-Kompetenz
4. Projektverlauf
4.1 Darstellung der Durchführung des Projekts mit Reflexionsphasen
5. Projektdokumentation
5.1 Kontinuierliche Dokumentation des Projektverlaufs
5.2 Präsentation
6. Elternveranstaltung zum Projektthema
7. Auswertung des Projekts
8. Literaturverzeichnis
9. Anlage
9.1 Elternbrief zur Vorstellung meiner Person
9.2 Fotos Klassenraum 1 und 2, Flur und Außengelände
9.3 Songtext und Noten zum Mitmachlied „Titel“
9.4 Internetfotos zu den Musikinstrumenten in Angebot 3
9.5 Klanggeschichte „Titel“
9.6 Bildkärtchen zu Angebot 4
9.7 Urkunden der Kinder über die erfolgreiche Teilnahme am Musikprojekt
9.8 Elternbrief zur Information über das Projekt und zum Einnehmen der Erlaubnis zur Teilnahme sowie zum Fotografieren
9.9 Elternbrief zur Materialbeschaffung bzgl. der Herstellung von Musikinstrumenten
9.10 Einladung zur Elternveranstaltung
9.11 Plakate zum Projekt
9.12 Namensschilder für die Elternveranstaltung
9.13 Bilder zur Elternveranstaltung
9.14 Ausarbeitung zu Angebot 4 meines Projekts - Klanggeschichte
1. Strukturelle Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit
1.1 Institutionsbeschreibung
1.1.1 Name und Adresse der Einrichtung
Die Einrichtung X befindet sich in Anschrift der Einrichtung.
1.1.2 Träger
Wie sich an dem Titel der Einrichtung erkennen lässt, ist die Kirche von England Träger der Grundschule, deren Wurzeln bis in das 3. Jahrhundert nach Christus reichen und welche christliche, römische und keltische Elemente in sich vereint. Prinzipiell befinden sich alle englischen Schulen in Trägerschaft der Kirche von England; man unterscheidet jedoch die sogenannten „founded schools“ von den „aided schools“. Bei den „founded schools“ handelt es sich um Schulen, in welche die Kirche investiert, wobei ein Teil des investierten Geldes im Rahmen einer religiösen Erziehung der Kinder zu nutzen ist. „Aided schools“ erhalten keine finanzielle Unterstützung von der Kirche, arbeiten jedoch sehr eng mit dieser zusammen. Die Einrichtung X ist eine solche „aided school“ und steht als Teil der Diözese von Ort in Kooperation mit der Kirche Y in Ort sowie der Kirche Z in Ort. Einmal wöchentlich nimmt ein Pfarrer am schulischen Gottesdienst teil und einmal im Monat findet der Gottesdienst in einer der zuvor genannten Kirchen statt. Zusätzlich haben die Kinder die Möglichkeit, einmal pro Woche an einem von der Kirche organisierten „after school club“ teilzunehmen, welcher auf dem christlichen Glauben basiert.
1.1.3 Größe
Das derzeitige Schuljahr 2010/11 besuchen insgesamt 414 Kinder im Alter von 4-11 Jahren, die auf 14 Klassen aufgeteilt sind. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Klasse liegt bei 29 Kindern. Die Klassen 1 und 2, mein Einsatzbereich, sind Bestandteil der Foundation Stage, in welcher die 4-5 Jährigen das Basiswissen erwerben, das sie für ihre weitere schulische Laufbahn benötigen. In Klasse 1 befinden sich derzeit 12 Jungen und 17 Mädchen, in Klasse 2 12 Jungen und 18 Mädchen. Key Stage 1 umfasst die Klassen 3 bis 6; Schüler dieser Stufe werden als „Infants“ bezeichnet und sind zwischen 5 und 7 Jahre alt. Die Klassen 7 bis 14 bilden Key Stage 2; die als „Juniors“ bezeichneten Schüler befinden sich im Alter von 7 bis 11 Jahren.
1.1.4 Personalstruktur
An der Grundschule insgesamt beschäftigt sind neben der Direktorin Name und ihrer Stellvertreterin Name 15 Lehrer/innen, 6 Gastlehrer/innen, 1 Geschäftsführer, 1 Sekretärin, 1 Verwaltungshelferin, 14 Lehrassistenten, 1 Hausmeister, 1 Assistent des Hausmeisters, 1 Reinigungskraft, 2 Köche, 4 Küchenhelfer und 6 Arbeitskräfte, welche die Kinder beim Mittagessen betreuen. In meiner Haupteinsatzgruppe, der Klasse 1, welche Bestandteil der Foundation Stage ist, arbeiten Ms. Name als einzige Lehrerin, die eine Vollzeitstelle innehat, 1 Lehrassistentin von 8:30 Uhr bis 15 Uhr und ein sogenannter „individual needs assistant“, die einen gehbehinderten Jungen zwischen 8:30 Uhr und 13 Uhr betreut und im Schulalltag unterstützt. Zum Personal der Klasse 2, in der ich ebenfalls häufig eingesetzt bin und welche eng mit Klasse 1 zusammenarbeitet, gehören neben 1 Lehrassistentin 2 Lehrerinnen, wobei Ms. Name montags sowie dienstags unterrichtet und Ms. Name Mittwoch bis Freitag.
1.1.5 Öffnungszeiten
Das Schulgebäude der Einrichtung X ist geöffnet Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 18 Uhr, Unterricht findet jedoch zwischen 8:45 Uhr und 15 Uhr statt. Nach Unterrichtsende haben die Schüler/innen die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis einen „after school club“ zu besuchen, um z. B. Fußball oder Basketball zu spielen oder am Wissenschaftsclub teilzunehmen.
1.2 Beschreibung des räumlichen und sozialen Umfeldes der Einrichtung
1.2.1 Lage der Einrichtung/Infrastruktur
Die Einrichtung X ist eine ländliche Schule und befindet sich in dem idyllischen Dorf Name. Ihre Lage ist besonders günstig, da sie von historischen und geographischen Naturschätzen wie dem Castle von Ort oder Sehenswürdigkeit sowie weitreichenden Feldern, Wiesen und Seen umgeben ist, die ergänzend zum Unterricht optimale Ausflugsziele darstellen und den Kindern die Möglichkeit bieten, beispielsweise verschiedene Tierarten genau zu beobachten. Die Einrichtung kann mittels öffentlicher Verkehrsmittel, sprich Bus und Bahn, leicht erreicht werden, und ist, da sie in einer Art Hinterhof liegt, von dem Lärm des fließenden Verkehrs vollständig abgeschirmt.
1.2.2 Soziales Umfeld der Einrichtung/Einzugsgebiet der Kinder
Ortsname, das Dorf in dem sich die Grundschule befindet, sowie sein Nachbarort Ortsname gehören zu den wohlhabenden Gegenden, Ortsname und Ortsname, die ebenfalls Teil des Einzugsgebietes der Kinder sind, dagegen zu den ärmeren Gebieten. Kinder, die aus den beiden zuletzt genannten Orten stammen, leben des Öfteren in Sozialwohnungen oder sind sogenannte „traveller Kinder“ - rumänischer oder englischer Herkunft -, die zusammen mit ihren Eltern in einem Wohnmobil leben und von Ort zu Ort reisen. Zudem stammen die Schüler/innen aus umliegenden Gebieten wie Ortsname oder Ortsname. Für die Auswahl der Schüler/innen ist die Kommune zuständig, welche Plätze nach einer festgelegten Reihenfolge vergibt. Priorität haben dabei behinderte Kinder, an zweiter Stelle stehen solche, die adoptiert wurden, an dritter Stelle diejenigen, deren Geschwister bereits einen Platz an der Schule erhalten haben und an letzter Stelle ist die Entfernung zur Schule ausschlaggebend. Meinen Einsatzbereich, die Klassen 1 und 2, besuchen 1 gehbehindertes und 1 adoptiertes Kind, 31 Kinder mit Geschwistern an der Schule und die übrigen Plätze wurden auf Grund der Entfernung zur Schule vergeben. In Klasse 1 stammen 3 Kinder aus Ort, 9 aus Ort, 4 aus Ort und 13 aus Ort; in Klasse 2 sind es 2 Kinder aus Ort, 6 aus Ort, 13 aus Ort und 7 aus Ort.
2. Darstellung der pädagogischen Arbeit
2.1 Darstellung und Umsetzung der pädagogischen Konzeption der Einrichtung in der Einsatzgruppe
2.1.1 Darstellung der pädagogischen Konzeption der Einrichtung
Der Unterricht an der Einrichtung X orientiert sich nicht an einem spezifischen pädagogischen Handlungskonzept, sondern basiert auf zwei von der Regierung festgelegten Lehrplänen, dem „Early Years Foundation Stage Curriculum“1 und dem „National Curriculum“2.
Das „Early Years Foundation Stage Curriculum“ ist für den Unterricht im ersten Schuljahr, dem sogenannten Reception oder Early Year, relevant und bereitet die Kinder auf das „National Curriculum“ vor. Es geht von vier, für die Arbeit mit den Kindern grundlegenden Prinzipien aus. Das erste Prinzip besagt, dass jedes Kind einzigartig ist, von Geburt an lernfähig und in der Lage, widerstandsfähig und selbstsicher zu sein. Zweitens können Kinder nur auf der Basis von aus Zuneigung und Sicherheit geprägten Beziehungen zu ihren Eltern und/oder einer Bezugsperson stark und unabhängig werden. Nach dem dritten Prinzip ist eine förderliche Umgebung von großer Bedeutung für die Entwicklung und das Lernen von Kindern. Der vierte und letzte Grundsatz besagt, dass Kinder sich auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Tempo entwickeln und lernen und alle Entwicklungs- und Bildungsbereiche sehr wichtig sind und miteinander in einem Zusammenhang stehen. Der Lehrplan für das Reception Year umfasst keine Fächer, wie dies beim „National Curriculum“ der Fall ist, sondern geht von 6 Entwicklungs- und Lernbereichen aus und gewährleistet somit eine ganzheitliche Bildung der Kinder. Ziel des ersten Lernbereiches „Personale, soziale und emotionale Entwicklung“ ist es, dass die Kinder ein positives Selbstbild entwickeln, lernen, andere zu respektieren und soziale Fähigkeiten sowie ein positives Verhältnis zum Lernen ausbilden. Der Bereich „Kommunikation, Sprache und Literacy-Erziehung“ bezieht sich auf die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, aber auch zuhören zu können, das Lesen und das Schreiben. Der dritte Bildungsbereich „Mathematische Grunderfahrungen“ umfasst nicht nur Zahlenlehre, sondern die Kinder sollen zudem lernen, Probleme zu lösen und ihren Verstand adäquat zu benutzen. Historische, geographische, naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen sammeln die Kinder in dem Lernbereich „Wissen über und Verstehen der Welt“. Im Bereich „Körperliche Entwicklung“ geht es um die Entwicklung der Grob- und Feinmotorik sowie die körperliche Fitness und Gesundheit. Ziel des letzten Bildungsbereiches „Kreativität“ schließlich ist es, künstlerische und musikalische Fähigkeiten auszubilden sowie kreatives Denken zu fördern.





























