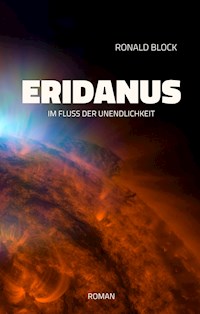
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mit über Zweihundert und dem Aussehen eines Mittdreißigers hat Tom Stone längst Familie und Freunde überlebt. In diesem Alter entschließt er sich, an der Mission zum zehneinhalb Lichtjahre entfernten Sonnensystem Epsilon Eridani teilzunehmen. Alle Vorbereitungen für die Expedition sind abgeschlossen. Über zweitausend Menschen sind bereit, um in einem gewaltigen Raumschiff auf diese Reise zu gehen. Da taucht plötzlich ein Mann auf, dessen anerzogener Hass auf Tom das gesamte Vorhaben zu einem Alptraum werden lässt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Teil 1: Die Erde
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Teil 2: Der blaue Planet
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil 3: Das unsichtbare System
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Teil 1
Die Erde
Kapitel 1
Flughafen Idlewild, New York 1. Juni 2158
„Pan American Airways bittet alle Passagiere des Fluges ,Clipper 701‘ nach Kairo zum Flugsteig B 25 in Terminal A. Ihr Flug ist jetzt zum Einsteigen bereit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord.“
Auf der Holografie im Wartesaal des New Yorker Flughafens Ildlewild verabschiedete sich ein Pärchen mittleren Alters mit einem sehr charmanten Lächeln. Die holografische Projektion, etwa vier Meter über den Köpfen der Reisenden, wechselte danach zu Filmen über die Weltwunder.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Jamie verträumt das Treiben auf dem Flughafen angeschaut.
Idlewild hatte sich zum weltgrößten Airport entwickelt − was die Anzahl der Starts und Landungen betraf. Flächenmäßig hatte er sich die letzten hundert Jahre nicht verändert. Er war diesbezüglich eher mittelgroß.
Fast eine Stunde saß sie bereits im Abfluggate. Startende und landende Flugzeuge hatten sie schon immer fasziniert. Besonders die neue Generation von Flugzeugen hatte es ihr angetan. Es begeisterte sie, mit welch kurzen Startbahnen diese Maschinen auskamen, um nach einer unglaublich schnellen Beschleunigungsphase in einem extrem steilen Winkel auf ihre Reiseflughöhe zu steigen.
Als sie wieder einer dieser Maschinen sehnsüchtig hinterhersah, kam die Abflugansage. Sofort war sie aus ihrem Sitz aufgesprungen.
Sie gehörte nicht zu denjenigen, die lässig sitzen blieben, um als letzte an Bord zu gehen, in dem festen Glauben: Wer als letzter kommt, ist der tollste Typ. Diese Charaktere, die sich auffallend laut lachend beim Champagnerschlürfen ständig umschauten, ob sie auch gesehen und bewundert werden, wird es wohl immer geben, dachte sie. Denn sie kannte diese Art Menschen ziemlich gut. Als Chefsekretärin der ISA, der International Space Administration, hatte sie in ihrem schönen New Yorker Büro am East River oft genug mit anmaßenden und arroganten Personen zu tun, die häufig einen sehr ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex besaßen.
Eigentlich taten ihr diese Individuen leid. Menschen, die ständig unter dem Druck standen etwas darstellen zu müssen, besser zu sein als andere, mehr zu besitzen als andere, teure Dinge zu besitzen und dann das Schlimmste: Werde ich auch genug beachtet? Findet diese Beachtung oder Bewunderung nicht statt, dann müssen sie auf andere Art und Weise auffallen.
Aber in diesem Moment hatte sie keinen Blick für andere Menschen. Seit ihrer Jugend träumte Jamie Davenport davon, einmal die Pyramiden zu sehen. Jetzt hatte sie die Gelegenheit endlich genutzt. Sie wollte einfach nur weg. Weg vom Alltag, weg von New York, weg von Tom. Sie würde rechtzeitig aus Ägypten zurück sein, um seinen großen Abflug mitzuerleben. Seinen Abflug für immer!
„J. D.“, so wurde sie im engeren Kollegenkreis genannt. Ihre besten Freunde nannten sie „Jam“. Als Tom sie das erste Mal „Jam“ nannte – das war vor einem Jahr, bei der Jubiläumsfeier der ISA –, war es um sie geschehen: Sie hatte sich in ihn verliebt. Mehrmals war es ihr gelungen, mit Tom auszugehen, aber nie hatte er sich ihr genähert. Schließlich ergriff sie die Initiative. Nach einem langen, unterhaltsamen Abend überredete sie ihn, mit in ihre Wohnung zu kommen. Sie nahm all ihren Mut zusammen und wollte wissen, warum er nicht zu mehr bereit sei. Er hatte sie angeschaut und gesagt:
„Ich habe zwei Frauen überlebt, mit denen ich verheiratet war. Ich habe meine Kinder und meine Enkel überlebt. Ich musste immer wieder von Menschen Abschied nehmen, die mir sehr nahe standen. Ich kann das nicht mehr: Mich verlieben, Verantwortung für eine Familie übernehmen, immer wieder Abschied nehmen. Deshalb habe ich mich auch für diese Expedition zur Verfügung gestellt. Ich möchte auf keinen Fall jemanden hier zurücklassen, der mich vermissen wird oder den ich vermissen werde. Jam, du bist eine bildschöne, intelligente Frau! Du wirst jemanden finden, der es wert ist. Ich kann es nicht sein!“
Danach bat sie ihn, zu gehen. Am nächsten Tag beantragte sie Urlaub mit dem Versprechen, rechtzeitig zum Abflug der Expedition zurück zu sein. Ihr Chef, Buck Copeland, willigte mit der Einschränkung ein, dass sie wenigstens zwei Wochen vor Abflug wieder im Büro erscheinen müsse. „Kein Problem!“, hatte sie ihm versprochen. Einen Tag später hatte sie die Koffer gepackt und war auf dem Weg nach Ägypten.
Jetzt saß sie im Boeing Space-Liner der Pan American Airways und würde in knapp drei Stundenin Kairo landen. Sie schaute aus dem Fenster und ein kindliches Grinsen erschien auf ihrem Gesicht, als der Space-Liner sie durch die enorme Beschleunigung in ihren Sitz presste, um gleich danach in einem steilen Winkel in den Himmel zu steigen.
Kairo 6. Juni 2158
Es war nun schon ihr fünfter Abend in Kairo. Sie hatte fast alle Sehenswürdigkeiten der Stadt aufgesucht: den Bazar Chan el-Chalili, die Muhammad Ali-Moschee, das Ägyptische Museum, das Museum des Arabischen Friedens, Rundfahrt auf dem Nil. Im Restaurant des Hotels Kairo-International saß sie entspannt im Außenbereich nur einen halben Meter entfernt vom träge dahinfließenden Nil. Die Schwüle des Tages war noch zu spüren, so hatte sie sich für ein schlichtes Sommerkleid entschieden. Sie wollte möglichst nicht auffallen.
Mit ihrem Cocktailglas in der Hand blickte sie verträumt auf den Nil mit all seinen glänzenden Lichtern entlang des Ufers und auf den Booten. Sie freute sich auf den nächsten Tag. Ihr Highlight hatte sie sich bis zum Schluss aufgehoben. Endlich würde sie die Pyramiden sehen.
Gerne hätte sie sich von Tom diese Monumente zeigen lassen. Verärgert über den Gedanken an ihn, nahm sie einen kräftigen Schluck aus ihrem Glas.
„Haben Sie schon gewählt, Ma’am?“
Jamie schaute den Kellner an und erschrak, als sie ihm in die Augen sah. Sein Blick war sodurchdringend, dass sie leicht verunsichert antwortete:
„Ich … hätte gerne die Mezze, bitte!“
„Sehr gerne, Ma’am!“, kam es freundlich zurück. Nur wenige Minuten später brachte er ihr die gewünschte Speise und Jamie genoss die arabischen Köstlichkeiten in dieser einmaligen Atmosphäre am Nil.
Als der Kellner später den Tisch abräumte, fragte er sie beiläufig nach dem Grund ihres Aufenthalts, woher sie käme, was sie noch beabsichtigte zu unternehmen und so weiter. Jamie Davenport hatte genug getrunken und war in der Stimmung zu reden.
Sie erzählte von ihrer Reise, ihren Erlebnissen, dass sie am nächsten Tag die Pyramiden sehen und damit ihren Jugendtraum endlich in Erfüllung gehen lassen würde. Dann berichtete sie von ihrem Beruf, ihrem Büro, ihrem Chef, ihren Mitarbeitern und schließlich von der Mission der ISA:
„Tja, und dann kam doch eines Tages Major Tom bei mir durchs Büro! Haben Sie schon von Major Tom gehört?“
„Ja!“, antwortete der Kellner. „Das ist doch der Mann, der …“
„Genau!“, unterbrach sie ihn. „Das ist der Mann, der mir mein Herz gebrochen hat, wegen dem ich jetzt hier sitze und mich ganz allein betrinke!“
Der Kellner bemerkte, dass sie eigentlich genug Alkohol konsumiert hatte. Er griff vorsichtig nach der Flasche auf ihrem Tisch, die noch zur Hälfte mit Wein gefüllt war. Aber Jamie war schneller! Sie schnappte die Flasche, schenkte sich ein und erzählte weiter:
„Wissen Sie eigentlich, wie der feine Major Tom wirklich heißt?“ Sie nahm wieder einen großen Schluck von ihrem Wein und fuhr fort: „Tom Stone heißt er! Aber das ist auch nicht sein richtiger Name! Wussten Sie das?“
Dem Kellner wurde dieses Gespräch jetzt unangenehm. Er begann, unauffällig das Geschirr abzuräumen.
„Sein richtiger Name ist: Thomas Stein!“
Das Poltern und Krachen des Geschirrs, das dem Kellner in diesem Augenblick vom Tablett rutschte und auf dem edlen Steinboden des Restaurants zerbarst, war weithin hörbar. Viele Gäste sowie auch das übrige Personal schauten verstört in seine Richtung.
„Ist schon gut! Ist meine Schuld!“, rief Jamie, während sie aufstand und leicht schwankend zum Ausgang ging. Kurz bevor sie das Restaurant verließ, drehte sich noch einmal kurz um:
„Tut mir leid! Genießen Sie den Abend!“
Dann verschwand sie durch die Tür. Dabei zog sie reflexartig ihren Kopf nach hinten, um nicht mit dem Türrahmen zu kollidieren.
Wie versteinert schaute der Kellner ihr eine ganze Weile nach. Dann legte er seine Schürze ab, ließ sie auf den Scherbenhaufen fallen und verließ Restaurant und Hotel.
Pyramiden von Gizeh 7. Juni 2158
Äußerst sanft und fast geräuschlos landete der Octocopter auf dem grünen Kreis mit einem großen, weißen „H“ in der Mitte. Dem Helipad, einem Copter-Landeplatz, auf einer kleinen Anhöhe gelegen, nur zweihundert Meter entfernt von der Cheops-Pyramide.
Jamie hatte ihre Sonnenbrille aufgesetzt, als sie das Fluggerät verließ. Ohne Pilot hatte dieser auf Flugrouten programmierte Octocopter achtzehn Passagiere sicher vom Hotel Kairo-International bis zu den Pyramiden geflogen. Sie war froh, dass sie früh aufgestanden war und sich für den ersten Flug nach Sonnenaufgang entschieden hatte. Die Temperatur war noch erträglich und nach dem gestrigen Abend war ein kühles Lüftchen sehr wohltuend. Von einer aufgetakelten, jungen Mitreisenden wurde Jamie arrogant von oben bis unten betrachtet. Anschließend verzog die Frau missmutig das Gesicht.
Jamie war der Blick keinesfalls entgangen. Sie drückte kurz ihre Sonnenbrille etwas nach unten, sodass sie über das Brillengestell hinweg die Person anschauen konnte und sagte:
„Also ich hatte einen wunderbaren Abend und eine sehr gute Nacht! Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen muss das bei Ihnen wohl genau umgekehrt gewesen sein!“, schob die Brille wieder vor ihre Augen und bewegte sich elegant Richtung Eingang der Cheops-Pyramide.
Der Ehemann der jungen Frau schaute Jamie schmunzelnd hinterher. Bereute dies aber sofort, nachdem ihm seine Frau ihren Handabdruck auf seiner linken Wange hinterlassen hatte.
Zwei Stunden später kam Jamie Davenport aus einem der unteren Gänge der Pyramide die Stufen herauf. Sie konnte das Tageslicht schon sehen. Einen Augenblick blieb sie stehen, um zu verschnaufen. Dabei blickte sie zurück, um diesen unheimlichen Gang noch einmal anzusehen, den sie gerade heraufgekommen war. Ein kurzer Schauer lief ihr über den Rücken.
Wie erstarrt blieb sie stehen, als sie plötzlich eine dunkle und etwas hallende Stimme hörte:
„Hat es Ihnen gefallen?“
Erschrocken blickte sie zur Seite. Sie versuchte, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Nach einem kurzen Moment entdeckte sie ein dunkles Gewölbe neben sich, konnte aber niemanden sehen.
„Wer ist da?“, fragte sie angespannt. Sie hörte, wie sich jemand näherte. „Hallo?“ Ihre Stimme zitterte. Dieses Bauwerk hatte wirklich etwas Unheimliches an sich.
„Verzeihen Sie, Ma’am! Ich bin es! Abdul, Ihr Kellner von gestern Abend!“
Jetzt sah sie die Umrisse des Mannes in dem fast schwarzen Gewölbe. Einen Augenblick später sah sie ihm in die Augen. Dieser Blick löste wieder ein leichtes Unbehagen bei ihr aus. Der dunkle Hintergrund verstärkte dieses Gefühl noch.
„Verzeihen Sie Ma’am, ich wollte ...“ er hielt kurz inne, um einen Lichtschalter zu betätigten, „... Sie nicht erschrecken!“
Jetzt konnte sie einen Gang hinter ihm ausmachen, der steil nach unten führte. Er schien endlos zu sein. Überall hatten sich durch die Feuchtigkeit lang herabhängende, dunkelgrüne Moose gebildet. Unzählige Nebengänge säumten seine beiden Seiten. Da diese Gänge unregelmäßig angelegt waren, wirkte das ganze nach unten führende Gebilde in dem gedämpften Licht wie ein verschimmelter Schweizer Käse.
Eines wusste Jamie sicher: Diese Gänge waren in keinem Pyramidenführer eingezeichnet! Und die hatte sie schon sehr lange gründlich studiert.
Jamie versuchte immer noch, sich innerlich zu beruhigen. Wieso tauchte Abdul plötzlich hier auf? Seine unheimlichen Augen! Dieser mysteriöse Gang! Die dunklen Nebengänge! Die Situation war irgendwie furchterregend!
Doch Jamie Davenport hatte im Laufe ihres Lebens gelernt, die Fassung zu bewahren.
„Oh, ist schon ok!“, begann sie zaghaft. „Aber was sind das für Gänge? Die sind mir unbekannt.“
„Die werden noch erforscht. Wir haben sie erst vor kurzer Zeit entdeckt. Sobald die Forschungen abgeschlossen sind, werden sie für die Öffentlichkeit freigegeben. Das wird aber bestimmt noch ein paar Jahre dauern!“
Abdul machte eine kurze Pause in der er, wie erhofft, ihren neugierigen Blick auffing. Dann versuchte er, sein teuflisches Werk zu beginnen:
„Wenn Sie niemandem etwas sagen, bin ich gerne bereit, Ihnen einen Teil dieser neu entdeckten Pyramidengänge zu zeigen.“
„Das würden Sie tun?“, fragte Jamie, die leicht verunsichert war, ob sie sich darauf einlassen sollte, weil er ihr doch etwas geheimnisvoll vorkam. − Aber schließlich siegte ihre Neugier:
„Versprochen! Kein Wort darüber! Zu niemandem!“
Abdul nickte kurz, drehte sich um und ging den endlos wirkenden Gang hinunter.
Jamie folgte ihm. Zurückhaltend und ein wenig unentschlossen. Doch ihre mutige Natur war stärker. Sie schaltete ihren Kommunikator ein und begann, auf dem Plan der Cheops-Pyramide Notizen zu machen.
Sein erleichtertes Grinsen konnte sie nicht sehen.
ISA-Hauptverwaltung, New York 25. Juni 2158
„Guten Tag! Sie sprechen mit dem Hotel Kairo-International! Was kann ich für Sie tun?“
Buck Copeland nahm die Sache jetzt selbst in die Hand, nachdem keiner seiner Mitarbeiter in den letzten achtundvierzig Stunden etwas über den Verbleib seiner Chefsekretärin in Erfahrung bringen konnte. In gut einer Woche würde die Expedition Eridanus starten und er wusste nicht, wo ihm der Kopf stand, bei all den Vorbereitungen, die noch zu treffen waren. Er verfluchte den Tag, an dem er Jamie Davenport den Urlaub genehmigt hatte.
„International-Space-Administration, New York, Buck Copeland mein Name. Ich hätte gerne gewusst, wann meine Mitarbeiterin, Miss Jamie Davenport, Ihr Hotel verlassen hat!“
In dem Hologramm über seinem Schreibtisch war eine in Hoteluniform gekleidete Araberin zu sehen.
„Guten Tag, Mr. Copeland! Ich werde Sie in diesem Fall lieber mit unserer Hotelmanagerin verbinden. Einen Augenblick, bitte!“
Jetzt wurden abwechselnd Bilder von Kairo und dem Hotel im Hologramm gezeigt. Buck Copeland klopfte ungeduldig mit seinen Fingern auf den Schreibtisch. Kurze Zeit später erschien die Projektion der Hotelmanagerin:
„Mr. Copeland! Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen sprechen zu dürfen, wenn auch der Anlass etwas Beunruhigendes hat.“
„Was wollen Sie damit sagen: ,Etwas Beunruhigendes‘?“ Buck Copeland konnte eine gewisse Nervosität nicht verbergen.
„Es ist so, Mr. Copeland, dass Miss Davenport vor etwas mehr als zwei Wochen von ihrem Ausflug zu den Pyramiden nicht zurückkam. Eine sofort angelegte Suchaktion ...“
„Vor über zwei Wochen?“, platzte es aus Copeland heraus. „Und Sie hielten es nicht für nötig, uns sofort zu informieren?“
„Verzeihen Sie, Mr. Copeland, aber wir hatten keinerlei Informationen über Angehörige, Freunde, Beruf oder Arbeitgeber von Miss Davenport! Wir hatten nur Informationen über ihre Heimatadresse, die wir auch kontaktierten. Allerdings ohne Erfolg! Wenn Sie mehr in Erfahrung bringen wollen, dann verbinde ich Sie gerne mit unserer internationalen Vermisstenstelle.“
„Tun Sie das!“, erwiderte Copeland knapp.
Aber auch die Vermisstenstelle konnte ihm keine weiterhelfende Information geben. Seine Chefsekretärin war einfach verschwunden.
Am nächsten Tag saß Jennifer Swanson am Schreibtisch der Chefsekretärin. Sie war noch sehr jung, gerade mal zwanzig, und völlig unerfahren. Daher schaute sie Buck Copeland mit großen, erwartungsvollen Augen an. Er hatte ihr tausend Dinge gesagt, die sie zu tun hätte. Aber von der Anordnung „Nur in dringenden Fällen dürfen Sie mich durch Anrufer stören! Sonst nicht!“ hatte sie nur „Nicht stören!“ verstanden. Jetzt saß sie am Schreibtisch von J. D. − die sie eigentlich nur vom Hörensagen kannte – und schaute sich verloren im Büro um.
Kairo Airport 29. Juni 2158
„Nur noch die Sicherheitskontrolle! Dann hast du es geschafft!“
Schweißnass wartete Abdul darauf, endlich in den Sicherheits-Scanner hineingelassen zu werden. Deutlich war auf einem Hinweisschild vor dem Scanner in mehreren Sprachen zu lesen:
Ammunition
and
Explosives of any kind
will be
IGNITED
Without warning!
------------------------------------------------
Munition
und
Explosivstoffe jeder Art
werden
ohne Warnung gezündet
Diese Scanner wurden vor hundertdreißig Jahren eingeführt. Die Menschen hatten genug davon, sich immer wieder von Fanatikern in die Luft sprengen zu lassen. Die Luftfahrtindustrie hatte – nicht ganz ohne Eigeninteresse – diese mobilen Sicherheitsboxen entwickelt. Sie besaßen die Größe handelsüblicher Container und wurden auch genauso transportiert. Man hatte die mobile Variante gewählt, weil die Box im Falle einer Sprengstofferkennung anschließend nicht mehr zu gebrauchen war.
Das Prinzip hatte die Menschenrechtler anfangs zu Protesten auf die Straße getrieben. Aber nach wenigen Jahren hatte sich das System als zu hundert Prozent zuverlässig erwiesen, sodass die Proteste schließlich verstummten. Und der Erfolg war einzigartig: Es gab keine Sprengstoffanschläge mehr in öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Stadien und anderen Einrichtungen. Die Menschen fühlten sich wieder sicher und ließen sich das Scannen daher gerne gefallen.
Sie kamen vor allen Dingen viel schneller durch eine Sicherheitskontrolle als vorher, denn sie mussten ihr Handgepäck oder sonst irgendwelche persönlichen Dinge nicht noch durch einen extra Scanner laufen lassen, um dann anschließend auf ihre Habseligkeiten warten zu müssen. Die Scanner erkannten außerdem jede Form von Schusswaffen und Messern. Mit dem gesamten Handgepäck ging man durch eine Schiebetür in den Container und dann weiter durch eine Schleuse innerhalb des Containers.
Hatte etwa jemand Sprengstoff dabei, so wurde dieser in der Schleuse ohne Vorwarnung gezündet! Bis zu einer Sprengkraft von 25 kg TNT konnten die Container ohne sichtbaren äußeren Schaden überstehen. Die darüber hinaus gehenden Sprengstoffladungen ließen die Sicherheitsboxen deformieren. Erst eine Sprengladung ab 250 kg TNT hätte den Container gesprengt, ihn aber trotzdem nicht unkontrolliert auseinanderfliegen lassen.
Nachdem anfangs einige Sprengstoffattentäter den Durchgang durch die Schleuse nicht überlebt hatten, brauchte man eine Zeit lang Nachschub an Containern. Dann hatte es sich bei Extremisten und Fanatikern wohl doch irgendwie herumgesprochen, dass es keinen Spaß macht, wenn sie Bomben hochgehen lassen und es immer nur einen Toten gab, nämlich sie selbst. Obendrein war es auch völlig unspektakulär, wenn dabei nicht einmal etwas zerstört wurde.
Es wurde vom Scanner übrigens jede Art Sprengstoff erkannt und sofort gezündet. So natürlich auch Böller, Feuerwerkskörper oder Bengalische Feuer, die beispielsweise mit in ein Stadion gebracht werden sollten.
Die Container waren außerdem mit einer Feuerlöscheinrichtung versehen. Hatten zum Beispiel irgendwelche – meist bildungsarme – Besucher einer Veranstaltung Feuerwerkskörper oder ähnliches in ihren Jacken versteckt, bekamen sie außer eventuellen leichten Verbrennungen auch noch einen sehr großen Schreck. Erst knallte oder zischte es. Danach bekam man eine unangenehme kalte Dusche aus mehreren sehr harten Wasserstrahlen. Und plötzlich war man klatschnass!
Der Erfolg aber gab den Erfindern und Konstrukteuren recht: Es machte wieder Spaß, in ein Stadion zu gehen oder zu einer großen Veranstaltung. Oder auf eine Flugreise!
Er hatte nichts dabei, was irgendeinen Alarm oder sonst etwas auslösen könnte. Was er brauchte, war bereits in New York. Trotzdem wurde Abdul erst im Flugzeug etwas ruhiger. Äußerlich! Innerlich wuchs seine Unruhe: „Werde ich Thomas Stein auch wirklich dort finden? Hat sie mir die Wahrheit gesagt? Stimmen die Codes für den Sicherheitsbereich? Oder hat sie meiner Folter doch widerstehen können und mir einfach nur unnützes Zeug erzählt?“
Die Ungewissheit quälte ihn gewaltig und seine anfangs euphorische Gemütsverfassung verschwand zusehends. Das Personal an Bord des Flugzeuges musste seine schlechte Laune ausbaden.
Aber die Crews waren gut genug geschult, um mit schlecht gelaunten Passagieren fertig zu werden und nichts persönlich zu nehmen. Manche Passagiere präsentierten sich mit einer großen Auswahl von provozierenden Marotten. Nichts verärgerte sie dann allerdings mehr als ein zuvorkommendes Verhalten des Flugpersonals. „Wenn ich schlechte Laune habe, sollen die Anderen auch nicht froh sein!“, war ihre Devise. Wenn das nicht funktionierte, brach für diese Menschen eine Welt zusammen.
Abdul hatte ununterbrochen etwas am Service auszusetzen. Mal war das Getränk zu heiß, dann die Speise zu kalt. Die Lektüre an Bord zu langweilig, der Film zu brutal. Der Getränkeservice zu langsam, die Speisenfolge zu schnell.
Kurz vor dem Anflug auf New York Idlewild schnippte er wieder mit den Fingern, genau in dem Moment, als die Stewardess an seinem Sitz vorbeikam.
„Tee!“, gab er in einem lauten Befehlston von sich. Ohne sie anzuschauen und wieder einmal ohne das gebotene Zauberwort „bitte“.
Die Frau blieb stehen und hielt kurz inne. Dann drehte sie sich elegant um, beugte sich etwas zu ihm herunter, schaute in an und fragte lächelnd:
„Sagen Sie: Könnte es sein, dass ich Ihrer Frau sehr ähnlich sehe?“
Bei den in unmittelbarer Nähe sitzenden Mitreisenden kam Heiterkeit auf. In der Reihe hinter Abdul saß eine ältere, sehr gepflegte Dame. Sie sah die Stewardess voller Hochachtung an und verlieh ihrer Anerkennung noch etwas Nachdruck, indem sie Beifall klatschte.
Kapitel 2
New Jersey 2. Juli 2158
Tom Stone schaute verträumt auf das Lichtermeer Manhattans. Der Vollmond hatte sich − aus einer anfangs bruchstückhaften, orangenen Silhouette − jetzt in seiner vollen Pracht über der New Yorker Skyline erhoben. Es sah aus, als ob das Empire State Building mit seiner spitzen Antenne einen riesigen Luftballon zum Platzen bringen wollte.
Auf der Terrasse des „Chart House“, einem Restaurant, das sich auf einer künstlich angelegten kleinen Halbinsel am Westufer des Hudson River gegenüber von Manhattan befand, hatte er gerade einen großen gefüllten Hummer verspeist, für dessen spezielle Zubereitung das Restaurant berühmt war.
„Haben Sie noch einen Wunsch, Sir?“, fragte die Bedienung mit einer ehrlichen Freundlichkeit.
Tom schaute ihr in die Augen. Er schätzte, dass sie etwa um die dreißig Jahre alt sein müsste, wahrscheinlich indianischer Abstammung, noch studierte oder einen anspruchsvollen Beruf ausübte und sich hier im „Chart House“ etwas dazu verdiente. Auf jeden Fall wirkte sie nicht wie eine jener Frauen, denen alles und jeder egal ist. Er war sich sicher: Diese Frau hatte Interesse am Weltgeschehen und …
„Sir …?“, flüsterte sie.
„Oh, verzeihen Sie, bitte“, entschuldigte er sich, „ich war gerade etwas in Gedanken versunken.“
„Ich hoffe, es waren anständige Gedanken, Sir!“ Von sich selbst überrascht, errötete sie ein wenig.
Er lächelte sie freundlich an:
„Wissen Sie, wenn man nach so langer Zeit wieder in das Restaurant kommt, in dem man als junger Mensch schon einmal gewesen war, dann überkommen einen so viele Erinnerungen.“
„Wann waren Sie denn das letzte Mal hier?“, fragte die Bedienung interessiert.
„Ich denke, das muss so vor einhundertfünfzig Jahren gewesen sein!“, hatte er grob gerechnet.
Sie lachte über diesen vermeintlichen Witz. Dabei schaute sie ihn an und plötzlich erkannte sie ihn:
„Sie … Sie sind Major Tom!“, sagte sie mit begeisterter Stimme.
„Ja, aber … “, wollte er beginnen.
„Mein Gott! Major Tom!“ Sie konnte sich kaum beruhigen.
„… eigentlich heiße ich Thomas Stein – oder, wie Sie sagen würden: Tom Stone“, sagte er und musste dabei schmunzeln, denn die US-Amerikaner müssen nach Möglichkeit jeden noch so langen Namen auf eine Silbe kürzen. Bei dem Gedanken an seinen alten Schulfreund, Stefan-Hubertus-Ingobald-Theodor – dessen Eltern eine mehrfache Namensgebung für gesellschaftlich überaus hilfreich erachteten – musste er innerlich lachen. Was Stefans Eltern wohl über sein nicht auszubleibendes Namenskürzel „SHIT“ gesagt hätten? Aber Stefans Eltern hatten es eh nicht so mit der englischen Sprache, und Stefan selbst stellte sich in New York, wo er Kunstgeschichte studiert hatte, immer als „Steve“ vor. – „Ist das wirklich alles schon so lange her?“, dachte er.
„Mein Gott! Ich habe schon so viel über Sie gelesen, gehört und gesehen“, unterbrach sie seine Gedanken. „Was gäbe ich dafür, Sie einmal persönlich sprechen zu dürfen!“
„Warum tun Sie es dann nicht?“, fragte er lächelnd, immer noch etwas in Gedanken versunken.
„Darf ich wirklich? Ein Interview?“, fragte sie. „Ich arbeite nämlich für das ,Our Earth‘-Magazin, dort drüben in Manhattan und ich habe auch schon mal einen kurzen Artikel über Ihre bevorstehende Expedition verfasst.“
Das „Our Earth“ war ein äußerst seriöses Wissenschaftsmagazin, das auch über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus sehr geschätzt wurde. Allerdings erst seit kurzer Zeit. Die Belegschaft des Magazins hatte vor fünf Jahren in einer spektakulären Aktion das gesamte Management auf die Straße gesetzt und selber die Leitung des Unternehmens übernommen. Nachdem die Vorstandsmitglieder sich durch sogenannte „Faked News“ in ihren erfundenen Berichterstattungen zum Vorteil machtbesessener Politiker und geldhungriger Wirtschaftsbosse bereichert hatten, kauften die Mitarbeiter unbemerkt die Mehrheitsanteile des Magazins auf. Sie verfassten sogar einen Bericht darüber im Magazin selbst. Das Management konnte noch vor der nächsten Aufsichtsratssitzung über seine eigene Entlassung lesen. Der Titel des Artikels: „Wie man es schafft, einem unseriösen Management den Garaus zu machen. – Oder: Mitarbeiter entlassen ihre Vorgesetzten.“ Die eingereichten Klagen des Managements wurden abgewiesen. Die Richter verurteilten die ehemaligen Führungskräfte zu hohen Geldstrafen. Der Vorstandsvorsitzende bekam zusätzlich zwei Jahre Gefängnis. Während der Zeit bei „Our Earth“ erworbene Luxusgüter oder Immobilien wurden ihnen abgenommen.
Die Welt hatte sich geändert: Schon viele Jahrzehnte war der Justiz die Geld- und Machtgier ein Dorn im Auge. Hatten diese unrühmlichen Eigenschaften doch schon so viele unschuldige, fleißige und ehrliche Menschen an den Rand des Ruins oder der Verzweiflung getrieben. Erst eine längst überfällige Gesetzesänderung gegen Ende des einundzwanzigsten Jahrhunderts hatte nach und nach das Verschwinden von macht- und geldbesessenen Menschen in wichtigen Positionen bewirkt. – Leider nicht weltweit!
„Na klar! Setzen Sie sich doch bitte und wir fangen direkt an“, bot Tom Stone ihr an.
„Leider kann ich das jetzt noch nicht! Meine Schicht endet erst um halb zwölf, also in etwa einer Stunde“, sagte sie mit enttäuschter Stimme.
„Okay! Dann warte ich hier so lange!“, sagte er zu ihrer Überraschung. Er tat das nicht, weil er an einem weiblichen Kontakt interessiert war. Obwohl sie außerordentlich attraktiv war! Er tat es, weil er diesen Abend anders verbringen wollte.
„Das würden Sie tun?“, entgegnete sie. Ihr misstrauischer Blick war ihm dabei nicht entgangen.
„Ja! – Und: Nein, ich habe bestimmt keine Hintergedanken! Ich möchte einfach meinen wahrscheinlich letzten Abend auf der Erde nicht in irgendeinem Hotelbett verbringen, sondern in netter Gesellschaft und bei einem netten Gespräch. Und bis Sie Zeit für mich haben, bringen Sie mir bitte Long Island Ice Tea … Ich liebe dieses Zeug!“
„Sehr gerne, Mister … Stein! Vielen lieben Dank!“
„Stone ist schon ok! Oder noch besser: Nennen Sie mich Tom.“
„Danke … Tom!“
Er schaute ihr nach. Sie war wirklich sehr hübsch! Nicht so ein dürres ausgehungertes „Möchtegernmodel“, wie Anfang des 21. Jahrhunderts die jungen weiblichen Wesen glaubten aussehen zu müssen. Sie besaß eine ausgesprochen weibliche Figur bei gleichzeitig sehr feinen Gesichtszügen. Tom mochte das bei einer Frau: deutliche, jedoch nicht übertriebene weibliche Rundungen. Das hatte sie und war trotzdem von schlanker Erscheinung.
Aber er hatte in dieser Hinsicht schon sehr, sehr lange den Mut verloren und damit auch jedes Interesse an einer Beziehung. Er wollte auf stressfreie Art den Abend genießen, schüttelte verlegen den Kopf und blickte wieder in Richtung Manhattan. Der Hudson River floss gemächlich vor ihm dahin. Das Spiegelbild des Mondes tanzte dabei leicht auf der Oberfläche des Flusses.
Tom war immer noch tief berührt vom Anblick des Vollmondes über dem Empire State Building. Genau so hatte er es schon einmal gesehen! Am selben Ort, im selben Restaurant, auf derselben Terrasse. Hier in Hoboken, einem Ort am Hudson River in New Jersey.
Damals, in den 1990er Jahren – er war Mitte vierzig und Kapitän auf dem Flugzeugtyp Boeing 747 – arbeitete er bereits mehr als zwanzig Jahre für die Fluggesellschaft GWA, die German World Airways.
Und jetzt, im Jahr 2158 – acht Jahre nach seinem zweihundertsten Geburtstag – sah er wieder diesen prächtigen Mond über der Skyline von Manhattan. Wie damals sollte er am nächsten Tag einen Flug übernehmen. Aber dieses mal nicht mit einer Flugzeit von knapp sieben Stunden. Jetzt war eine Flugzeit von fast zwei Jahrzehnten geplant!
Aber was war das für ihn? Für jemanden, der mit über zweihundert noch aussah, als ob er gerade seinen dreißigsten Geburtstag gefeiert hätte? Würde er den Tod auf dieser Reise finden? Wie alt würde er werden? Dreihundert, vierhundert oder tausend Jahre? Bisher konnte ihm nichts und niemand eine Antwort geben. – Er machte einen tiefen Seufzer.
„Wie ist eigentlich Ihr Name, wenn ich fragen darf?“, wollte Tom Stone wissen, als sie ihm den Long Island Ice Tea servierte.
„Aponi! – Das bedeutet …“
„… Schmetterling! Ich glaube, der Name stammt von den Cherokee?“
„… Schmetterling … stimmt genau!“, staunte sie. „Meine Eltern wollten wohl die Ureinwohner nicht in Vergessenheit geraten lassen.“
„Nun, dafür sorgen Sie schon durch Ihr Aussehen. Ihre Abstammung ist nicht zu verleugnen. Sie haben eine faszinierende Ausstrahlung. Lassen Sie sich das von einem alten Mann sagen.“
„Danke, Sir! Bis gleich!“, sagte sie verlegen und schritt davon, um einen der letzten Gäste zu bedienen.
„Bis gleich, Aponi! Bis gleich.“
Er schaute ihr nach und zündete sich genussvoll eine Lupinen-Zigarre an. Seit über hundert Jahren diente die Lupine schon als Fleischersatz. Nur die fingerförmigen Blätter wurden für andere Dinge genutzt. Auf spezielle Art getrocknet und ohne den Hauch von irgendwelchen Zusatzstoffen wurden sie unter anderem zu einer Art schmackhaftem „Tabak“ verarbeitet. Ein Genuss, der weder süchtig machte noch in irgendeiner Weise schädlich war. Mediziner mischten dem sogenannten Tabak bestimmte pflanzliche Wirkstoffe bei, sodass ein entzündungshemmendes Gemisch gegen Erkältungen entstand.
Tom vernahm ein leises Summen und schaute zum Himmel über Manhattan. Eine Boeing 7007 Space-Cargo – kurz: B7SC – schob sich vor den Mond und flog dann in einem immer steiler werdenden Winkel in den Nachthimmel. „Wird wahrscheinlich die letzten größeren Beladungen für den Space-Explorer an Bord haben.“, dachte er und fragte sich, ob das die richtige Entscheidung war, sich für diese Mission zur Verfügung gestellt zu haben. „Was soll’s!“, überlegte er. „Du hattest so viele Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Und jetzt hast du dich dafür entschieden. Also steh’ auch dazu!“
Er schaute der Boeing nach, bis sie von der Dunkelheit verschlungen wurde. Dann stand er auf, gab Aponi ein Zeichen, dass er außerhalb auf sie warten würde, und verließ das Restaurant.
Gegen Mitternacht war Aponi fertig mit ihrer Abrechnung. Sie ging aus dem Restaurant zum Parkplatz, wo Tom zwischen den letzten auf ihre Besitzer wartenden Hover-Cars auf und ab schritt. Eines dieser Fortbewegungsmittel setzte sich gerade lautlos in Bewegung und schwebte an ihm vorbei. Er gab dem Fahrer mit Handzeichen zu verstehen, dass der Motor-Geräuschimitator nicht funktionierte. Dieser war seit Jahren weltweit zur Pflicht geworden da herannahende Hover-Cars (die man allgemein nur „Hors“ nannte – wegen der Namensverkürzung) sonst nicht gehört werden konnten. „Wahrscheinlich defekt“, dachte Tom. Er konnte nicht ahnen, dass der Fahrer den Geräuschimitator, das sogenannte Sound-Modul, absichtlich deaktiviert hatte. Er bemerkte auch nicht den hasserfüllten Blick des Mannes im Hover-Car.
Aponi, die sich inzwischen umgezogen hatte, trug jetzt einen für die Zeit hochmodernen Overall. Jahreszeitlich bedingt, mit kurzen Ärmeln. Das dunkle Violett dieses Kleidungsstückes passte ausgezeichnet zu ihren schwarzen Haaren, die sie jetzt offen trug und dadurch ihre wunderschöne Figur noch mehr betonte.
Tom genoss für einen Moment diesen Anblick. Er lächelte sie an und fragte:
„Wohin gehen wir?“
„Wie wäre es mit meinem Büro? Es befindet sich an der West 42nd Street und 12th Avenue, nicht weit entfernt von den Anlegeplätzen der Fähren, vierundzwanzigste Etage, und wir können uns dabei den Hudson River von der anderen Seite anschauen. Ich habe nämlich einen herrlichen Blick von dort. Bei der klaren Sicht heute Nacht können wir vielleicht sogar die Lichter von Philadelphia sehen!“
„Einverstanden!“, sagte er. Dann gingen sie schweigend durch eine angenehme nächtliche Stille über die Promenade am Harbor Boulevard zur Anlegestelle der „New York Waterway“-Fähre.
Der Mann in dem alten Chevy-Hors grinste verächtlich, als er auf das Paar zusteuerte, dass gerade dabei war, den Fähranleger zu betreten. Er wollte den Moment genießen. Er wollte, dass Thomas Stein ihm in die Augen sieht, in dem Moment, in dem er ihn über den Haufen fährt. Er stellte das Sound-Modul an, kurz bevor er die beiden erreichte.
Aponi erschrak bei dem plötzlich auftretenden Geräusch und klammerte sich reflexartig an ihren Begleiter. Tom drehte sich um und sah, wie das alte Chevy-Hors etwa einen Meter vor ihnen abhob, genau an der Stelle, wo der Anleger einen kleinen Absatz hatte. Anscheinend hatte die Induktionsschleife im Boden des Fähranlegers für diesen Auftriebsimpuls gesorgt. Das Chevy-Hors flog in sehr hohem Tempo direkt über ihre Köpfe hinweg. So dicht, dass der Fahrtwind sie fast das Gleichgewicht verlieren ließ. Dann hörten sie noch etwa fünf Sekunden ein klagendes Geräusch vom Sound-Modul, bevor das Fahrzeug ungefähr vierzig Meter vom Ufer entfernt in den Hudson River klatschte, um erst zischend, dann gurgelnd zu versinken.
„Alles gut! Alles ist gut!“, wollte Tom Aponi beruhigen. Sie schien aber nicht besonders beunruhigt zu sein.
„Ich habe mal gelesen, dass Ihnen das häufiger passiert!“, sagte sie völlig ruhig. Mit Hilfe ihres eleganten, türkisfarbenen Armreifes, der als Kommunikator diente, setzte sie einen Notruf ab.
Tom Stone konnte seine Verblüffung nicht verbergen. Er brauchte einige Zeit, bis sich seine erstaunten Gesichtszüge wieder normalisierten.
Etwas erregt sagte er: „Verdammt noch mal! Dieses Ding hätte Sie töten können!“
„Dieses Ding war ein alter Chevy, der von einem Mann gesteuert wurde. Aber beschreiben könnte ich ihn nicht. Und: Nein! Er hätte mich nicht töten können, weil ich Sie die ganze Zeit berührt hatte!“
Toms Gesichtszüge nahmen wieder diesen Ausdruck des Erstaunens an. Aponi musste lachen und fasste ihn sanft am Arm:
„Alles gut! Alles ist gut!“
Das hatte ihr bei ihrer Karriere als Journalistin immer wieder geholfen. Ihre ausgesprochen ruhige Art und Gelassenheit.
„Guten Abend, Aponi! Guten Abend, Tom!“, begrüßte sie der Polizist auf seinem Hover-Bike, der schon wenige Augenblicke nach Aponis Notruf erschienen war.
„Guten Abend, Bill!“, erwiderten Aponi und Tom fast synchron.
Tom berichtete knapp:
„Wir haben weder Fahrer noch Kennzeichen erkennen können! Diese Dinger saufen ja nicht komplett ab. Also, was denkst du, Bill? Etwa dreißig bis vierzig Meter in den Hudson, bei der Strömung?“ Tom deutete mit seiner rechten Hand eine ballistische Kurve an. „Das Ding dürfte schon an Hoboken vorbei sein, oder?“
„Das denke ich auch, Tom. Eine Suche dürfte ziemlich schwierig sein. Ich gebe den Kollegen von der River Patrol trotzdem Bescheid. Sollen die sich mal drum kümmern, denen ist sowieso immer langweilig!“
Der Polizist kommunizierte kurz gut gelaunt mit seinen Kollegen. Danach wandte er sich wieder den beiden zu:
„Wollt ihr rüber zum Big Apple? Soll ich euch fahren?“
„Danke, Bill! Aber wir nehmen die Fähre“, erwiderte Tom. „Wieso hast du eigentlich Dienst? Morgen beginnt doch nicht nur meine, sondern auch deine große Reise.“
„Ach, weißt du, ich wollte meinen vielleicht letzten Abend auf der Erde nicht im Bett verbringen!“
„Den Satz habe ich heute schon mal gehört“, sagte Aponi.
Bills Kommunikator am Arm blinkte.
„Ich muss los! Bis später, Tom!“
Der Polizist schaute Aponi in die Augen:
„Auf Wiedersehen, Aponi.“ Bei diesen Worten musste er schlucken.
Aponi sah verlegen nach unten und versuchte ein zaghaftes Winken.
Bill setzte sich auf sein Hover-Bike, um lautlos, aber stark beschleunigend Richtung Park Avenue zu steuern. Dort bog er rechts ab Richtung Lincoln Tunnel.
„Sie kennen Bill Smith?“, fragte Tom während beide dem Polizisten nachschauten.
„Wir sind …, wir waren quasi Nachbarn!“, sagte sie, ohne den Blick von der Straße zu wenden, auf der Bill jetzt nicht mehr zu sehen war.
Eine Viertelstunde später hatte die Fähre den Anleger von Manhattan erreicht. Aponi und Tom verließen das antike Gefährt, um zu dem nur etwa zweihundert Meter entfernt gelegenen Bürogebäude zu gehen.
Aponi begrüßte die Frau der Security hinter dem Haupteingang.
„Hi, Wilma! Ich werde heute eine Nachtschicht einlegen, da dieser Herr an meiner Seite ab morgen nicht mehr verfügbar sein wird.“
„Alles klar, Miss Conners! Ich gebe den Fahrstuhl frei. Gute Nacht!“
„Gute Nacht, Wilma!“
Aponis Büro
„Noch einen Long Island Ice Tea, Tom?“, fragte Aponi mit einem verschmitzten Lächeln, nachdem sie in ihrem Büro angekommen waren.
„Nur, wenn Sie mitmachen!“, antwortete Tom in der gleichen Art zu lächeln. „Ich denke aber, dass ein Kaffee jetzt nicht schlecht wäre.“
Interessiert sah er Aponi an:
„Sagen Sie, Aponi, wieso müssen Sie dort drüben eigentlich arbeiten?“ – Er deutete über den Hudson River auf das „Chart House“.
„Das Restaurant gehört meinem Bruder Allen. Eigentlich heißt er Elan, das bedeutet ,freundlich‘ in der Sprache unserer Ahnen. Aber damit kam niemand zurecht, und deshalb wurde aus ihm Allen, beziehungsweise ,Al‘, wie Sie sich denken können.“
Tom hörte sie in der kleinen Büroküche mit Geschirr klappern.
„Und wenn mein Bruder mal eine Auszeit braucht, dann springe ich ab und zu für ihn ein.“
Sie erzählte noch etwas über Gegenleistung, Geschwisterliebe, Familientradition und einiges andere. Aber Tom war mit seinen Gedanken bei dem Zwischenfall von vorhin und hörte deshalb kaum zu. Irgendwie versuchte er, an das Gesicht des Hover-Car-Fahrers zu kommen. Doch der viel zu kurze Augenblick vom Moment des Sound-Modul-Geräusches bis zum Überflug des Chevy-Hors ließ kein brauchbares Bild in seinem Kopf erscheinen.
Aponi erschien mit einem Tablett, auf dem kleine Dampfwölkchen aus zwei Tassen aufstiegen. „Der gewünschte Kaffee, Tom. Können wir anfangen?“
Sie stellte das Tablett auf den Tisch zwischen einem Ledersofa und den großen Fenstern, durch die man einen phantastischen Blick über den Hudson River nach New Jersey hatte.
„Ich hoffe, es ist ok, wenn ich das Aufzeichnungsgerät an meinem Armreif einschalte und Sie mir dann einfach über Ihr Leben erzählen?“
„Ich denke, Sie kennen mein Leben? Sonst wüssten Sie nicht, dass eine Berührung mit mir Sie quasi unverwundbar macht!“
„Das schon“, bemerkte Aponi, „aber ich meinte Ihr wirkliches Leben. Wie fing alles an? Wann haben Sie das erste Mal dieses, Ihr, Phänomen entdeckt?“
Tom Stone ließ seine Gedanken wieder in die Vergangenheit reisen. Obwohl es schon über zweihundert Jahre her war, konnte er sich gut an diesen Tag erinnern:
„Wie Sie wissen, wurde ich 1950 geboren. Ich schätze, dass ich etwa zwei bis zweieinhalb Jahre alt gewesen sein muss. Neben mir, in der Sandkiste eines öffentlichen Spielplatzes in Hamburg, fing ein kleiner Junge, wahrscheinlich auch so in meinem Alter, fürchterlich an zu schreien. Danach hatten sich seine und meine Mutter in den Haaren, weil seine Mutter behauptete, dass ich ihm mit einer kleinen Blechschaufel auf den Kopf geschlagen hätte. Meine Erinnerung ist jedoch die, dass ich mich zu dem Kleinen umdrehte, als er gerade mit der Schaufel ausholte und sich dann selber das Ding an den Kopf knallte. Ein anderes Mal bekam er einen Stein an den Kopf, den er auf mich werfen wollte. Wieder gab es Diskussionen zwischen unseren Müttern.
Als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, wurde mein Vater fast verprügelt, weil ich bei einem Fußballspiel angeblich einen Spieler der gegnerischen Mannschaft gefoult haben soll. Daraufhin entstand eine heftige Diskussion zwischen meinem Vater und den anderen Vätern.
Eigentlich muss das damals witzig ausgesehen haben: Ein Gegner versuchte, mich beim Laufen umzulegen, hat sich dann aber selber beim Zutreten dreimal um die eigene Achse gedreht und ist dann spektakulär gestürzt.
Es gab noch viele ähnliche Ereignisse, die immer wieder erregte Debatten auslösten. Oft wurden meine Eltern in die Schule zitiert! Ich hätte andere geschlagen oder wäre mit gefährlichen Waffen auf sie losgegangen.
Meine Eltern haben mich nie geschlagen. Aber irgendwann hat irgendeine Beschwerde der Schule meinen Vater wohl sehr wütend gemacht. Als er an diesem Tag nach Hause kam, ging er direkt auf mich zu, um mir eine Ohrfeige zu verpassen. – Seinen entsetzten Gesichtsausdruck können Sie sich vorstellen, als seine rechte Hand seine eigene linke Wange traf. Ich hob meine Hände und bat ihn, es noch einmal zu versuchen. Er sah mich verwirrt an. Als ich ihm aber sagte, er solle es bitte noch einmal versuchen, damit er mein Problem erkennt, tat er es – nicht so stark wie beim ersten Mal –, aber er tat es. Nachdem seine Hand wieder auf seine eigene Wange klatschte, überlegte er sehr lange, schaute auf seine Hand, dann auf mich, dann wieder auf seine Hand.
Mein Vater sah mir ratlos in die Augen. Ausführlich und sehr lange berichtete ich ihm von meinen Erfahrungen.
Wann immer irgendwer mich körperlich attackierte, bekam er selbst die Blessuren. Wann immer ich mit einer Waffe angegriffen wurde, bekam der Angreifer selbst die Folgen zu spüren.
Ich erzählte meinem Vater, wie Mitschüler mir aufgelauert hatten, um mich zu verprügeln, sie aber stattdessen sich selber verprügelt hatten. Ich erzählte davon, wie ich mit Steinen beworfen wurde, die Steine mich aber nur umkreisten, um anschließend auf den Steinewerfern zu landen. Ich erzählte davon, wie einer mich mit einem Messer am Arm ritzen wollte, sich aber selber eine Wunde am Arm zufügte. Und ich erzählte davon, wie Personen ihre Unterlegenheit hinter einer Lüge verbargen und ihnen immer geglaubt wurde, da sie ja schließlich die Verletzungen vorweisen konnten.
Mein Vater sah mir immer noch in die Augen. Er sagte dann, er verstünde jetzt auch den Vorfall mit einem Nachbarshund, der mich beißen wollte, sich aber selbst in die Vorderpfote biss und schwer verletzte. Der spießige Besitzer des Schäferhundes wollte uns sogar verklagen – wegen Tierquälerei!
Ich denke, dass mein Vater damals meine Ratlosigkeit erkannte. Wer sollte auch glauben, dass ich eine Art natürlichen Schutzschild besaß? Deshalb nahm er mich in den Arm, um zu versuchen, mich zu trösten. Aber mehr noch, weil der Versuch, mir eine Ohrfeige zu geben, ihm leid tat.
Als meine Mutter dazukam und fragte, was denn diese Umarmung bedeuten würde, bat mein Vater sie, mich zu schlagen. Er sagte das mit einem schelmischen Lächeln und zwinkerte mir zu. Es bedurfte jedoch jeder Menge Überredungskünste, bis sich meine Mutter entschied, mir einen kleinen Klapps auf die Wange zu geben. Der Klapps gelangte natürlich auf ihre eigene Wange und ihre Sprachlosigkeit dauerte eine gefühlte Ewigkeit.
Sie vermutete zunächst eine Art Zaubertrick, den ich mir angeeignet haben müsse, und wollte gerne den Trick herausfinden. Nach dem dritten Klapps auf ihre Wange begann sie allerdings zu zweifeln.
Dann begann ich mit ausgiebigen Erklärungen. Wir diskutierten die ganze Nacht, woher dieses Phänomen kommen könnte. Aber wir kamen zu keinem Ergebnis. Es wurde nun intensiv überlegt, wie wir damit in der Zukunft umgehen sollten. Schließlich fassten wir den Entschluss, dieses Geheimnis für uns zu behalten.
Da es unter Teenagern ab und zu leider üblich ist, seine Kräfte zu messen, blieben weitere Besuche von Vater oder Mutter in der Schule nicht aus.
Eines Tages reichte es meiner Mutter, ständig von den Lehrern angemahnt zu werden. Sie eilte – mich an der Hand – in meine Schule. Aufgebracht betrat sie ohne „Guten Tag“ oder sonst eine Begrüßung das Zimmer des Direktors.
„Knallen Sie ihm eine!“, platzte es aus ihr heraus.
„W … wie bitte?“ Der völlig konsternierte Schuldirektor war erschrocken aus seinem Sessel aufgesprungen und starrte uns mit aufgerissenen Augen an.
„Sie sollen meinem Sohn eine knallen! Eine Ohrfeige oder Backpfeife, wie immer Sie das nennen wollen! Los! Knallen Sie ihm eine! Sie müssen doch jede Menge Gründe dafür haben! Außerdem haben Sie uns doch geraten, unseren Sohn bei Bedarf körperlich zu züchtigen! Bitteschön: Jetzt haben Sie die Gelegenheit!“
Etwas verunsichert ging der Schulleiter auf mich zu, hob zögernd seine Hand und holte aus. Ich sah kurz ein Grinsen in seinem Gesicht, dann schlug er mit enormer Wucht zu! Was musste dieser Mann für eine Wut auf mich gehabt haben. Jahrelang einen Verweis nach dem anderen schreiben! Immer wieder andere Eltern beruhigen, um sie von einer Klage gegen die Schule abzubringen. Ständig meine Eltern zu sich zitieren. – Wie sollte er auch ahnen, dass die anderen Mitschüler, die es auf eine Kraftprobe mit mir angelegt hatten, einfach nur verlogene Feiglinge waren und nie zugeben konnten, selbst den Streit angefangen zu haben. – Meistens jedenfalls!
Als seine Hand auf sein Gesicht klatschte, taumelte er rückwärts gegen seinen Schreibtisch. Er wurde zusehends blasser im Gesicht.
„Ist das alles, was Sie drauf haben?“, fragte meine Mutter ihn. „Na, los doch! Machen Sie es noch einmal!“
Wutschnaubend kam der Direktor auf mich zu, holte aus und schlug noch heftiger zu. Ich konnte jetzt kein Grinsen erkennen. Jedenfalls nicht beim Direktor – eher bei meiner Mutter. Als ihn auch dieser Schlag umhaute, setzte er sich auf seinen Stuhl, atmete tief ein und aus, starrte abwechselnd mit offenem Mund auf mich und meine Mutter und war nicht mehr ansprechbar.
Nach zweifachem Anfragen, ob alles ok sei oder er Hilfe bräuchte, schüttelte er nur den Kopf. Er gab uns zu verstehen, dass er jetzt allein sein wollte. Bevor wir gingen stellte meine Mutter sich aufrecht vor den Direktor. Als sie ihre rechte Hand hob, zuckte er zusammen. Mit ausgestrecktem Zeigefinger sagte sie:
„Bestellen Sie mich nie wieder – hören Sie! – nie wieder hierher, ohne irgendeinen Beweis für eine Missetat meines Sohnes zu haben! Haben Sie mich verstanden? Guten Tag!“ Mit diesen Worten verließen wir das Direktorenzimmer.
Einige Tage später bekamen wir Post von der Staatsanwaltschaft Hamburg. Eine Vorladung zu einem Gerichtstermin offenbarte die Verlogenheit vieler damaliger Personen in höheren Beamten- oder Angestelltenverhältnissen. Die Anklage: Vorsätzliche Körperverletzung einer Respektsperson. Ich soll den Schuldirektor geschlagen haben.
Wir lachten zunächst über diese unfassbaren Vorwürfe. Bei näherer Betrachtung mussten wir aber erkennen, wie kompliziert das für uns werden könnte. Denn schon immer hatten diese sogenannten ,alternativen Wahrheiten‘ großen Einfluss auf die Menschen genommen, speziell bei der bildungsarmen Bevölkerung.
Doch dann kam uns der Zufall zu Hilfe:
Ich war bei einem Konzert der Rolling Stones, einer Rockband, die damals ihres Gleichen suchte ....“
„Oh, denken Sie nicht, ich würde diese Band nicht kennen, Tom!“, unterbrach ihn Aponi begeistert. „Mein Bruder und ich haben sogar noch Vinylplatten von den Rolling Stones aus dem Besitz meiner Ur-Ur-Ur-Großeltern!“
„Sind Sie sicher, was die Anzahl der ,Urs‘ betrifft?“, lächelte Tom sie an.
„Jedenfalls war das Konzert das Ereignis in den 1960er Jahren! Auf dem Rückweg, etwa gegen Mitternacht, musste ich, wie die meistens Rolling Stones-Fans, mit der S-Bahn fahren. Von Station zu Station leerte sich der Zug. Kurz vor dem Ende der Fahrt befanden sich nur noch ein junges Mädchen und ich in diesem Teil des Zuges. Ich saß an einem Ende des Waggons, sie an dem anderen.
Plötzlich stiegen mit lautem Gegröle fünf Jugendliche ein. Mit gekünsteltem Lachen und abstoßenden Bemerkungen gingen sie auf das junge Mädchen zu. Dabei ließen zwei von ihnen eine Fahrradkette in der Luft kreisen. Einer von ihnen rief:
,Du dreckige Schlampe ziehst jetzt die Hose aus und machst die Beine breit!‘
Das Mädchen sah hilfesuchend zu mir herüber. Ihr Blick drückte Panik aus. Gleichzeitig entdeckten mich die anderen drei. Die hatten zwar keine Fahrradkette, dafür aber Schlagringe.
Sie riefen mir zu, dass ich sitzen bleiben, die Schnauze halten und auf sie warten solle.
In dem Moment, in dem der erste Schläger das Mädchen anpackte und sie anfing zu schreien, erhob ich mich und brüllte zu den Typen rüber, dass, wer auch immer ihr etwas antut, diesen Zug nicht ohne körperlichen Schaden verlassen wird.
– Plötzliches Schweigen im Zug –
Wie auf Zuruf drehten sich alle fünf in meine Richtung. Fahrradketten und Fäuste schwingend, kamen sie auf mich zu. Ich ging ihnen entgegen, was sie zwar etwas irritierte, aber trotzdem ihre Schritte nur wenig verlangsamte.
Der Erste ließ eine Fahrradkette mit seiner rechten Hand dreimal über seinem Kopf kreisen, bevor er zum Schlag ausholte. Wie ein Geschoss bewegte sich der zur Waffe missbrauchte Gegenstand auf meinen Kopf zu. Unmittelbar vor dem Aufschlag sauste er dicht über meinen Kopf hinweg zurück zum Angreifer.
Zwei Sekunden später lag dieser blutend, mit halb abgerissenem Ohr und einer Fahrradkette um den Kopf gewickelt vor mir. Kurz danach hatte sich der zweite Schlägertyp mit seiner Kette an einer Haltestange stranguliert und röchelte panisch. Der Dritte ballte seine rechte Faust, sodass sein Schlagringsortiment deutlich auf vier Fingern sichtbar wurde. Als das Ringsortiment auf seine Nase traf, hörte ich deutlich das Krachen von brechenden Knochen. Nummer Vier und Fünf wichen daraufhin zurück. In diesem Moment lief der Zug im nächsten Bahnhof ein. Ich forderte die beiden Unverletzten auf, die Reste ihrer Drecksbande aufzusammeln und auszusteigen. Als sie den Zug verließen, wurden mir noch Drohungen an den Kopf geworfen, dann machten sie sich ächzend und jammernd davon.
Eigentlich hätte ich hier auch aussteigen müssen, wollte aber das Mädchen nicht allein lassen. Zwei Stationen später begleitete ich sie bis zum Haus ihrer Eltern, wo sie von ihrem Vater in Empfang genommen wurde. Ich wartete an der Gartenpforte. Dabei wurde ich vom Vater mit skeptischen Blicken begutachtet. Nachdem sie ihm von dem Vorfall in der Bahn berichtet hatte, kam er auf mich zu, bedankte sich und nahm mich dabei kurz in den Arm. Sein Angebot, mich nach Hause zu fahren, nahm ich dankbar an, denn es war schon spät und ich wollte nicht, dass sich meine Eltern unnötig Sorgen machten. Dort angekommen verabschiedete und bedankte er sich, um mich dann noch für den nächsten Sonntag zu sich nach Hause einzuladen – mit meinen Eltern. Dann fuhr er mit seinem Ford Taunus 17M davon.“
„Sie können sich nach zweihundert Jahren noch an den Autotyp erinnern?“, fragte Aponi überrascht.
„So einen Klassiker vergisst man einfach nicht! Wie so manches, von dem man meint, dass es früher besser und schöner war. Die Vorstellung, dass früher etwas besser oder schöner war, hängt wahrscheinlich davon ab, ob zu dieser Zeit positive Erfahrungen gemacht worden sind. Ob man zum Beispiel gerade etwas Schönes erlebt hat oder sich in familiärer Geborgenheit befand, sind sicher ausschlaggebende Faktoren für dieses subjektive Zeitempfinden. Ich finde allerdings, dass jede durchlebte Zeit ihr Gutes hat! Man darf allerdings niemals die zwangsläufig auftretenden negativen Erlebnisse seines Lebens auf dem Siegertreppchen des Erinnerungswettkampfes einen Platz erreichen lassen! Ich glaube, dann kommt der Mensch auch ohne Depressionen aus.“
„Ein angenehmer Gedanke!“, äußerte Aponi.
Tom blickte nachdenklich auf den Hudson River. Einen Augenblick später fuhr er fort:
„Drei Tage nach dem Vorfall in der S-Bahn fand der Gerichtstermin statt. Ich traute meinen Augen nicht, als ich sah, wer der vorsitzende Richter war: Es war der Vater des Mädchens! Richter Hartmann!
Man forderte mich auf, hervorzutreten. Als ich nach vorne schritt, setzte der Richter seine Brille auf, um mich anzuschauen. Er erschrak dermaßen, dass ihm die Brille gleich wieder von der Nase fiel. Dann sah er mich fassungslos an, sagte aber zunächst kein Wort. Nach einer Weile räusperte sich der Staatsanwalt und sah den Richter fragend an.
Richter Hartmann meinte daraufhin, dass er die Verhandlung unterbrechen müsse, da er wahrscheinlich befangen sei. Er bat den Staatsanwalt und unseren Rechtsanwalt in das Richterzimmer hinter dem Gerichtssaal.
Dreißig Minuten später erschienen Richter und Anwälte wieder im Gerichtssaal. Richter Hartmann eröffnete die Gerichtsverhandlung mit den Worten, dass diese Geschichte so unglaublich sei und dass kein Mensch ihm eine Befangenheit unterstellen würde, da es eine eindeutige Beweislage gäbe.
Ein Journalist, der bislang gelangweilt in einer Ecke des Gerichtsaals gesessen hatte, wurde plötzlich hellwach und zückte einen Schreibblock sowie eine Kamera aus seiner Aktentasche. Die daraus resultierenden Berichte und Fotos, die ab dem nächsten Tag in der Hamburger Boulevardpresse erschienen, sollten unser Leben grundlegend verändern.
Die Verhandlung war dann schnell beendet. Nachdem der Richter Freiwillige aufrief, mir eine Ohrfeige zu geben, hörte die Bereitschaft, dies zu tun, nach dem dritten Freiwilligen auf, der seine Hand schmerzhaft auf seiner eigenen Wange spürte.
Im Gerichtssaal entstand bei jedem Versuch, mir eine Ohrfeige zu geben, lautes Geraune. Mein Schuldirektor stampfte nach der Urteilsverkündung – sozusagen meinem Freispruch – wutschnaubend zum Ausgang. Er wurde übrigens kurze Zeit später in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.
Der Journalist drängte sich anschließend zu mir und verlangte ein Interview, wurde aber von unserem Rechtsanwalt zurückgehalten. Dafür wurden wir zwei Tage später zu Hause von Journalisten belagert. Es wurden in den darauf folgenden Wochen täglich mehr.“
Aponi hatte bis hierher aufmerksam zugehört. Sie schaute Tom mit großen, erwartungsvollen Augen an:
„Das muss ja auch wirklich einen Riesenwirbel gegeben haben. Etwas so Unerklärliches lässt den Menschen normalerweise keine Ruhe! Sie sind doch sicher nicht nur von Journalisten bedrängt und belagert worden. Wie haben Sie sich schützen können?“
„Na ja“, fuhr Tom nach kurzer Pause fort, „wir sind dann erst einmal eine Zeitlang verreist, nahmen aber vorher noch die Einladung von Richter Hartmann wahr. Wir erzählten ihm von der Belagerung durch die Presse. Der Richter schaffte es dann auch nach einigen Wochen, uns die Journalisten vom Halse zu schaffen. Die sensationslüsternen Menschen, oder besser: Gaffer, blieben irgendwann fort, nachdem nichts Aufregendes mehr um uns herum geschah.
Aber die Berichterstattungen wollten nicht aufhören. Immer mehr Spekulationen und Rätselraten über mich tauchten Seitenweise auf – nicht nur in den Boulevardblättern. Manche Verlage gingen sogar so weit, von einigen namenlosen Wissenschaftlern über einen Marsmenschen spekulieren zu lassen. Laufend wurde ich aufgefordert, mich für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Erst Jahre später beschäftigten sich seriöse Wissenschaftler mit meinem Phänomen, körperlich unangreifbar und unverwundbar zu sein.
Wie Sie ja wissen, bin ich nicht nur unverwundbar, sondern auch derjenige, der den Bumerang-Effekt der gegen mich gerichteten Waffen oder Anschläge auslöst. Und bis heute, zweihundertacht Jahre nach meiner Geburt, kann es niemand erklären! Genauso ist es mit meinem Alterungsprozess, der irgendwann zwischen meinem dreißigsten und vierzigsten Lebensjahr einfach aufhörte. Ich soll als Kleinkind im Krabbelalter beim Erkunden einer Steckdose einen beinahe tödlichen Stromschlag bekommen haben. Doch auch durch diesen Vorfall konnte mein Phänomen nicht erklärt werden. Man konnte sich diesen Steckdosenvorfall zwar als eine mögliche Ursache vorstellen, hatte aber trotzdem keine wissenschaftliche Erklärung.“
Tom Stone atmete tief durch und schaute Aponi in die Augen. Es gefiel ihm, an seinem letzten Abend auf der Erde sein bisheriges Leben noch einmal vorüberziehen zu lassen. Mit einer so charmanten Zuhörerin machte es ihm besonderen Spaß.
Motiviert fuhr er mit seiner Erzählung fort:
„Als meine Eltern und ich von der langen Reise zurückgekehrt waren, hatten wir zunächst einige Zeit Ruhe. Meine Eltern gingen ihrer Beschäftigung nach, ich machte mein Abitur. Mit meinen Freunden unternahm ich viel, vor allem mit meinem besten Freund Stefan. Wir mussten uns keine Gedanken machen, wenn wir zu nächtlichen Zeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln fuhren. Die primitiven Schlägerbanden, die sich mit uns anlegten, hatten nie den Hauch einer Chance. Sie verließen jedes Mal jammernd, ächzend, stöhnend und meistens blutend Bus oder Bahn. Manchmal fand ich es befriedigend, wenn diese Typen nicht triumphierend ausstiegen, weil sie irgendeine wehrlose Person angegriffen und zusammengeschlagen hatten. Deshalb machte es mir sogar ab und zu etwas Spaß, sie zu provozieren, um sie anschließend noch mehr zu demütigen.
Ich muss das wohl irgendwann übertrieben haben. Eines Nachts stand plötzlich eine Horde Schläger in unserem Vorgarten. Vielleicht so sieben bis acht Mann. Sie zerstörten laut pöbelnd alles, was sie im Garten finden konnten. Sie betrieben mit ihren unterentwickelten Gehirnen Vandalismus, wie er besser nicht definiert werden konnte. Pflanzen, Zäune, Lampen, Dekorationsgegenstände waren innerhalb kürzester Zeit Opfer ihrer kranken Zerstörungswut.
Leider war ich nicht schnell genug. So geschah es, dass mein Vater als erster die Haustür öffnete.
Kurz bevor ich mit einem lauten: ,Nein!! Nicht!!‘ meinen Vater erreicht hatte, hörte ich den Schuss. Dann musste ich mit ansehen, wie mein Vater zusammenbrach. Ich fing ihn auf, um ihn behutsam hinzulegen, und rief meiner Mutter zu, sie solle den Notarzt rufen. Dann der nächste Schuss, gefolgt vom Schrei meiner Mutter. Ich blickte zu ihr und musste mit ansehen, wie sie mit dem Telefonhörer in der Hand im Hausflur blutend zusammenbrach. Ich versuchte, sie aufzufangen, aber sie schlug hart auf dem Boden auf, bevor ich sie erreichen konnte. Als ich mit der Hand über ihren Kopf strich, färbte sich der Teppich unter ihrem Körper rot.
Tränen der Wut quollen aus meinen Augen. Wie in einer Zeitlupe stand ich ganz langsam auf, drehte mich um und ging auf die Bande zu, wobei ich genau in den Lauf einer Pistole blickte. Ich konnte sehen, wie sich der Finger am Abzug bewegte.
Dann der Schuss!
Eine kleine Stichflamme schoss aus dem Lauf der Waffe. – Ich hörte, wie die Kugel um meinen Kopf herum pfiff. Ein Geräusch wie ein heller Peitschenknall quälte kurz mein Gehör, um sich augenblicklich in ein dumpfes, platschendes Geräusch zu verwandeln. Nämlich in dem Moment, als die Kugel in den Schädel des Schützen einschlug.
Kurzes Schweigen, dann ein stöhnend zusammenbrechender Kerl.
Schon kam der nächste auf mich zu. Ich erkannte ihn an seinem halb abgerissenem Ohr. Er schwang schon wieder mit einem dummen Gesichtsausdruck auf diese lächerliche Weise eine Fahrradkette! Kurze Zeit später umfasste er schreiend sein Ohr. Oder besser: Die Stelle an der er einmal ein Ohr hatte.
Inzwischen hatte ein anderer Angreifer es geschafft, dem am Boden liegenden Toten die Waffe abzunehmen. Er zögerte keine Sekunde, um einen Schuss auf mich abzugeben. Doch es geschah wieder das Gleiche: Er betätigte den Abzug, das Geschoss flog um mich herum, zurück zum Schützen und erledigte ihn.





























