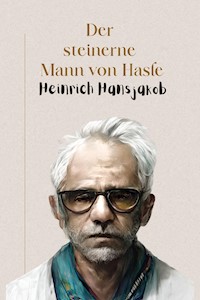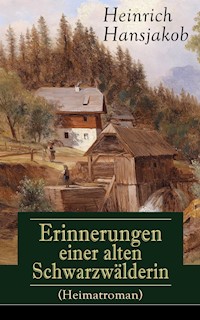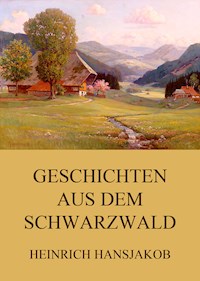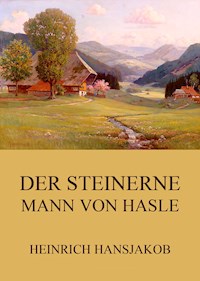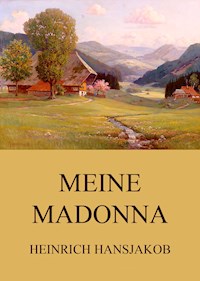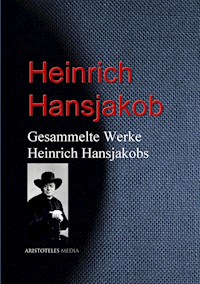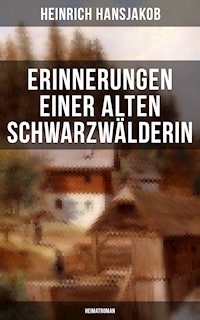
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heinrich Hansjakobs 'Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin: Heimatroman' ist ein fesselndes Werk, das den Leser in die malerische Welt des Schwarzwaldes entführt. Der Roman erzählt die Geschichte einer alternden Frau, die ihre Lebenserinnerungen und Begegnungen reflektiert. Der literarische Stil ist von Hansjakobs Liebe zum Detail und seiner Fähigkeit geprägt, die Schönheit der Natur und die Eigenheiten der Menschen im Schwarzwald einzufangen. Das Buch ist ein klassischer Heimatroman, der sowohl historische als auch kulturelle Einblicke in die Region bietet. Durch seine lebendige Beschreibung der Landschaft und der Charaktere wird der Leser in eine vergangene Welt versetzt, die dennoch zeitlos ist. Heinrich Hansjakob, ein bekannter deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, war selbst im Schwarzwald aufgewachsen und liebte es, die Schönheit und Eigenheiten seiner Heimat in seinen Werken festzuhalten. Seine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen dienten als Inspiration für 'Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin'. Als vielseitiger Autor und Geistlicher hatte Hansjakob ein tiefes Verständnis für die Menschen und die Natur, das sich in seinem Werk widerspiegelt. Für Liebhaber von Heimatromanen und lesenswerten literarischen Werken ist 'Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin' ein absolutes Muss. Dieser Roman begeistert nicht nur mit seiner atmosphärischen Darstellung des Schwarzwaldes, sondern auch mit seiner einfühlsamen Erzählweise und den vielschichtigen Charakteren. Tauchen Sie ein in die Welt von Heinrich Hansjakob und lassen Sie sich von seiner einzigartigen Erzählkunst verzaubern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin: Heimatroman
Books
Inhaltsverzeichnis
1
In meinem Pfarrhause zu Freiburg befindet sich seit vielen Jahren eine alte, alte Schwarzwälderin. Sie ist, im Herzen des Schwarzwalds geboren, auf allen Bergen und in allen Tälern an der Gutach, Kinzig, Wolf, am Schapbach und Harmersbach hin in Diensten gestanden.
Seit Jahren dient sie bei mir, nachdem ich sie aus unwürdiger, einsamer Gefangenschaft erlöst, sie mit neuen Kleidern versehen und in meine nächste Nähe versetzt habe.
So wie in fürstlichen Schlössern Weißzeugbeschließerinnen fungieren, ähnlich amtiert die alte Wälderin bei mir als eine Art Beschließerin.
Ihr schönster Dienst aber ist: sie erzählt mir in Stunden, in denen wir allein sind, aus ihrem langen, langen Leben.
Oft, wenn ich lebensmüde und welk und krank in meiner Studierstube auf meinem Ruhebett liege, sie mir gegenüber steht und ich meine Augen auf sie richte, fängt sie an, mir zu erzählen. Sie will mich, die gute Alte, auf andere Gedanken bringen und zerstreuen. Sie weiß, daß mich allerlei trübe Gedanken Plagen, wenn ich, unfähig zu geistiger Arbeit, so daliege. Sie hört mich seufzen: »'s ist ein Elend auf dieser Welt!« – und erzählt mir drum Geschichten, die mir neuen Mut machen sollen, des Lebens Last lautlos weiter zu tragen.
So ist sie mir in düstern Stunden eine liebe, treue Gefährtin, und wir lieben uns, so gut als alte Leute noch lieben können. Und obwohl sie viel, viel älter ist als ich, bin ich ihr doch von Herzen zugetan und würde sie um keinen Preis mit einer jungen vertauschen.
Ich habe aber meine gute, alte Trösterin und Erzählerin auch herausgeputzt, daß sie sich neben der schönsten Jungen sehen lassen kann.
Sie hat alle jene Tugenden, die sonst den meisten weiblichen Wesen fehlen: sie ist schweigsam und spricht nur, wenn sie merkt, daß es mir lieb ist; sie ist bescheiden, dankbar, unverdrossen und zufrieden, ob ich mit ihr rede oder, ohne Rücksicht auf sie, schimpfend und räsonierend vor ihr auf- und abgehe.
Ein katholischer Pfarrer soll bekanntlich keinen weiblichen Dienstboten halten, der unter vierzig Jahre alt ist. Meine Freundin hat mehr als das Doppelte des kanonischen Alters und enthebt mich so trotz unseres intimen Verkehrs jeder Verdächtigung.
Sie kam in früheren Diensten oft, sehr oft in Wirtshäuser und ist trotzdem das nüchternste weibliche Wesen, das es geben kann. So passen wir zwei auch in dieser Richtung zusammen. Auch ich kam in meinen jungen Jahren oft in Lokale, wo getrunken, viel getrunken wurde, und bin heute nüchtern wie eine alte Katze, die am Abend ihre Milch trinkt.
Alte Leute haben alte Bresten, und wenn es ander Wetter gibt, spüren sie diese Bresten und seufzen. Auch meine Freundin und ich teilen diese Beschwerden des Alters. Wenn draußen ein Sturm heult und der Regen an die Fenster schlägt oder wenn Nebel oder Schnee im Anzug sind und ich nachts schlaflos auf meinem Lager neben der Studierstube seufze, weil das Wetter durch meine Nervensaiten fährt wie durch eine verstimmte Aeolsharfe, – dann höre ich auch gar oft meine alte Freundin ächzen.
Ich denke dann lebhaft an ihre langen, schweren Dienste, und – so groß ist unsere geistige Sympathie – alsbald fängt sie wieder an, mir aus ihrem Leben zu erzählen, bis ich endlich einschlafe und träume von den Gestalten, die sie mir durch ihr Erzählen wachgerufen hat.
Neulich stellte ich neben sie ein anderes Wesen ihrer Art in meinen Dienst, ein junges, elegantes, reizendes Ding, das meine Korrespondenzen »führt«. Meine alte Freundin war keinen Augenblick eifersüchtig. Sie weiß, daß ich ihr treu bleibe, weil das junge Ding nichts zu erzählen weiß von guten, alten Zeiten und Menschen.
Es schaut zwar, stolz auf seine Schönheit und Jugend, verächtlich auf meine alte Freundin herab und kokettiert mit mir, so oft ich es ansehe; aber es rührt uns zwei Alte nichts – weder seine Verachtung, noch sein Liebeswerben. Wir bleiben uns treu bis in den Tod – in den Tod, den ich – so unglaublich es auch klingt bei ihrem hohen Alter – sicher vor ihr erleiden werde.
Sie wird's erleben, vielleicht bald, daß ich, ein toter Mann, im Sarg an ihr vorübergetragen werde; aber sie wird keine Träne weinen, weil sie längst weiß, daß ich gerne sterbe und froh bin, wenn's vorüber ist. Sie darf und soll in jener Stunde jauchzen für mich.
Sie weiß auch, daß ich für sie gesorgt habe, daß sie anständig zu leben hat, wenn ich nimmer bin. Ich hab' sie verpfründet nach Hasle, wo sie ihre zweite Heimat hat, wo sie längere Zeit lebte als ich, und wo sie, wie ich hoffe, in Ehren gehalten wird, so lange sie in der jetzigen Gestalt auf Erden weilt. Und sie wird noch lange hienieden weilen, ehe die Würmer und das Feuer auch sie verzehren und sie niederlegen in Staub und Asche.
Aber auch dann soll sie nicht vergessen sein. Drum will ich ihr hier ein Denkmal setzen, indem ich wiederhole, was sie mir in vielen Stunden erzählt hat. –
Meine Leserinnen werden längst ungeduldig sein und wissen wollen, was das für ein Wibervolk ist, von dem ich, der ungalante, grobe Hansjakob, nur Gutes rede und das ich lobe und liebe, aufrichtig und treu liebe, wie es sonst nicht Männerart ist.
»Endlich,« werden sie sagen, »einmal eine, die er lobt!«
Liebe Leserin! Dieses Muster und Ideal eines weiblichen Wesens, diese alte Dame, der mein Herz gehört und die ich wie ein Kleinod bewahre, ist niemand anders als – die Hausierkiste meines mütterlichen Großvaters, des Wälder-Xaveri, in der ich meine »eigenen Werke« aufbewahrt habe, und die junge Dame neben ihr ist ein reizendes Schränkchen, das ich mir nach einem alten Original im Museum zu Basel kopieren ließ und in welchem meine Korrespondenzen aufgehoben sind.
Meine alte Freundin will und soll uns nun ihre Erinnerungen erzählen, und sie wird, so hoffe ich, dadurch auch sich ein Denkmal setzen in den Herzen ihrer weiblichen Mitwesen und meiner getreuen Leserinnen.
Ich werde ihr bisweilen ins Wort fallen und meine »Schlenkerer« an ihre Erzählungen anknüpfen. Wenn ich mich dabei auch nicht immer ankündige, so wird der freundliche Leser doch gleich merken, ob ich rede oder die alte Holztante.
2
Meine Mutter, so beginnt die greise Freundin, war eine stattliche Tanne und stand an einer der schönsten Stellen des Schwarzwalds, am Fallbach zu Triberg, der berühmt ist durch seine Wasserstürze. Sie stand hoch oben, unweit der Straße, die nach Schönwald führt.
Ich verlebte bei ihr gute und böse Tage: gute, wenn die Sonne schien über Berg und Tal und die Vögel sangen in unsern Zweigen; böse, wenn Stürme tobten über den Wald her oder die Mutter zur Winterszeit ächzte unter der Last des Schnees.
Zu allen Zeiten aber rauschte, wie ein mächtig Wiegenlied, das Wasser des Fallbachs über die Felsen an uns vorüber. Wie oft hab' ich von der Mutter Brust weg hinabgeschaut in die schäumenden Wasser und sie beneidet, wie sie fortsprangen hinab ins Städtle Triberg und hinaus ins Kinzigtal und in die weite Welt!
Einmal äußerte ich diesen Neid auch der Mutter gegenüber, kam aber damit schlecht an. »Du dummes Kind,« sprach sie, »weißt du nicht, daß deine Reise in die Welt nur über meine Leiche geht? Deine Mutter muß sterben, wenn du hinaus in die Welt und zu den Menschen kommen willst. Die Wasser, die zu meinen Füßen hinrauschen und zu Tal springen, sie eilen in die Arme ihrer Allmutter, Meer genannt. Sie gehen heim, dorthin, woher sie gekommen sind, und kehren zu neuem Leben wieder zurück aus dem Ozean.«
»Wir Tannenbäume aber und unsere Kinder sind nicht so gut dran, wie die Wellen des Bächleins. Wir müssen sterben, wenn wir den Erdboden verlassen, auf dem wir groß geworden sind, und unsere Kinder müssen den Menschen dienen und sich gefallen lassen, was immer sie mit ihnen und aus ihnen machen wollen.«
»Doch je höher ein Geschöpf im Reiche der Natur steht, um so unglücklicher ist es. Wir Tannen küssen den Aether des Himmels, während die Bächlein in der Tiefe hinschleichen. Wir empfangen das erste und das letzte Gold der auf- und untergehenden Sonne, während die Wasser noch oder schon in der Finsternis dahineilen. Und doch sind sie unsterblich, wir aber stürzen und sterben.«
So sprach meine Mutter, und eine große Harzträne lief an ihrem schlanken Leib hinunter. Ich schwieg nun fortan, war jedoch durch ihre Worte nicht bekehrt. Die Jugend vernimmt ja die Mahnungen und Lehren des Alters meist mit tauben Ohren und glaubt erst an die Wahrheit dessen, was Vater oder Mutter gepredigt, wenn diese längst nicht mehr sind. –
Ich empfand trotz der Warnung der Mutter immer und immer wieder von neuem Sehnsucht, in die Welt und unter die Menschen zu kommen.
Es war mir zu öde und zu einförmig, das Leben bei der Tannenmutter, denn ich hatte zu wenig Unterhaltung. Ich spielte zwar manchmal mit dem Moos, das meiner Mutter Leib wie schneeiges Haar umsponnen hatte, oder mit den Ameisen, die zur Sommerszeit uns besuchten – aber das genügte mir nicht. Auch das Pärchen Kreuzschnäbel, welches jedes Jahr auf unsern Zweigen sein Nest baute und damit schon begann, wenn noch Schnee auf allen Bäumen lag, konnte mich nicht genügend unterhalten. Wenn das Männchen mit seiner roten Brust am Abend und am Morgen sein stilles Lied sang, hörte ich fast nichts davon ob des rauschenden Wasserfalles zu den Füßen meiner Mutter; und waren einmal die Jungen flügge, so flogen Eltern und Kinder davon und ließen uns den Sommer über allein.
In den Wurzeln meiner Tannenmutter hauste eine Familie Haselmäuse, denen ich oft zuschaute, wie sie eintrugen und ihre Jungen in den Wald mitnahmen und wieder heim. Und ich dachte manchmal, wenn ich nur ein Vöglein wäre oder ein Mäuslein und fliegen oder springen könnte.
An Sonntagen stiegen die Buben von Triberg am Fallbach herauf, spielten an den Wasserfällen oder suchten Vögel in unsern Tannenzweigen. Dann wuchs meine Sehnsucht noch viel mehr, fortzukommen unter die lustigen Scharen der Menschen. Ich hab' manch' Harztränlein geweint, weil ich nicht mitkonnte, wenn die heiteren Knaben am Abend, da die Betglocke vom Städtle herauf sie heimrief, hurtig an den stürzenden Wassern hinabsprangen.
An Samstagen sah ich regelmäßig unweit von uns auf der Landstraße Landleute betend vorüberziehen. Die Mutter sagte mir, das seien Wallfahrer, die in ihren Nöten hinüberwallten zu einem Muttergottesbild, das einst in einer Tanne gefunden worden sei.
Die Menschen, so belehrte sie mich weiter, hätten noch viel mehr Leid auszustehen, als die Tannenbäume in Wind und Wetter, und suchten darum Hilfe bei höheren Mächten. –
Manchmal hörte ich die Glocken von der Wallfahrtskirche herübertönen durch den »Wässerlewald«, und ich wünschte oft, auch einmal solch eine Wallfahrt mit ansehen zu können.
Wenn nicht Schnee und Eis den Weg am Bache hin ungangbar machten, zogen täglich Leute auf dem schmalen Saumpfad, der durch den Wald an den Wasserfällen hinführte, an uns vorüber. Denn sie hatten so näher, die einen hinauf nach Schönwald, die andern hinab ins Städtle.
Gar viel gingen Uhrenmacher mit ihren Uhren über der Schulter diesen Pfad, um hinabzuwandern »ins Land« und zu hausieren.
Die Mutter hatte mir erklärt, was eine Uhr sei, und dazu gespottet über die Menschen, daß sie die Zeit in die kleinsten Teile zerlegen und messen, als ob sie dann länger daran hätten.
»Wir Tannen,« sprach sie oft, höhnisch ihre Zweige schüttelnd, »wir brauchen keine Uhren und zählen die Minuten so wenig ab, wie die Nadeln an unsern Aesten. Wenn die Sonne aufgeht dort drüben über der Hochwälder Höhe, so wissen wir, daß es Morgen ist; und wenn die Strahlen des Lichts in unserem Wasserfall glitzern, ist's Mittag – und Abend, wenn die Sonne über den Kandel hinuntergegangen ist.«
»Die Menschen aber, diese Kleinigkeitskrämer, wollen jede Minute wissen am Morgen, am Nachmittag und am Abend, damit sie ihre kleinen Geschäfte, ihre Zwergarbeiten und ihre Vergnügungen darnach einrichten können. Sie zählen die Sekunden, und dann sterben sie, und die Sonne geht durch die Jahrtausende hin über ihren Gräbern auf und unter.« –
Still zogen die Uhrenmacher jeweils ihren Weg am Wasserfall hinunter, denn sie gingen schwerbeladen von der Heimat und schweren Herzens von Weib und Kindern weg. Wenn sie aber nach Wochen und Monaten am Wasser heraufkamen der Heimat zu, waren sie fröhlich und heiteren Sinnes.
Und die Mutter knüpfte daran immer ihre Lehren und Mahnungen, wie es nichts sei draußen in der Welt. »Siehst du,« so redete sie oft, »wie diese Schwarzwälder lustig aus der weiten Welt und aus dem großen Menschenleben heimkehren in ihre Hütten an einsamer Bergeshalde, und hast du gesehen, wie ungerne sie auszogen in die Fremde? Sie kennen die Welt und wissen, daß es daheim am schönsten ist. Drum hat auch ein Tannenkind, wie du, seine schönsten Tage bei der Mutter im Walde.« –
So kamen und gingen die Menschen an uns vorüber, vorüber auch an meiner ungestillten Sehnsucht, ihnen folgen zu dürfen – vorüber viele Jahre lang – bis mein Wunsch auf eine schauerliche Art erfüllt ward.
Es war – ich weiß es heute, mehr denn 100 Jahre später, noch genau – ein kalter Januartag des Jahres 1781. Schwere Lasten von Schnee lagen auf den Tannenzweigen; die Wasser des Fallbaches staubten wie flüssiges Eis, und alle Felsen am Bach hin glänzten wie Harnische.
Da stiegen mühsam, Steigeisen an den schweren Schuhen, Gamaschen an den Füßen, rothaarige Fuchspelzkappen auf den Köpfen und mit Stacheln versehene Stöcke in den Händen, zwei Männer an den Wasserfällen herauf.
Trotzdem sie Mühe hatten zu atmen, sogen sie doch an großen Tabakspfeifen und hielten oft stille, um bequemer rauchen zu können.
Als meine Mutter sie sah, erfaßte sie ein Zittern an Stamm und Aesten. »Kind!« sprach sie leise und ängstlich, »dort kommen die zwei Tannenmörder von Triberg, der Waldmeister und der Waldhüter. So oft die zur Winterszeit da heraufkeuchen, tun sie es, um Todesurteile zu fällen über schuldlose Waldbäume.«
»Die zwei, der Waldmeister Hans Schwer und der Waldhüter Peter Martin, haben meinen Großeltern und meinen Eltern den Tod gebracht. Ich fürcht', Kind, sie werden ihn auch mir und dir bringen.«
Die Männer kamen näher. Unweit der Mutter blieb der Waldhüter stehen, schaute an ihr hinauf, zeigte dann mit dem Stock auf sie und sprach: »I mein, die Tanne da könnten wir jetzt ou amol anreißen für die Holzmacher. Sie ist alt, das Moos zieht schneeweiß an ihr hinauf. Steht sie noch länger, so wird sie uns rot und faul. Und die Wurzeln sind auch los, Mäuse haben sie unterwühlt. Wenn im Hornung die Stürme kommen, stürzt sie uns in einer schönen Nacht in den Fallbach, und dann haben wir des Teufels Not, sie herauszubringen.«
»Bin ganz deiner Meinung, Peter,« meinte der alte Schwer-Hans; »reiß sie an!«
Jetzt zog der Waldhüter ein Hakenmesser aus seinem Mantel und riß ein großes Dreieck in der Mutter Leib. Sie erschauerte in Schmerz und Todesangst und schüttelte ihre Zweige so gewaltig, daß der Schnee herabfiel auf die beiden Mörder.
»I glaub', die merkt's, daß es ihr ans Leben geht,« sprach der Waldmeister, den Schnee von seinem Mantelkragen schüttelnd.
Sie gingen weiter, rauchend nach den andern Opfern spähend. Die Mutter schwieg einige Zeit; sie konnte es noch nicht fassen, daß sie sterben sollte. Ihr Schrecken löste sich zuerst in Weinen. Wie Wasser quollen die Harztropfen an ihrem Leib hinunter, wurden aber rasch von der Kälte erfaßt und zum Stillstand gebracht.
Nachdem sie sich ausgeweint, begann sie die Menschen zu verwünschen. »O, dieses blutschänderische Geschlecht!« rief sie aus. »Wie grausam geht es mit den anderen Geschöpfen und Wesen um, und doch sind wir alle, Steine, Pflanzen, Bäume, Tiere und Menschen, Kinder eines Vaters, der im Himmel ist!«
»Aber nichts ist diesem gottlosen Geschlechte heilig, seitdem es in seinem Hochmut dem Ewigen und Allmächtigen gleich sein wollte und aus dem Paradiese vertrieben wurde.«
»Alle Geschöpfe leiden unter ihm und seufzen nach Erlösung von ihrem Tyrannen, Mensch genannt. Ueberall trägt dieser die eigene Qual hin und sucht sein elendes Dasein zu fristen, indem er seine Mitgeschöpfe quält und tötet.«
»Auch unter sich selbst leben diese Menschen wie Hunde und Katzen und machen sich das Leben sauer, wo und wie sie nur können. Und das ist unser Trost, daß sie die Qualen, die sie uns antun, an sich selber wieder rächen.«
»Auch sterben müssen sie, diese Quälgeister,« fuhr, ihre Zweige schüttelnd, die Mutter fort, »hinsiechen und sterben. Tausend Krankheiten, die wir anderen Geschöpfe gar nicht kennen, suchen sie heim.«
»Wo die Menschen nicht hinkommen, da sterben die Bäume den schönsten Tod, den Tod des Alters. Der Sturm wirft sie, die schwachgewordenen, in den Staub, wo sie modern und neuen Pflanzen Leben geben.«
»Das allein ist mir gräßlich, von Menschenhand zu sterben. O, wie diese Axthiebe schmerzvoll durch alle Fasern gehen, und wie die Säge knarrt in Mark und Bein, bis wir umsinken, zum Tode verwundet!«
»Bald werden sie kommen, mein Kind, die Holzmacher mit großen Aexten und scharfgezähnten Sägen, und deine Mutter zu Tod martern.«
»Hilf mir beten, und ich selbst will alle meine Zweige flehend zum Himmel richten, auf daß der Herr der Natur, dessen Boten die Stürme sind, mir einen solchen Boten sendet, der mich hinabstürzt in den Fallbach!« –
Mir ging der Mutter Weh durch die Seele, und ich weinte und betete mit ihr um einen schnellen, natürlichen Tod.
Unser Flehen ward erhört. Wenige Tage, nachdem die zwei Triberger meine Mutter zum Tode verurteilt hatten, ging ein mächtiger Südwind über den Schwarzwald hin. Wärme und Kälte stießen so heftig auf einander, daß die Tannen wankten, schwankten und ächzten.
Die Mutter hatte mehr zu kämpfen als alle ihre Nachbarinnen. Es war ihr Todeskampf. Wie sie's erfleht hatte, so kam es. Mitternacht war's, als heulend ein letzter, starker Windstoß daherfuhr, die Mutter niederriß und in den Fallbach stürzte. Ich hörte nur noch, wie sie rief: »Gottlob um diesen Tod!« – und ich fühlte das eisige Wasser über uns zusammenschlagen. Dann verlor ich die Besinnung.
3
Unterhalb Triberg, wo die drei Waldbäche Schonach, Fallbach und Nußbach zur Gutach sich vereinigen, hieß man es in meiner Jugendzeit »am Bach«. Dort stand vor hundert und mehr Jahren eine Sägmühle, die dem »Bachjok« gehörte, der, nur durch die Straße davon getrennt, eine Wirtschaft »zum Hirschen« betrieb.
Als ich nach dem Sturz in die Wasserfälle wieder zum Bewußtsein kam, befand ich mich neben dieser Sägmühle. Die Mutter war zersägt, und ihre Kinder saßen als Dielen (Bretter) zwischen der Straße und der Mühle, ich, einst dem Herzen der Mutter am nächsten, in der Mitte, von meinen Geschwistern getrennt durch dünne Querhölzer, die kaum der Luft rechten Zugang gestatteten.
Mein Gott – war das ein Erwachen! Von der lichten Höhe am Wasserfall mit Fernsicht über Berge und Wälder herabgekommen in ein enges Tal, sah ich nichts durch die engen Ritzen, welche die Querhölzer gebildet, als ein Stückchen von der einsamen, holperigen Straße und ebensoviel von der Sägmühle. Und dazu konnte ich kaum Atem holen, so schwer lag's mir auf der Brust.
Nachts erblickte ich kein Sternlein am Himmel, dagegen huschte allerlei Ungeziefer, auch Mäuse, bei mir durch und scheuchte mich aus dem Schlafe auf.
Tags über und oft schon, ehe das erste Licht in das Tälchen dämmerte, hörte ich nichts als das Schnarren der Säge, einförmig und nervenzerreißend. Gegen diese Sägetöne waren die fallenden Wasser droben im »Wässerlewald« die reinsten Aeolsharfen gewesen.
Kein Vöglein sang ein Lied in der Nähe dieser Mühle, und was ich sonst noch hörte, wenn sie stille stand, waren die Reden der Menschen, das Fluchen durchziehender Fuhrleute und der Tatarengesang des Sägeknechts, eines alten Trunkenbolds.
Er hieß, weil er jahraus jahrein Dielen schnitt, der »Dillesepp«. Er war »am Oelberg« daheim, droben bei Schonach, wo sein Vater einst eine Sägmühle besessen und ihm vererbt hatte. Der Sepp hatte aber das Erbe bald vergeudet, weil er lieber im Wirtshaus als in der Mühle war.
Arm geworden, lernte er, wie viele, arbeiten und wurde Sägeknecht beim Bachjok, bei dem er aber allen Lohn in Wein und Schnaps umsetzte. Nüchtern arbeitete er wie ein Löwe, und es war ihm am Abend nicht zu spät und am Morgen nicht zu früh.
Aber wenn er zu viel hatte, so setzte er sich auf einen Dielenbaum und sang seine Lumpenlieder, bis der Bachjok, sein Meister, kam und ihn in seine Kammer auf der Sägmühle jagte, auf daß er seinen Rausch ausschlafe.
In der Kammer aber sang er noch lange, bis er einschlief, sein stehendes Trostlied:
Dillesepp, Dillesepp, Uf Sonneschi kommt Rege; Wenn der Rusch verschlofe isch, No tu' m'r (wir) wieder säge.
In aller Frühe ließ er dann schon wieder seine Säge laufen und pfiff und sang in den kommenden Morgen hinein.
Sein Weib hauste droben in Schonach in elender Herberge mit den Kindern und brachte diese und sich selbst bald arbeitend, bald bettelnd durch.
Bisweilen erschien sie, um einen Beitrag vom Dillesepp zu holen für ihre Haushaltung. So oft sie kam, hörte er auf mit Sägen und zog den Leerlauf, damit das Rad still stand. Nun lauschte er dem Begehren seiner Ehehälfte, dem er aber höchst selten gerecht werden konnte, weil er kein Geld hatte. Sie fing dann an zu schimpfen, er sei ein Lump, daß er ihr allein die Kinder am Hals lasse. Jetzt wußte sich der Dillesepp nicht anders zu helfen, als daß er seine Säge wieder in Gang setzte. Diese schnarrte so kräftig, daß das scheltende Weib ihre eigenen Worte nicht mehr hörte und schließlich von dannen zog, von meinem Mitleid begleitet.
Einmal lag er an einer Lungenentzündung darnieder. Man schickte seiner Frau Bericht. Sie kam und pflegte ihn mit aller Liebe und Treue. Sie bettelte auf den Bauernhöfen des Tales das Beste, was sie erhalten konnte, damit ihr Mann wieder zu Kräften kommen sollte.
Wenn sie aber von diesen Bettelfahrten etwas später heimkam in die Kammer auf der Säge, so überhäufte der Dillesepp das arme Weib mit den gröbsten Schimpfworten.
Oft saß sie auf unserm Dielenbaum und weinte. Wenn dann der Kranke aus seiner Kammer nach ihr rief, trocknete sie schnell die Tränen und eilte wieder zu ihm.
Damals schon kam ich zur Erkenntnis, daß der bessere Teil der Menschheit das Weib sei in seiner Treue, in seiner Geduld und im Ertragen der Mühen des Lebens.
Aber bei der Sägmühle am Bach erkannte ich auch, wie wahr meine Mutter einst am Fallbach mir gepredigt hatte, die Menschen nicht zu beneiden und sich nicht darnach zu sehnen, ihre Bekanntschaft zu machen. –
Die Sonne hatte im Frühling und im Sommer warm geleuchtet auf uns Tannenkinder im engen Schwarzwaldtal. Aus allen Ritzen entwich krachend das Tannenblut, und wir wurden immer toter und immer trockener, aber dadurch auch reif für den Menschen.
Unser Herr war der Bachjok; er hatte meine Mutter von der Gemeinde Triberg gekauft, so wie sie im Wasser lag unterhalb des Städtles, wohin der Fallbach sie getrieben.
Im Herbst kam nun ein oder das andere arme Schreinerlein, das auf den Höhen um Triberg in einsamer, schindelgedeckter Hütte sein Gewerbe trieb. Diese Schreiner fertigten meist Uhrenkästen für ihre Nachbarn, die ebenso vereinsamten Uhrenmacher. Sie kamen und holten Bretter beim Bachjok und plauderten an sonnigen Tagen mit dem Dillesepp.
Von ihnen hörte ich, daß der erste, so in der Vogtei Triberg eine Uhr erfunden, der Franz Ketterer von Schönwald gewesen sei. Vor siebzig Jahren habe er seine Erfindung in die Welt gesetzt. Sein Sohn gleichen Namens habe 1720 die erste Kuckucksuhr gefertigt und eine hölzerne Taschenuhr.
Die Leute alle lobten diese zwei Meister, weil sie Geld und Verdienst auf den Schwarzwald gebracht hätten.
Heute sind diese Erfinder, wie viele andere Alt- und Hochmeister der Uhrenfabrikation aus ihrer Zeit, so der Dilger-Sime aus der Schollach, der Dufner-Hans von Schönwald, der Löffler-Mathis aus dem Gütenbach und andere Patriarchen der Uhrenmacherei, vergessen.
Kein Bild, kein Stein erinnert an diese großen Naturmenschen, trotzdem der Schwarzwald voll ist von Uhrenmachern, die ihnen alle zu Dank verpflichtet wären.
Der Dilger-Fritz, des Simons Sohn, war der erste, der die Holzuhren seiner Heimat nach Paris trug und von dort mit einem roten Frack und neuen Ideen heimkehrte. Er machte jetzt Uhren mit beweglichen Figuren, die Feuer schlugen und Schwefelfäden anzündeten.
Der Kammerer-Sepp, Wirt im Hirschwald bei Triberg, fertigte 1768 die erste Uhr mit Glockenspiel.
Wie das vorige Jahrhundert in der Literatur, in der Philosophie, in der Kunst einen ganzen Wald von großen Menschen hervorbrachte, so wimmelte es damals auch auf dem Schwarzwald von Denkern und Erfindern.