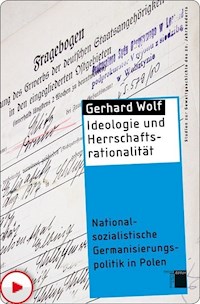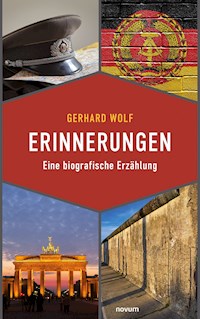
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die Stasi seinen achtzehnjährigen Sohn wegen Verbreitung "staatsfeindlicher Losungen" ins Visier nimmt, muss der dekorierte DDR-Stabsoffizier Gerhard Wolf Stellung beziehen. Soll er sich von seinem Kind lossagen, seine Karriere gefährden und alles bisher Erreichte aufgeben? Anekdotenreich und humorvoll blickt Wolf auf siebzig Jahre seines bewegten Lebens in zwei politischen Systemen, drei Staaten und drei Ehen zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum 4
Widmung 5
Vorwort 6
Ich komme auf die Welt 7
Ich bleibe kein Einzelkind 10
Mein erstes selbstverdientes Geld 15
Ich komme in die Schule 19
Der Kleingarten 22
Vier Generationen in einem Haus 24
Ich bekomme eine Brille 28
Lesen – meine Leidenschaft 30
Ich entdecke das Kino für mich 31
Der erste Weltraumflug 35
Meine Zeit der Streiche und Abenteuer 36
Meine erste Zigarette 40
Meine erste Liebe 44
Die Teilung Deutschlands 47
Der Umzug 48
Ich bin „der Neue“ 51
Meine Jugendweihe 58
Mein künstlerisches Talent wird entdeckt 64
Die neue Banknachbarin 67
Ich erlerne einen Beruf 73
Das Bratkartoffel-Verhältnis 86
Ich werde Offiziersschüler 88
Ich gründe eine Familie 96
Ich werde Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) 104
Ich werde Vater 106
Haben wir denn wieder Stalingrad? 113
Das dynamisch-motorische Stereotyp 116
Glück im Spiel – Pech in der Liebe 118
Leutnant der Deutschen Volkspolizei 121
„Aktivist der sozialistischen Arbeit“ 125
Es ist noch Glut unter der Asche 129
Das neue Heim 132
Meine zweite Hochzeit 134
Die Adoption 136
Urlaub im Grenzgebiet 137
Einladung zur Hochzeit 139
Das neue Familienregime 141
Stoppel 144
Der merkwürdige Aufstieg Astrids 146
Ich habe gesundheitliche Probleme 148
Ich komme zur „richtigen“ Polizei 150
Mutti stirbt an Krebs 154
Die „Wende“ 156
Die Grenze ist offen! 162
Das Begrüßungsgeld 165
Existenzangst 168
Die Wiedervereinigung 171
Mit dem Bus nach Paris 173
Mein erstes Auto 175
Urlaub in Spanien 177
Personalangelegenheiten 180
Astrids neuer Job 182
Wir haben wieder einen Sohn 187
Die Meinungsfreiheit 190
Das Eigenheim 192
Der Unfall 195
Szenen einer Ehe 197
Karge Zeiten 200
Gitta 203
Endlich wieder einmal Urlaub in Spanien 204
Wally 207
Die neue Liebe 210
Stoppel stirbt 213
Mein neuer Job 216
Schlaganfall und Prostatakrebs 219
Die Entlassung in den Vorruhestand 222
Ich lerne Maricela kennen 228
Andreas ist arbeitslos 231
Das „Casa Negra“ 233
Maricela kommt zur Bauabnahme 239
Mein Rückzug 244
Meine Freundin Karin 246
Meine dritte Hochzeit 249
Die Reise nach Deutschland 251
Die Fahrt nach Andalusien 253
Maricela lässt sich zur Friseurin ausbilden 256
Maricela geht in ihre Heimat zurück 259
Andreas gründet eine Familie 261
Ich wohne wieder in Comarruga 263
Die Corona-Pandemie 265
Mein Enkel Levi 269
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-474-5
ISBN e-book: 978-3-99131-475-2
Lektorat: Dagmar Heißler
Umschlagfoto: Lunamarina, Tobias Machhaus, Badboo, Steve Scott | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
Meiner Tante Gisela gewidmet
Vorwort
Die nachfolgenden ERINNERUNGEN sind eine autobiografische Aufzählung von kleinen und großen Höhepunkten in meinem bisherigen persönlichen Leben.
Ich habe mich bemüht, auch einen Zusammenhang mit den jeweils aktuell vorherrschenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen herzustellen.
Das Schreiben hat mir sehr viel Spaß gemacht! Vor allem, weil Erinnerungen an Einzelheiten aufgetaucht sind, die ich eigentlich schon längst vergessen meinte.
Ich hoffe und wünsche, dass der Leserin, dem Leser die Lektüre ebensolches Vergnügen bereitet, wie es mir beim Schreiben vergönnt war.
Gerhard Wolf
Ich komme auf die Welt
Als ich auf die Welt kam, zeigte der Kalender den Monat Juli an. Es war am frühen Vormittag eines Samstags. Meine Ankunft war wenige Augenblicke vorher vom schrillen Rasseln der Pausenklingel der Grundschule in Lobstädt angekündigt worden.
Meine Mutter war Neulehrerin und bewohnte ein kleines möbliertes Zimmer unter dem Dach dieser Schule, an der sie unterrichtete. Die Klingel war zwar bis dort hinauf zu hören, bestimmte jedoch meinen Werdegang als Neugeborenes in keiner Weise.
Mein Vater war nach der Teilnahme am Zweiten Weltkrieg, als Flakhelfer, aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Dann hatte er seine durch den Krieg unterbrochene Schulausbildung an der Oberschule in Borna fortgesetzt und das Abitur abgelegt. Gemeinsam mit anderen Klassenkameraden hatte er dort eine Jugendtanzkapelle gegründet. Die jungen Männer probten an mehreren Tagen in der Woche nach dem Unterricht. An den Wochenenden spielten sie in verschiedenen Gasthöfen der Umgebung zum Tanz auf.
Beim Tanz in der Silvesternacht 1946/47 hatte mein Vater, der eine Ausbildung zum Kfz-Schlosser machte, meine Mutter kennengelernt. Die beiden jungen Leute verliebten sich ineinander und verbrachten viel Zeit miteinander. So blieb es nicht aus, dass die frischgebackene Neulehrerin Margot schwanger wurde und der künftige Kfz-Schlosser Klaus Vaterfreuden entgegensah.
Im März 1948 heirateten sie. Ich sollte in geordneten Familienverhältnissen aufwachsen, was ich in den folgenden Jahren auch ausgiebig genießen konnte.
Meine Großeltern waren jedoch wenig erfreut über die eingetretene Situation. So gab weder einen zünftigen Polterabend noch ein rauschendes Hochzeitsfest. Still, nur zu zweit und bescheiden verbrachten meine Eltern den Abend vor der Trauung. So setzte sich auch ihr späteres Leben fort.
Ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass ich kein sogenanntes Wunschkind war. Ich war wohl eher ein „Verkehrsunfall“. Dennoch bin ich am 3. Juli 1948, im Sternzeichen Krebs, geboren worden. Natürlich kann ich mich nicht mehr an Einzelheiten erinnern. Nur an Anekdoten, die ich später aufschnappte. Es war damals noch üblich, zu Hause zu gebären. Meine Geburt verlief wohl auch ohne nennenswerte Probleme. Es war jedenfalls kein Transport in den Kreißsaal einer Klinik nötig. Später hat man mir aber erzählt, dass die anwesende und regieführende Hebamme bei meinem Erscheinen alle Umstehenden dringlichst aufgefordert hatte, mich festzuhalten, um wohl zu verhindern, dass ich auf die Gardinenstange klettere. Mein Körper soll beinahe komplett behaart gewesen sein. So wie man das von Affen kennt.
Was ging im Kopf dieser braven Frau vor sich? Meine Mutter, noch erschöpft von den Anstrengungen des Geburtsvorgangs, aber stolz, einen Jungen auf die Welt gepresst zu haben, bekam einen derben Dämpfer ihrer Emotionen. Ihr Sohn, der künftige Stammhalter, wurde mit einem Primaten, mit einem Kletteraffen aus dem Zoo verglichen!
Nun, das mit der Körperbehaarung hatte sich dann recht bald gegeben, und ich konnte vorgezeigt werden. Über die typischen Entwicklungsetappen „zur Menschwerdung des Affen“, also vom Liegen über das Krabbeln bis zum aufrechten Gang, kann ich auch keine verbindlichen Aussagen treffen.
Mir wurde jedoch lange Zeit vorgeworfen, dass ich mich vor Spinat eklatant geekelt habe, wobei der doch aufgrund seines hohen Vitamin- und vor allem Eisengehalts sehr gesund sein soll. Ich soll den babylöffelweise gefütterten Spinatbrei jedoch wider allen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen im hohen Bogen ausgespuckt haben. Dabei soll ich mit solcher Wucht agiert haben, dass sogar die weit entfernt hängenden Gardinen unter Beschuss gerieten. Einige Zeit später hatten ja dann auch führende internationale Ernährungswissenschaftler eingestehen müssen, dass der hohe Eisengehalt im Spinat nur durch eine versehentliche Verschiebung einer Kommastelle in einem früheren Analyseprotokoll zustande gekommen war. Mein gesunder Menschenverstand hatte das schon weit vorher erkannt!
Ich kann mich aber recht gut daran erinnern, dass ich einige Zeit später leidenschaftlicher und vor allem tollkühner Pilot eines Dreirads war. Auch im Winter gab es für mich keine verschneite Piste, die ich mich nicht mit dem Rodelschlitten hinuntergewagt hätte. Zur Verwunderung aller hatte ich mir nie eine Fraktur zugezogen. Die kleinen Prellungen und Blessuren steckte ich ohne jämmerliches Gezeter oder lautes Wehgeschrei weg, denn ein Mann weint ja bekanntlich nicht.“
Ich hatte auch keinerlei Furcht vor freilaufenden Tieren. Selbst wenn sie mich an Körpergröße überragten. So schleppte ich neben streunenden Katzen oft auch herrenlose Hunde nach Hause. Einmal kam gar eine Dogge willig mit mir mitgelaufen. Ich musste meinen Arm weit nach oben strecken, um das Halsband greifen zu können. Nachdem dieses „Ungetüm“ zwölf mit Margarine bestrichene dicke Scheiben eines wagenradgroßen Bauernbrotes verschlungen hatte, kam jedoch alsbald der nach ihm suchende Besitzer vorbei und nahm den Hund mit sich.
Wir wohnten inzwischen in einer kleinen, sehr schlichten Wohnung im Obergeschoß eines ehemaligen Pferdestalls. In der einstigen Wohnung des Kutschers. Hinauf führte eine sehr steile Holztreppe. Im unteren Geschoß waren einst die Pferde und Kutschen untergebracht. Diese Räume dienten jetzt als Lagerraum. Ein Bad hatten wir nicht in dieser Wohnung. Die Toilette war ein „Häuschen“, und das stand unten im Hof.
Dort hatten meine Eltern auch einen kleinen Verschlag zurechtgezimmert, in dem sie Kaninchen züchteten. Einmal hatte die „Zibbe“, so nennt man wohl die Häsin, ihren Wurf abgelehnt und begonnen, ihre Kaninchenbabys totzubeißen. Flugs hatte meine Mutter ein Körbchen mit Watte ausgekleidet und die Kleinen hineingetan. Mit einem Fläschchen, gefüllt mit lauwarmer Kuhmilch, wurden sie nun mühevoll aufgezogen. Ob diese Rettungsaktion von Erfolg gekrönt war, weiß ich heute nicht mehr.
Ich bleibe kein Einzelkind
Während ich meine erste Zeit als Baby in warmen Sommermonaten genießen konnte, kam meine Schwester knapp drei Jahre später Anfang März zur Welt. An diesem Tage hatte es wohl sogar geschneit. Ich durfte weder Augen- noch Ohrenzeuge der Geburt sein. So wurde ich vorsorglich bei den Großeltern untergebracht. Erst als alles vorbei war, holte mich mein Vater nach Hause. Schon vor dem Gebäude hörte ich das Babygewimmer, deutete es aber zunächst als das Miauen einer neuen Katze. Wir hatten eigentlich immer eine Katze im Haus. Es war immer etwas zum Streicheln und Spielen da.
Wenig später wurde mir meine Schwester präsentiert. Zu meinem Leidwesen war ich nun nicht mehr Mittelpunkt der Familie. Zudem konnte man ja mit diesem wimmernden Knäuel nicht spielen. Ich stand auch immer irgendwie im Weg, musste mich still verhalten, wenn sie schlief. Wozu war Barbara also gut? Erst viel später war sie einigermaßen als Spielgefährtin zu gebrauchen.
Das dauerte mir zu lange. Ich sah mich nach anderen Beschäftigungen um. Gegenüber, in dem Haus auf der anderen Straßenseite, wohnten zwei Schwestern. Ältere Damen schon. Sie betrieben einen kleinen Getränkehandel. Die Getränke wurden in Holzfässern angeliefert. Es gab Bier, Malzbier und Brauselimonade. Diese Getränke wurden in Flaschen abgefüllt, die mit einem Schnappbügel verschlossen wurden. Die gefüllten Flaschen wurden in Bierkästen aus Holz gelagert und zum Verkauf angeboten. Leergetrunkene Flaschen wurden wieder dort abgegeben. Sie wurden gereinigt und erneut befüllt. Die Flaschenreinigung erfolgte mit heißem Wasser, in das wohl auch ein mildes Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegeben wurde. Diese Lauge war in einen großen Holzbottich gefüllt. Die Flaschen wurden hineingelegt und füllten sich dort blubbernd mit dem Reinigungswasser. Nun begann der Reinigungsvorgang. Immer zwei Flaschen wurden dem Bottich entnommen. Eine davon wurde entleert und etwa halbvoll mit sehr kleinen Stahlkugeln gefüllt. Geschickt wurden dann die Flaschenhälse mit ihren Öffnungen aneinandergehalten, senkrecht gestellt und kräftig geschüttelt. Wenn die Stahlkugeln aus der oberen Flasche in die untere Flasche gelangt waren, wurden die Flaschen gedreht und der Vorgang mehrfach wiederholt.
Ich konnte stundenlang dieser fingerfertigen Handhabung zusehen. Mich faszinierte auch das Geräusch der herabrieselnden Stahlkugeln. Wenn man die Augen geschlossen hielt, hörte man einen leichten Sommerregen. Damals wusste ich noch nichts über die australischen Aborigines und ihr Didgeridoo, ihr „Regenrohr“.
Ich spielte auch mit den zahlreichen Katzen, die dort herumliefen. Ein hochkant gestellter Bierkasten, bei dem der Boden fehlte, diente mir als „Dompteurutensil“. Dort lockte ich die Katzen, von einem Fach ins andere zu kriechen. Also vorn herein und auf der anderen Seite in einem der nächsten Fächer wieder zurück. Eine Art „Bierkasten-Slalom“.
Die beiden Damen spendierten mir auch hin und wieder ein Bier. Ein Malzbier. Dazu luden sie mich sogar in ihr Wohnzimmer ein. Dort stand eine richtige Palme. Ich durfte mich in einen der wuchtigen Plüschsessel setzen. Das Malzbier wurde mir natürlich in einem Trinkglas serviert. Ich genoss es, den Bierschaum von den Lippen zu lecken.
Eine der beiden Damen hatte ihren Sohn schon im Ersten Weltkrieg verloren. Mit meiner Erscheinung erinnerte ich wohl sehr an ihn. Sie hatte mir einmal ein verblichenes Foto von ihm gezeigt. Ich konnte jedoch keine Ähnlichkeit mit mir entdecken. Das Foto zeigte ja auch einen jungen Mann und keinen Dreikäsehoch mit knapp vier Jahren, der ich damals war.
An den Sonntagen machten wir stets einen Familienspaziergang. Wenn es nicht gerade regnete. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob es in diesen Jahren überhaupt einmal geregnet hatte. Vielleicht einmal nachts, wenn ich schlief.
Zu diesen Spaziergängen musste man sich natürlich fein anziehen. Fein bedeutete für mich: blitzblankgeputzte Schuhe, irgendein helles Oberteil, eine helle kurze Hose und weiße lange Strümpfe. Ich durfte schon die steile Treppe nach unten gehen, musste aber vor dem Haus auf die Familie warten, die noch damit zu tun hatte, sich selbst festlich zu kleiden. Am langsamsten war wohl meine Schwester. Denn es dauerte immer ewig, bis sie unten auftauchte. Sie wurde natürlich die Treppe heruntergetragen und dann in den Kinderwagen gesetzt. Ich musste laufen. Es kam nicht selten vor, dass mir die Warterei zu lange dauerte und ich inzwischen eine kleine Beschäftigung gefunden hatte. Natürlich blieben dabei vor allem meine weißen Strümpfe nicht sauber. Dann tolerierten meine Eltern zwar die inzwischen mit Tarnmusterung versehenen Strümpfe, aber mein verschmutztes Gesicht nicht. Mutti nahm dann ein Taschentuch, befeuchtete es mit Speichel und rubbelte mir die Verunreinigungen aus dem Gesicht. Mich schüttelt es heute noch, wenn ich daran denke.
Dann ging es endlich los. Es gab zwei Standardziele für den Spaziergang. Entweder eine Runde um den Breiten Teich oder eine Wanderung zum Lerchenberg. Am Breiten Teich gab es immer viel zu sehen. Auf dem Wasser konnte man mit Ruderkähnen fahren, die man sich ausleihen konnte. Mit meiner Schwester im Kinderwagen war das ein riskantes Unterfangen und kam deshalb nicht infrage. Zum anderen brauchten meine Eltern das Geld, das man für die Kahnausleihe hätte zahlen müssen, sicherlich für nützlichere und dringlichere Dinge. So blieb der Rundgang um den See zu Fuß. Man konnte viele Leute sehen, was auch sehr interessant war. Es war erstaunlich, welche Garderobe manche trugen. Aber man musste auch höllisch aufpassen, dass man jeden entgegenkommenden Bekannten aus der Nachbarschaft rechtzeitig und freundlich grüßte.
Der Lerchenberg ist eine kleine bewaldete Anhöhe etwas außerhalb der Stadt. Dort ging ich lieber spazieren. Ich musste zu diesem Spaziergang auch nicht unbedingt weiße Strümpfe tragen. Es war ein richtiger kleiner Wald. Meine Eltern erklärten mir die einzelnen Baumarten und nannten mir die Namen der Vögel, die dort herumflatterten. Einige erkannte ich recht bald an ihrem typischen Gezwitscher. Auch verschiedene Pflanzen lernte ich kennen.
Im Herbst sammelten wir dort Pilze. Manchmal reichte es für eine kleine Mahlzeit. Es war aber immer kaum mehr als eine Kostprobe.
Am südlichen Waldrand gab es eine Silberfuchsfarm. Durch den penetranten Gestank wurde man schon von Weitem darauf aufmerksam. Es war für mich sehr interessant, die Tiere in ihren Käfigen zu beobachten.
In den Sommermonaten gab es keine Sonntagsspaziergänge. Wir fuhren mit den Fahrrädern ins Grüne. Meine Schwester saß im Körbchen, das am Lenker von Muttis Fahrrad befestigt war. Ich saß auf einem kleinen Fahrradsattel, der auf der Querstange bei Vatis Fahrrad montiert war. Auf den großen Gepäckträgern wurde ein großer Picknickkorb, aber auch eine große Regenplane und eine Decke verstaut. So ging es los!
Unser Lieblingsziel war der Colditzer Wald. Meist rasteten wir auf dem dortigen Hochbehälter. Das war eine spärlich bewachsene Erhebung über einer Anlage der Wasserwirtschaft. Vergleichbar mit einem Wasserturm. Von dieser Anhöhe aus hatte man einen herrlichen Rundblick über die Landschaft. Die Decke wurde ausgebreitet, und alle nahmen darauf Platz. Zum Picknick gab es meist Kartoffelsalat mit gekochtem Ei. Den Durst konnte man sich mit kaltem Pfefferminztee löschen. Den Tee hatte Mutti in solche Bügelverschlussflaschen abgefüllt, wie ich sie im Haus gegenüber kennengelernt hatte.
Im Spätsommer fuhren wir dorthin, um Hagebutten zu pflücken. Diese Früchte der Wildrose wurden grob zerkleinert und getrocknet. Man konnte sie dann mit heißem Wasser überbrühen und erhielt einen sehr wohlschmeckenden und gesunden Tee. Durch den hohen Vitamin-C-Gehalt der Hagebutte wird das Immunsystem gestärkt.
In dieser letzten Phase des Sommers fuhren wir auch mit den Fahrrädern ein Stück weiter aus dem Ort als gewöhnlich. Entlang einiger Chausseen standen Apfelbäume, die viele ihrer Früchte abgeworfen hatten. Diese Äpfel sammelten wir auf und brachten sie nach Hause. Dort wurden sie gewaschen, geschält, in mundgerechte Stücke geschnitten, in Gläser gefüllt und eingeweckt. Oder die Stücke wurden gekocht und durch die Fruchtpresse gegeben, auf diese Weise wurde Apfelmus gewonnen. Dieses Apfelmus wurde auch eingekocht. Das schmeckte später sehr lecker zu knusprig gebratenen Kartoffelpuffern.
Wir Kinder, meine Schwester Barbara und ich, halfen oft und auch gern im Haushalt. Besonders gern beim Kuchenbacken. Dann galt es oft, einen Rührlöffel abzulecken oder eine Schüssel auszuschaben. Ich sah Mutti auch gern beim Kochen zu, durfte umrühren und auch abschmecken. Später wollte ich immerhin Koch werden. Koch auf einem großen Überseedampfer.
Schon in meinen ersten Lebensjahren besaß ich ja einen fahrbaren Untersatz. Ein Dreirad. Das war sehr stabil, was es auch sein musste, denn ich strapazierte es außerordentlich. Hügel, aber auch Treppenstufen fuhr ich oft im Stehen hinunter. Das Dreirad hatte jedoch keine Handbremse, und wenn ich auf der Sitzfläche stehend einen Abhang hinunterfuhr, konnte ich nicht mit den Pedalen bremsen. Also lenkte ich das Dreirad in eine Richtung, in der ein „weiches“ Hindernis, wie etwa ein Gebüsch, vorhanden war oder die rasante Bergabfahrt in eine Bergauffahrt überging. Es war damals kaum Verkehr auf den Straßen und in unserer Wohngegend sowieso nicht.
In Erinnerung habe ich, dass ich einmal dennoch unter einem Pferdegespann zum Halten kam. Stets hatte ich aufgeschlagene Knie und Ellenbogen, und mein Dreirad hatte eine kaum noch erkennbare Lackierung.
Als ich dann etwas größer und älter war, bekam ich einen Holzroller. Der war rotlackiert und hatte Hartgummibereifung. Den strapazierte ich ebenso wie einst mein Dreirad. Keine Abfahrt war rasant genug, und bei den Rennen im Gelände oder auf dem Fußweg, die ich mir mit den Nachbarskindern lieferte, schonte ich das Fahrzeug keineswegs.
Mein erstes selbstverdientes Geld
Wir waren umgezogen und wohnten jetzt zur Miete in einer Hälfte einer großen Wohnung im Parterre einer Villa. Dort hatten wir endlich ein Bad mit Badewanne und eine Toilette mit Wasserspülung. Vati arbeitete als Kfz-Schlosser im Fuhrpark der Handelsorganisation Konsum.
Der Konsum war eine Handelsgenossenschaft, die flächendeckend in der DDR Lebensmittel- und sogenannte Industriewarengeschäfte unterhielt. Man konnte also neben Lebensmitteln aller Art auch Fahrräder, Küchenutensilien und Elektrogeräte wie Heizkörper, Kühlschränke und Waschmaschinen kaufen. Da es bei Waschmaschinen und Kühlschränken ständig Lieferengpässe gab, musste man sich in eine lange Warteliste eintragen. Die Wartezeiten erstreckten sich auf bis zu zwei Jahre! Als Konsum-Genossenschaftsmitglied bekam man nach jedem Einkauf, der Einkaufssumme entsprechend, sogenannte Rabattmarken. Diese konnte man säuberlich in ein spezielles Rabattmarkenheft einkleben. Einmal im Jahr konnte man diese Rabattmarken abrechnen und bekam dafür eine winzige Prozentzahl der Gesamteinkaufssumme rückerstattet.
Im Volksmund wurde Konsum so buchstabiert:KaufeohnenachzudenkensofortunsernMist!
Es gab noch die Läden der Handelsorganisation (HO). Dort bekam man keine Rabattmarken. Die Verkaufsartikel waren in der Qualität geringfügig besser und der Verkaufspreis auch höher. Einen winzigen Teil des Lebensmittelverkaufs bestritten einige kleine „Tante-Emma-Läden“. Es gab auch wenige private Verkaufseinrichtungen für sogenannte Eisenwaren.
Vati war eine Zeit lang als Kraftfahrer beim Konsum eingesetzt. Oft brachte er leere Obststiegen mit. Wir hatten Ofenheizung, und mit dem Holz dieser Kisten konnte man vorzüglich das Feuer entfachen und dann die Kohle drauflegen.
Ich bekam meine erste bezahlte Arbeit! Vati erklärte mir, wie man mit der Zange die Nägel aus den Kistenbrettchen ziehen kann. Diese Stahlstifte waren natürlich oft krumm und verbogen. Dann hieß es, sie gerade zu klopfen. Zum Schluss sortierte ich sie in leere Streichholzschachteln. Für jede mit Nägeln gefüllte Streichholzschachtel erhielt ich zehn Pfennige. Das war eine mühsame Arbeit, aber ich konnte mir von dem Geld Naschereien kaufen. Noch wichtiger war für mich, das Kleingeld zu sparen und dann auf dem Rummel auszugeben.
Mindestens zweimal im Jahr war Jahrmarkt auf einer großen Freifläche in der Nähe des Breiten Teichs. Nicht weit entfernt von unserer Wohnung. Dort konnte ich mit meinem „Nägelgeld“ einige Fahrten mit verschiedenen Karussells bezahlen. Es gab dort damals auch Karussells, bei denen man als „Anschieber“ tätig werden konnte. Die Ebene mit den Figuren und Gondeln, die man für eine Karussellfahrt besteigen konnte, war etwas erhöht. Darunter war eine Ebene, in der sich Haltegriffe befanden, und mit Freiwilligen wurde das Karussell angeschoben. Eine Fahrt währte wohl zehn Runden. Wenn man zehn Fahrten, also einhundert Runden, angeschoben hatte, durfte man eine Fahrt gratis machen. Beim Anschieben kam man ganz schön ins Schwitzen, und der aufgewirbelte Staub setzte sich auf Gesicht und Armen fest. Man sah beinahe aus wie nach dem Brikettstapeln im Keller.
Für unsere Ofenheizung mussten wir Briketts anliefern lassen. Entweder kam ein Pferdegespann vor einem großen Holzwagen oder ein mittelgroßer Lkw. Die aus Braunkohle gepressten Briketts wurden auf der Straße in der Nähe unseres Kellerfensters abgekippt. Dann wurde eine Holzrutsche ins Kellerfenster gelehnt. Darauf legte eine Person, meist meine Schwester, die Briketts und ließ sie nach unten in den Kellerraum rutschen. Unten im Keller war eine andere Person, meist ich, die dann die Briketts ordentlich gegen eine Kellerwand stapelte. So nahmen sie viel weniger Platz in Anspruch. Mindestens zwei oder gar drei Basisreihen mussten zunächst sehr akkurat auf den Kellerboden gelegt werden. Mit kleinen Holzstücken oder Leisten musste dabei ein geringes Gefälle in Richtung der Kellerwand justiert werden. So rutschten die Briketts beim Stapeln nicht nach vorn, und der Stapel konnte später auch nicht umfallen. Der Kellerraum war mit Kohlenstaub gefüllt, der sich nicht nur auf der verschwitzten Haut ablagerte. Er kroch auch unter die Wäsche, in die Nasenlöcher und in die Ohren. Hinterher musste gebadet werden. Manchmal kam beim Schnäuzen noch am Folgetag Kohlenstaub aus der Nase.
Die Briketts waren nicht billig. Vati hatte wenig später eine Arbeit im Braunkohlenwerk gefunden. Dort gab es zusätzlich zum Monatslohn als Deputat zwei Liter hochprozentigen fuseligen Schnaps. Der wurde als „Kumpeltod“ bezeichnet. Viel, viel wichtiger waren jedoch fünfzig Zentner Braunkohlenbriketts als Jahresdeputat.
Das Braunkohlenwerk in Borna war zunächst einer der sehr zahlreichen Betriebe der SAG. Die Sowjetunion hatte sämtliche Großbetriebe zu Sowjetischen Aktiengesellschaften (SAG) organisiert. Ziel war es, im Rahmen der Reparationen nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Gewinne in den sowjetischen Wirtschaftshaushalt abzuführen. Nach der Gründung der DDR wurden diese SAG-Betriebe in Volkseigene Betriebe (VEB) umbenannt. Organisatorisch wurden sie entsprechend dem Produktionsprofil zu Kombinaten vereint.
Zu dieser Zeit wurden noch Lebensmittelkarten vergeben. Je nach Haushaltsstärke gab es Zuteilungen für Fleisch- und Wurstwaren, Butter und auch Milch. Die Milch musste man beim Milchhändler holen. Ähnlich einem Zugschaffner lochte der mit einer Zange die vorgelegte Milchmarke, kassierte das Geld und schöpfte dann mit einem Litermaß aus einer großen Milchkanne die anteilige Milch in die mitgebrachte kleine Kanne. Solch eine Kanne fasste wohl bis zu zwei Liter. Unsere Milchkanne war aus dünnem Aluminium, hatte einen Deckel und einen dünnen Henkel mit einem hölzernen Tragegriff. Andere hatten wesentlich stabilere Kannen aus emailliertem Stahlblech mit entsprechend stabilen Henkeln.
Einmal traf ich auf dem Heimweg ein paar ältere Jungs. Sie führten mit ihren Milchkannen Mutproben durch. Dazu wurde der Deckel entfernt und dann die Milchkanne am gestreckten Arm so schnell herumgeschleudert, dass die Milch nicht herausfloss. Das war für mich beeindruckend und der erste Kontakt mit physikalischen Gesetzen. Die beim Schleudern entstehende Fliehkraft hielt die Milch in der Kanne zurück. Natürlich beteiligte ich mich an dieser Mutprobe, ohne zu bedenken, dass der Henkel meiner Kanne aus weichem und dünnem Aluminium war. So kam es, wie es kommen musste: Meine Milchkanne flog im hohen Bogen in die Luft, um dann sehr hart auf dem Gehwegpflaster aufzuschlagen. Die tägliche Milchration versickerte im Erdreich, und die Kanne war aufgeplatzt!
Ich komme in die Schule
Mein erster Schultag war am 1. September 1955. Das war natürlich ein aufregender und schöner Tag. Stolz schleppte ich meine riesige „Zuckertüte“ nach Hause. Meine kleine Schwester bekam natürlich auch eine kleine Zuckertüte, obwohl sie noch lange kein Abc-Schütze wurde. Sozusagen als Trost. Als sie drei Jahre später eingeschult wurde, bekam ich jedoch keine Trost-Tüte!
In meiner Zuckertüte befanden sich aber nicht nur Süßigkeiten, wie ich erhofft hatte. Auch Farbstifte und anderes Zubehör für den späteren Unterricht. Wer wusste es besser als meine Mutter als Lehrerin, was benötigt wurde. Mutti war jedoch nicht meine Klassenlehrerin.
Mit dem Schreibenlernen hatte ich weniger Mühe als mein Vater seinerzeit. Er war und ist Linkshänder. Man zwang ihn damals jedoch, mit der rechten Hand zu schreiben. Das ist heute noch die einzige Tätigkeit, die er mit der rechten Hand ausübt.
Ich bin Rechtshänder und habe schon immer gern gemalt. Bereits im Kindergarten hatte ich gelernt, gerade Linien zu ziehen. Das kam mir nun zugute. Ich eignete mir eine Schreibschrift, später eine Handschrift an, für die ich mich noch heute nicht zu schämen brauche.
Um schreiben und lesen zu lernen, gab es damals einen „Lesekasten“. Ein flacher Kasten aus Hartpappe enthielt Bögen mit klein- und großgedruckten Buchstaben. Die konnte man sorgfältig ausschneiden und in die vorgefertigten kleinen Fächer sortieren. Den Deckel des Kastens konnte man aufklappen. Auf der Innenseite waren Pappstreifen, wie Zeilen, aufgeklebt. Hier konnte man die einzelnen Groß- oder Kleinbuchstaben auflegen und daraus Wörter bilden. So konnte man lernen, welche Buchstaben zu einem bestimmten Wort gehören. Durch diesen Trainingseffekt hatte man das „Schriftbild“ eines Wortes im Gedächtnis und konnte es fehlerfrei aufschreiben. So verhielt es sich auch beim Lesen. Später sah man ein „Schriftbild“ und erkannte sofort das Wort, ohne umständlich lautieren zu müssen.
Aber bis dahin war noch ein weiter Weg. Zunächst musste doch noch lautiert werden, also die einzelnen Buchstaben in der Folge des Wortes gesagt, die Laute aneinandergereiht und schließlich das ganze Wort ausgesprochen werden. Es gab ein kleines Hilfsmittel. Das „Lese-L“. Aus dünner Pappe wurde ein großes „L“ ausgeschnitten. Das Papp-L hatte aber einen hohen „Fuß“. Diese Lesehilfe in Form eines „L“ wurde nun auf den Rücken gelegt, und der hohe „Fuß“ wurde nach links gerichtet. Damit deckte man in der Zeile den bereits lautierten Buchstaben eines Wortes ab und konnte sich auf den nächsten Buchstaben konzentrieren.
Schreiben und Lesen hatten mich vom ersten Moment an fasziniert. Mit dem Rechnen stand ich immer ein wenig auf Kriegsfuß. Nun gut, in den unteren Klassen mit den Grundrechenarten noch nicht. Aber später!
Vati ist ein echtes „Mathe-Ass“! Er konnte später im Supermarkt der Kassiererin schon den Endbetrag sagen, ehe sie fertig war mit dem Eintippen. Man sagt ja den Linkshändern nach, dass sie gute Mathematiker sind.
Die Helmecke-Oma, die Mutter meiner Mutter, war auch sehr gut im Kopfrechnen. Sie war in ihrer Jugend als Dienstmädchen bei einer wohlhabenden Familie in Stellung. Da hatte sie gelernt, mit dem zugeteilten Geld zu wirtschaften. Ob Oma Linkshänderin war, hatte ich nie beobachtet.
Am Ende des ersten Schuljahres konnte ich wahrhaft stolz auf mein erstes Zeugnis sein. In allen Fächern hatte ich eine Eins erhalten. Da hatte niemand geschummelt oder gar meiner Mutter einen Gefallen getan, die ja an derselben Schule unterrichtete. Damals war ich noch sehr eifrig, fleißig und zielstrebig. Jedoch kein typischer Streber. Das legte sich zwar dann in den späteren Schuljahren etwas, aber ich gehörte stets zu den Besten in meiner Klasse.
Ich bekam einen luftbereiften Roller! Mit dem konnte man toll rollern! Der war verschiedenfarbig lackiert, natürlich aus Stahlrohr, hatte einen chromblitzenden Lenker und einen gepolsterten Sitz über dem Hinterrad. Das Hinterrad konnte man mit einer Fußraste abbremsen. Ich war der Erste in unserer Wohngegend, der solch einen Roller besaß. Damit war ich bei jedem Rollerrennen der Schnellste! Meinen Holzroller übergab ich nun großzügig meiner kleinen Schwester.
Der Kleingarten
Am Stadtrand war ein großes Ackerstück zur Nutzung als Kleingartenanlage freigegeben worden. Wir bekamen auch eine Parzelle zugesprochen. Ich weiß nicht, wie dieser Riesenerfolg zustande gekommen war. Zur damaligen Zeit war das wie ein Hauptgewinn im Lotto. Man konnte sein eigenes Gemüse und Obst anbauen! In den staatlichen Obst- und Gemüsegeschäften gab es nur ein sehr geringes Angebot. Rotkohl, Weißkohl, saisonabhängig auch Grün- und Rosenkohl. Saisonbedingt gab es auch Äpfel und Birnen. Erdbeeren bekamen nur die ersten Kunden. So verhielt es sich auch bei Kirschen und Pflaumen. Bananen und Orangen waren ausschließlich in der Vorweihnachtszeit im Angebot und wurden streng rationiert!
Nun hatten wir also einen eigenen Garten für Obst- und Gemüseanbau! Bereits im Herbst freute ich mich auf die Erdbeeren, die wir sicherlich schon im nächsten Jahr dort ernten würden. Helmecke-Opa besorgte Barackenteile, aus denen eine kleine Laube gezimmert werden konnte. Er beschaffte auch Holzlatten für einen Zaun zur Abgrenzung zum Hauptweg. Dort wurde eine Tür eingebaut, die mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden konnte. Rings um die Anlage herum wurde ein hoher Maschendrahtzaun gezogen. Als Abgrenzung zu den Nachbargärten dienten straff gespannte Drähte. Vorn am Hauptweg wurde ein schönes Blumenbeet angelegt. Daran anschließend gab es Beete mit Erbsen, Möhren, Kopfsalat, Gurken, Kohlrabi, Rhabarber und eine große Fläche mit Erdbeeren. Es gab auch eine Reihe mit verschiedenen Küchenkräutern.
Ich naschte gern Petersilie, die krause. Die kitzelte beim Kauen auf der Zunge. Es wurden auch ein paar Obstbäume gesetzt. Wir Kinder halfen natürlich fleißig mit. Das Säen und Pflanzen machte großen Spaß. Das Unkrautzupfen aber weniger.
Den größten Spaß machte natürlich das Ernten. Da konnte man zwischendurch gleich einmal kosten! Es war für mich ein Vergnügen, eine Möhre aus ihrer Saatreihe zu ziehen und zu essen. Da reichte es, mit der Hand ein wenig die noch anhaftende Erde abzustreifen. Später hatten wir eine Regentonne an der Laube. Dort konnte man dann das Gemüse vor dem Verzehr ein wenig abwaschen. Zu jener Zeit war nichts bekannt von Allergien, Lactose-Unverträglichkeit und anderen „Modekrankheiten“, die es heute gibt.
In der Kleingartengemeinschaft „Glück Auf“ wurde jährlich gegen Ende des Sommers ein kleines Gartenfest organisiert und durchgeführt. Für die Kinder gab es einen „Kletterbaum“. An einer dicken Holzstange konnte man nach oben klettern und von dem oben angebrachten Ring Süßigkeiten oder kleine Spielsachen „pflücken“.
Blindekuh wurde gespielt, Topfschlagen, Sackhüpfen, Eierlauf und Wurstschnappen. Einmal war sogar ein Kasperltheater aufgebaut. Es gab einen Stand mit Getränken und selbstgebackenem Kuchen. Irgendjemand spielte auf dem Akkordeon und dazu einer auf der Trompete. Manche der Erwachsenen, auch Kinder, tanzten ein wenig. Ich schaute meist nur zu.
Mir gefiel ein Mädchen besonders. Der Garten ihrer Eltern war einer der ersten nach dem Haupteingang. Sehr oft, wenn ich mit meinen Eltern zu unserem Garten nach hinten lief, stand sie am Gartentor. Sie hatte wunderschöne blaue Augen, die mich an die Blüten von Vergissmeinnicht erinnerten. Ich sah sehr gern in ihre Augen und konnte so die Welt um mich herum vergessen.
Als es dämmerte, wurden Lampions und Fackeln angezündet. Es wurde ein Umzug auf dem Hauptweg gemacht. Das war der Ausklang des Festes. Vati lud uns Kinder dann in unseren hölzernen Handwagen. Gemeinsam mit Mutti zog er uns nach Hause. Die stahlbereiften Holzräder holperten mächtig. Wenn man einen leisen Dauerton ausstieß, wurde der in kleine Frequenzen „zerhackt“. Das vibrierte wohlig in der Brust. Oben am Himmel funkelten die Sterne, und der Mond erhellte unseren Weg.
Vier Generationen in einem Haus
Der „Papi“, der Vater meines Vaters, war aus der Haft entlassen worden. Ich war damals gerade wenige Tage alt, als er im Morgengrauen von sowjetischen Soldaten aus der Wohnung geholt und verhaftet wurde. Angeblich sollte er an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein. Er wurde im Zuchthaus Bautzen, dem „Gelben Elend“, eingekerkert. Dort herrschten beinahe unmenschliche Bedingungen. Die Zellen waren drei- und vierfach überbelegt. Es gab kaum Hofgänge, um frische Luft schnappen zu können. Auch keine Möglichkeit der Bewegung oder der Beschäftigung. Besuche waren verboten! Der russische Kommandant wurde viel später von seiner vorgesetzten Behörde seines Amtes enthoben. Da war es für den Papi aber schon zu spät. Er war schwer an Tuberkulose erkrankt. Inzwischen waren auch seine einstigen Verhaftungsgründe geprüft und für haltlos erklärt worden. Nach mehr als sechs Jahren schwerer Haft wurde er entlassen.
Der Papi wollte, dass die komplette Familie Wolf in einem Haus wohnt. So zogen wir in Urgroßvaters Haus. Das Mehrfamilienhaus befand sich am anderen Ende des Ortes. Der Zweigeschoßer wurde in der oberen Etage von meinem Urgroßvater Hugo bewohnt. Er nutzte nur zwei Zimmer. Die anderen Zimmer auf diesem Flur bewohnte die Familie meines Opas, also des Vaters meines Vaters. Opa hieß eigentlich Hans, wurde aber Papi genannt. Die Oma, seine Frau Else, wurde Mami genannt. Ihre Tochter Gisela, die Schwester meines Vaters, also meine Tante, bewohnte später separat einige Räume, die in die dahinterliegenden Seitenflügel des Gebäudes ragten.
Ich war gern mit Tante Gisela zusammen. Sie hatte sich ihre beiden Zimmerchen ganz niedlich eingerichtet. Es roch dort auch ganz herrlich. Besonders gern schnupperte ich an ihrem Bettzeug, wenn sie gerade aufgestanden war und sich nicht im Zimmer befand. Gisela hatte lange Haare und duftete immer gut. Sie war stets lustig, und sie konnte virtuos auf dem Flügel spielen, der im Wohnzimmer ihrer Eltern stand. Ich hatte Gisela einmal überzeugend versichert, dass ich sie später heiraten würde.
In den hinten angrenzenden beiden Seitenflügeln des Gebäudekomplexes wohnten in den oberen Etagen einige Mieter. In den unteren Bereichen gab es Lagerräume und eine stillgelegte Filzschuhfabrik, die dem Uropa bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 gehört hatte.
Wir vier „jungen Wölfe“ bewohnten die Parterrewohnung im Vorderhaus an der Straße. Vier Generationen einer Familie in einem Haus!
Die Wohnung und auch die einzelnen Räume waren recht groß. Ich bekam mein eigenes Kinderzimmer. Allerdings gab es kein WC, nur ein Trockenklo im Treppenhaus. Gebadet wurde immer am Freitag. Die Badewanne war in einem schmalen Raum der oberen Etage installiert. Das Badewasser wurde mit Holz oder Kohle in einem Badeofen erwärmt.
Zwischen den beiden Seitenflügeln des Hinterhauses gab es einen mit Feldsteinen gepflasterten Hof. Weiter hinten eine Art Garten. Das Grundstück wurde hinten von einem Quergebäude abgeschlossen. Im unteren Bereich dieses Gebäudes waren die Schuppen der einzelnen Mieter. Eine steile Holztreppe führte hinauf in die Etage, die auf der Sonnenseite keine Wand besaß. Hier konnte Wäsche getrocknet werden. Es gab also genügend Platz zum Spielen und Herumtollen.
Durch den Umzug musste ich eine andere Schule besuchen. Dieses Schulgebäude war unserer jetzigen Wohnung näher gelegen, als das in der alten Wohnung der Fall war. Ich besuchte nun schon die zweite Klasse. Auf dem Schulweg traf ich mich mit meinen Klassenkameraden, und so war es nie langweilig. Wir konnten nochmals so richtig losplappern, wie uns der Schnabel gewachsen war, bis wir dann in der Schule stundenlang stillsitzen mussten.
Die Schule war ein 1911 errichtetes ehrwürdiges Gebäude. Die großen und hohen Klassenräume erstreckten sich über drei Etagen. Vor dem Gebäude war eine recht weitläufige parkähnliche Freifläche mit einem Rundweg. Dort mussten wir in den großen Unterrichtspausen immer entlanglaufen. Die Aufsicht führenden Lehrer achteten streng darauf, dass wir alle in eine Richtung liefen. Es durfte auch nicht gerannt werden.
Hinter dem Schulgebäude erstreckte sich ein großer Platz, der zum Sportunterricht genutzt wurde. Rechts daneben gab es eine Turnhalle mit allen möglichen „Foltergeräten“, die zum Geräteturnen nötig waren. Lediglich mit den Kletterstangen konnte ich mich anfreunden. Da kam vielleicht der „Kletteraffe“ durch, der ich ja bei der Geburt gewesen sein soll. Mit dem Barren kam ich auch zurecht. Da gab es ja zwei Holme, an denen man sich krampfhaft festhalten konnte. Alles, was im Freien stattfand, war mein Vergnügen. Ich konnte sprinten, weit- und hochspringen, die Kugel stoßen und vor allem lange Strecken laufen.
Einmal hatten einige von uns herumgealbert, und zur Strafe mussten wir eine große Runde um den Platz laufen. Da wir nicht mit dem Gekicher und Gelächter aufhörten, musste eine weitere Runde absolviert werden. So ging das Runde um Runde! Der Sportlehrer gab dann entnervt auf. Wir waren nicht kleinzukriegen!
So gehörte ich auch zur Schulmannschaft, die am jährlich stattfindenden Staffellauf um den Breiten Teich teilnahm. Ich nahm auch an anderen sportlichen Wettbewerben mit leichtathletischen Disziplinen teil.
Im Schulunterricht hatte ich keinerlei Mühe, den Lehrstoff zu begreifen und anzuwenden. Dazu musste ich nie zu Hause büffeln. Was ich im Unterricht gesehen, gehört und erlernt hatte, war sofort beinahe unauslöschlich gespeichert. Mit Leichtigkeit erledigte ich die aufgetragenen Hausaufgaben und hatte daher immer viel Freizeit.
Nein! Es gab auch Aufgaben, für die ich viel Zeit aufwandte und somit meine mir so wichtige Freizeit opfern musste. Dann, wenn es galt, ein Gedicht zu erlernen. Ich sah keinen Sinn darin, einen gereimten, also nicht prosaischen Text auswendig zu lernen. Zumal dieser Text ein Thema behandelte, das viele Jahre und Jahrzehnte zurücklag. Zum BeispielDas Lied von der Glockevon Schiller. Die Herstellung einer wohlklingenden Kirchenglocke kann man doch in klaren und verständlichen Worten erklären. Etwa wie die Montageanleitung eines Möbelstücks. Aber so, wie Schiller das geschrieben hat, doch nicht. Wer wird denn heute auch noch Glockengießer?
Wenn es dann daranging, das auswendig gelernte Gedicht vorzutragen, hatte ich meist Glück. Der Lehrer forderte uns Schüler in der Reihenfolge, wie wir alphabetisch im Klassenbuch eingetragen waren, zum Vortrag auf. Ich gehörte mit „W“ zu den Letzten. So hatte ich zum einen noch genügend Muße, um den Text etliche Male zu hören und so zu verfestigen. Zum anderen kam ich oft gar nicht mehr mit dem Vortrag dran, da der Lehrer inzwischen selbst genervt war.
Anders verhielt es sich mit Liedertexten. Die lernte ich meist ohne größere Mühe. Die reimten sich zwar auch oft, und deshalb wurde die Sprache „verbogen“. Aber es war eine Melodie dabei. Man konnte den Text singen. Das machte die Sache für mich einfacher. Vielleicht hätte ich SchillersGlockeoder Goethes BalladeDerZauberlehrlingals Gesangsstück lieber gehabt!
Jedenfalls fallen mir heute noch ganze Textpassagen aus Liedern ein, die ich in meiner Kinderzeit gesungen habe. Wenn meine Gedanken einmal nicht auf Wanderschaft sind, dann summen in meinem Kopf häufig noch die Melodie und der Text von dem Lied, in dem ein Vöglein im hohen Baum sitzt, das so klein ist, dass man es kaum sieht, aber so schön singt, dass die Leute stehen bleiben und horchen …!
Von SchillersGlockehingegen fällt mir heutzutage nicht mehr eine Zeile ein! Nur die Kurzfassung: Loch gebuddelt, Bronze rin, aufgebammelt, bim, bim, bim.
Ja, gesungen habe ich immer gern. Eigentlich heute noch. Es gibt aber kaum noch Anlässe dazu, geschweige geduldiges Publikum.
Das „Musikalische“ habe ich von meinen Eltern. Mein Vater hat immer ein Musikinstrument gespielt, und meine Mutter war begeisterte Chorsängerin.
Ein Instrument habe ich nie gespielt. Ich hatte es versäumt, Notenlesen zu lernen. Versuche, mit der Mundharmonika eine Melodie nach dem Gehör zu spielen, blieben in den Anfängen stecken. Ich konnte ja dann auch nicht mitsingen, was ich ja viel lieber tat.
Ich bekomme eine Brille
Irgendwer hatte festgestellt, dass ich besser sehen könnte, wenn ich eine Brille tragen würde. Das war ein Schock! Zur damaligen Zeit wurde man als Brillenträger noch gehänselt. Man wurde als „Brillenschlange“ oder „Blindschleiche“ bezeichnet und in etwa den körperlich und geistig Behinderten zugeordnet. Diese Diagnose traf mich damals wie ein Faustschlag ins Gesicht!
Seinerzeit gab es ja auch noch keine formschönen Brillengestelle wie heutzutage. Es gab die „Kassenmodelle“, die in allen Größen auf Lager waren. Gleiche Form, gleicher Schnitt für den Opa bis hin zum Urenkel. Alle Brillen sahen damals identisch aus. Man konnte aber wohl unter zwei Farbtönen wählen: entweder Braun oder Gelb.
Die Gestelle waren aus einem durchscheinenden Plastikmaterial gefertigt. Das Material war so spröde, dass es bei geringsten mechanischen Belastungen brach. So war ich natürlich Stammkunde beim Optiker, da er mir Bruchstellen kitten und Verformungen beseitigen musste. Später konnte ich mir selbst behelfen und nutzte Pflasterklebestreifen und konnte auch Verformungen über einer Kerzenflamme justieren.
Die Brille störte beim Fußballspielen, beim Badengehen, eigentlich ständig. Oft setzte ich sie ab und legte sie beiseite. Bald hatte ich jedoch festgestellt, dass ich ohne Brille wirklich viel weniger sehen konnte. Jedenfalls in der Nähe. Also leistete sie mir wertvolle Dienste beim Schreiben und vor allem beim Lesen. Man sagt ja auch, eine Brille wäre ein „Intelligenzverstärker“. Im weitesten Sinne stimmt das auch. Ohne die Brille wäre mir vieles unerkannt und unbekannt geblieben.
Ich weiß heute noch nicht ganz genau, was die Ursache für meine Sehschwäche war und ist. Ich vermute, ich war ein „Schielauge“. Ich kenne alte Fotos, auf denen ich als schielendes Kleinkind zu sehen bin. Ich habe aber nie eine „Schielbrille“ getragen, wie man das bei einzelnen Kindern damals beobachten konnte. Wahrscheinlich wollten mir meine Eltern die Hänseleien ersparen.