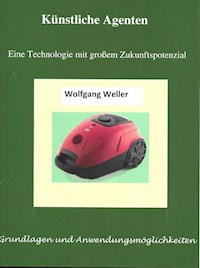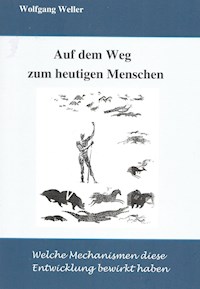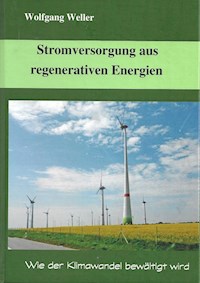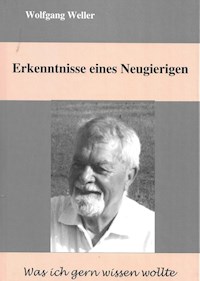
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
In diesem Buch sind die Ergebnisse eines Nachdenklichen dargelegt, der zahlreichen Phänomenen seines Daseins gedanklich nachgegangen ist. Dazu zählen die Besonderheiten der Spezies "heutiger Mensch", die Arten der Beziehungen zwischen Menschen, besondere Verhaltensweisen der Menschen u. a. Weiterhin versuchte er diversen Erscheinungen unseres Daseins, wie Zeit, Geld, Glück, Kunst, Energie und Information nachzugehen. Zum dritten interessierte er sich für das Funktionieren der Informationsgesellschaft, des freien Marktes sowie von Ökosystemen. Zum Schluss machte er noch auf Gefahren aufmerksam, welche die Flüchtlingsbewegung und die zunehmende Übervölkerung unseres Planeten betreffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Weller
Erkenntnisse eines Neugierigen
Was ich gern wissen wollte
Essays
Impressum:
Erkenntnisse eines Neugierigen
Wolfgang Weller
Copyright: © 2020 Wolfgang Weller
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN 978 – 3 – 752 – 972 – 64-1
Prolog
Es gibt Personen, die ein Leben lang von erheblicher Neugier geprägt sind. Dazu gehört wohl auch der Autor. Nicht dass er den Leuten etwa in die Kochtöpfe schauen wollte - nein, ihm ging es darum zu erfahren, wie die Dinge funktionieren, worin das Wesen einer beobachteten Sachlage liegt, welche Prinzipien dahinter stehen, wie die Dinge funktionieren die Besonderheiten oder warum etwas so ist und nicht anders.
Diese Neigung zeigte sich schon im Kindesalter. Da mochte er wohl manchmal seiner Mutter mit seinen vielen Fragen ganz schön auf die Nerven gefallen sein. Auch später bestand sein Streben darin, Dinge, die ihn interessieren, näher kennenzulernen oder sich in ihrem Gebrauch auszuprobieren. Dazu gehörte, dass er viel zeichnete, mit Freude musizierte, die verschiedensten Dinge bastelte, schnitzte, drechselte oder sich auch im Fotografieren übte. Auch technischen Errungenschaften ging er durch den Nachbau, zumeist in Form von Modellen, nach. Hingegen zeigte er wenig Interesse an den üblichen Gesellschaftsspielen, dem Ball hinterher zu laufen, am Golfen oder auch Angeln. Diese Tätigkeiten waren für ihn Zeitverschwendung. Dafür liebte er, selbst als er später eine Familie gegründet hatte, sehr das Reisen. Er wollte sehen, welche Gegenden es woanders gibt, wie die Menschen dort lebten, welche Gewohnheiten, Speisen und Getränke dort in Gebrauch waren. Manchmal ging er in seiner Wohnumgebung auch einfach nur durch einen Hauseingang, um zu sehen, wie es dahinter aussah.
Die Möglichkeiten, solchen Untersuchungen nachzugehen, erweiterten sich natürlich beträchtlich, nachdem er in den sog. Ruhestand gegangen war. Seither sind in loser Folge eine größere Anzahl von Ausarbeitungen entstanden, in denen die gewonnenen Erkenntnisse niedergelegt wurden. Diese schlummerten bisher in Dateien und sind zumeist unveröffentlicht geblieben.
Irgendwann wurde empfunden, dass es sinnvoll wäre, auch andere Menschen an den gewonnenen Einsichten und Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Daraus entstand die Idee, eine gewisse Auswahl unter diesen Beiträgen zu treffen, in denen unterschiedliche Themen behandelt wurden, und diese geschlossen in Buchform zu veröffentlichen. Dieses liegt nunmehr vor, und zu seiner Lektüre wünscht er den Interessierten viel Freude
1. Wodurch unterscheidet sich die Menschheit vom Tierreich?
–– Die Besonderheiten des Menschen –
Einführung und Problemstellung
Menschen sind – so könnte man zunächst sagen – natürliche Wesen biologischer Herkunft, deren Lebensfunktionen, wie bei anderen Tierarten auch, biologisch determiniert sind. Was also sind dann wohl die Besonderheiten, die den Menschen über seine Mitgeschöpfe im Tierreich hinaus erheben?
Die Beantwortung dieser Frage verlangt trennscharfe Kriterien, die eine derart grundsätzliche Unterscheidung ermöglichen. Diesem Problem müssen wir uns also zunächst widmen, und es ist zu vermuten, dass die Fahndung danach nicht gerade einfach sein wird.
Gewiss hat es in der Vergangenheit nicht an Bemühungen gefehlt, eine Abgrenzung der Gattung Mensch vom „Rest“ der Lebewesen auf unserer Erde zu bestimmen. Schauen wir also zunächst auf das, was dazu bisher vorliegt, und unterziehen diese Vorschläge einer kritischen Analyse. Anschließend werden wir weitere, vom Autor vorgeschlagene Kriterien in Betracht ziehen.
Tauglichkeit bisher verwendeter Kriterien
Da der Mensch, wie die Wesen der gesamten Tierwelt, gleichermaßen evolutionsbiologischen Prozessen entstammen, kann man zunächst untersuchen, ob sich aus der gemeinschaftlichen biologischen Herkunft Merkmale finden lassen, welche die besondere Rolle des Menschen erklären können.
In der zurückliegenden Zeit hat man aufeinanderfolgend verschiedene Merkmale herangezogen, um den Unterschied zwischen den Gattungen der Menschen undder Fülle der Wesen des Tierreiches zu verdeutlichen, wie die folgende Aufstellung zeigt:
aufrechter Gang
Diesen teilen die Menschen aber auch mit verschiedenen Affenarten, Pinguinen und anderen Zweibeinern . Dieses aufrechte Gehen führte jedoch beim Menschen zu einer Reihe gentechnischer Veränderungen, die im auf seinem Weg als „Krone der Schöpfung“ zugutekamen. Als Unterscheidungskriterium taugt der aufrechte Gang indessen nicht.
Physisches Leistungsvermögen
Hier wird schnell klar, dass der Mensch hinsichtlich der Geschwindigkeit gegenüber Pferden, Gazellen und Raubtieren, insbesondere Geparden, schlecht abschneidet. Auch bei der gewichtsbezogenen Kraft hapert es, wenn man beispielsweise das Vermögen der Blattschneiderameise denkt, ein Mehrfaches an Körpergewicht über beachtliche Strecken ohne Hilfsmittel zu transportieren. Wären da noch die Sinnesleistungen. Aber auch hier gibt es Fehlanzeige. Weder die Empfindlichkeit der Augen, noch der akustischen Sensorik oder des Geruchssinns der Menschen kann es mit den Leistungen der entsprechenden Organe etwa von Greifvögeln, Eulen, Hunden und einigen anderen Tiergattungen aufnehmen. Hinzu kommt, dass einige Gattungen im Tierreich darüber hinaus über Sinnesorgane verfügen, von denen der Mensch nur träumen kann. Beispiele dafür sind die Sensoren für Magnetfelder bei Tauben oder die Wahrnehmung extrem schwacher Wärmequellen bei Reptilien, um nur ganz wenige zu nennen. Die Liste überlegener Leistungen im Tierreich lässt sich beliebig fortsetzen. Menschen sind manchen Tiergattungen auch deshalb hoffnungslos unterlegen, weil sie, wie Vögel oder Insekten, ohne Hilfsmittel weder fliegen oder den Lachsen oder Walen gleich, riesige Entfernungen schwimmend überwinden oder in große Tiefe abtauchen können.
Man muss dann wohl zur Kenntnis nehmen, dass der Mensch, biologisch betrachtet, nicht besonders gut ausgestattet ist und bestenfalls durchschnittlich abschneidet. Dennoch muss im Moment noch offen bleiben, über welche biologische Mitgift das Menschengeschlecht offenbar verfügt, die es befähigt, von sich heraus Leistungen zu entwickeln, die es aus dem Tierreich weit heraushebt.
Arbeit
Diese u. a. von Karl Marx unterstützte These ist ebenfalls nicht generell aufrechtzuerhalten, wenn man beispielsweise den Nestbau der Vögel oder die Errichtung von Wasserburgen der Biber denkt. Viele Arbeiten können allerdings nur vom Menschen ausgeführt werden. Man denke allein an das Entfachen und Unterhalten von Feuer.
Gebrauch von Werkzeugen
Der Umgang mit Werkzeugen ist ebenfalls nicht auf den Menschen beschränkt. So finden wir den Gebrauch von Werkzeugen etwa bei bestimmten Vogelarten, welche Steine verwenden, um Eier- oder Muschelschalen aufzuknacken, um auf diese Weise an das leckere Innere zu gelangen. Das Werkzeug selbst wurde in diesem Fall vorgefunden. Andere Beispiele zeigen, dass auch die Herstellung von Werkzeugen von manchen Tieren beherrscht wird. So lässt sich beobachten, dass Schimpansen zuerst kleine Stöckchen zuspitzen, um anschließend damit in Baumhöhlen nach versteckten Termiten oder Ameisen zu angeln. In anderen Fällen werden Werkzeuge dadurch hergestellt, dass aus Palmblättern schmale Streifen abgespalten werden, um mit deren Hilfe an verborgene Insekten oder Weichtiere zu gelangen. Somit ist auch die Verwendung der Kategorien Arbeit und Werkzeuge als Unterscheidungsmerkmal nicht aufrecht zu erhalten.
Vorhandensein einer Seele bzw. eines Bewusstseins
Zeitweise wurde auch versucht, den Tieren eine eigene abzusprechen. Eine solche Unterstellung erleichtert sicherlich den Abschuss von Jagdtieren und entlastet wohl auch das Gewissen bei der Tötung der zur Fleischversorgung gehaltenen Haustiere. Diese Betrachtungsweise wurde sogar auf die Sklaven übertragen, um diese möglichst unbedenklich ausbeuten zu können. Anklänge an eine solche Auffassung finden sich auch bei rassistisch gefärbten Ideologien, welche immer mal wieder versuchen, bestimmte Menschengruppen als minderwertig einzustufen. Heutzutage gilt die These als widerlegt, nach der versucht wird, selbst den höheren Tierformen ein Bewusstsein abzusprechen. Auch rassistischen Vorurteilen hat die zivilisierte Welt eine Absage erteilt.
Führen von Kriegen unter Einsatz von Waffen
Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Gruppen der gleichen Spezies werden ebenfalls als typisch menschliche Verhaltensweisen gesehen. Dabei werden bewusst die Einzelkämpfe ausgeklammert, die ja bei vielen Tierarten als Kampfrituale zur Bestimmung der Rangordnung, Revierverteidigung oder auch während der Brunftzeit üblich sind. Auch das Führen von Kriegen im Sinne kollektiver Handlungen unter Gewaltanwendung gegenüber Mitgliedern gleicher Art findet sich nicht nur beim Menschen. Wie Beobachtungen von Schimpansen zeigen, können in bestimmten Situationen mit Knüppeln bewaffnete Horden aufeinander losgehen, wobei auch das Töten von Artgenossen billigend in Kauf genommen wird. Da unterscheidet sich menschliches Kriegsgeschehen nur in quantitativer Hinsicht. Die Menschen sind inzwischen in der Lage, 40 Mio. Menschen in einem einzigen Krieg (hier: dem 2. Weltkrieg) zu töten. Auch bezüglich der Waffen haben sie sich mittlerweile ein Vernichtungspotenzial geschaffen, das zur mehrfachen Vernichtung ihrer Art (sog. overkill) ausreicht.
Mitgefühl, Empathie und soziales Engagement
Fähigkeiten dieser eher sanften Art wurden vielfach nur dem Menschen zugeschriebenen. Wenn schon nicht immer aus eigenem Erleben, so dokumentieren doch beispielsweise die Tierfilme und entsprechenden Fernsehsendungen das bei vielen Tierarten ein genetisch verwurzeltes Verhalten einer liebevollen Brutpflege, eines Umsorgens des Nachwuchses und Schutzes vor Verlusten Auch findet man auch spontanes echtes Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. So zeigen Beobachtungen, dass gewisse Säugetiere in Not geratenen Artgenossen helfend zur Seite stehen. Haben diese aber dann ihren Normalzustand erreicht, so werden sie dann wieder als Konkurrenten wahrgenommen. Ein besonders Beispiel für das Auftreten von Mitgefühl im Tierreich liefern Elefanten, die um verstorbene Mitglieder ihrer Herde auf eindrucksvolle Weise trauern.
Somit erweist sich auch dieses Kriterium wiederum als wenig trennscharf, da es zu keiner klaren Abgrenzung gegenüber dem Tierreich führt. Wenn es den zuvor geschilderten Kriterien an Trennschärfe fehlt, dann versuchen wir es diesmal mit den folgenden Merkmalen:
Kommunikation
Dabei kann es sich hier nicht um die Kommunikation mittels Gesten der Körpersprache oder durch Bewegungsäußerungen handeln, die zur Übermittlung einer bestimmten Botschaft eingesetzt werden, denn diese sind auch im Tierreich weit verbreitet. Denken wir nur an das Ducken von Raubtieren als Zeichen der Unterwürfigkeit, das Lausen bei den Affen zwecks Einschmeicheln, das Setzen von Duftmarken zur Markierung des Reviers oder von Pfaden oder den Ringeltanz der Bienen zur Signalisierung einer ergiebigen Nektarquelle. Vielmehr beziehen wir uns hier auf die Kommunikation durch Lautäußerungen. Doch auch hier werden wir im Tierreich fündig. So gibt es beispielsweise den „Gesang“ der Wale und Delfine oder den Informationsaustausch per Infraschall bei den Elefanten.
Die Grenze der lautbasierten Kommunikation zwischen dem Menschengeschlecht und dem Tierreich liegt dann wohl nicht auf Laut- sondern auf Sprachebene. Aber solange die Lautäußerungen gewisser Säugetiere noch nicht entziffert sind, bietet auch dieses Kriterium keine verlässliche Grundlage.
Intelligenz
Doch auch hier scheint Vorsicht geboten. Versuche mit Meeressäugern – allen voran Delfinen – haben gezeigt, dass diese zu beachtlichen Geistesleistungen fähig sind und sogar abstraktes Denken vermuten lassen. Spektakulär sind auch die auf Gedankenleistungen beruhenden Verhaltensweisen insbesondere von Krähen und neuseeländischen Keas. Diese können nicht nur das Gefahrenpotenzial einer Situation sicher abschätzen, etwa ob ein Jäger ein Gewehr bei sich trägt oder nicht. In Tierexperimenten wurde nachgewiesen, dass diese Vögel auch in der Lage sind, mehrstufige Denkprozesse zu absolvieren und dabei Schlussfolgerungen zu ziehen. In unserer „Ahnengalerie“ noch weiter zurück schreitend haben auch Versuche mit speziellen Weichtieren (Molusken), insbesondere den Tintenfischen, gezeigt, dass diese anscheinend abstrakt denken können, obwohl sie nicht einmal über ein ausgeprägtes Denkorgan, wie das Gehirn, verfügen.
Lernfähigkeit
Hier ist nichtdas Training gemeint, das beispielsweise Hunde, Pferde und allerlei Zirkustiere zu oftmals erstaunlichen Leistungen befähigt. Training ist bestenfalls als eine Vorstufe des Lernens zu akzeptieren. Echtes Lernen hingegen ermöglicht eine flexible Anwendung des Gelernten, selbst wenn die betreffende Anwendungssituation während des Lernprozesses so nie vorgekommen ist. Nicht alles, was in der Tierwelt als vermeintliches Lernen erscheint, ist allerdings auch als solches einzustufen. Wenn beispielsweise Elefanten mit ihrem Nachwuchs zu bestimmten Zeiten zu weiten Reisen aufbrechen und dabei gleichen Routen folgen, dann ist das eigentlich nichts weiter als Merken (Einspeichern) und späteres Erinnern (Abrufen). Diese lebenswichtigen Informationen erwerben bereits die Jungtiere von den erfahrenen Leittieren. Ähnliches gilt auch bei den Raubtieren hinsichtlich des erfolgreichen Jagens, der Bewahrung der besten Wanderwege oder auch der Lage der Wasserstellen u.a.m. Das Besondere besteht darin, dass diese Fähigkeiten nicht vererbt, sondern stets nach Durchlaufen eines Lernprozesses von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Dabei finden als Lernformen des Lernens durch Nachahmung und das Erfolgslernen (trial and error learning) Anwendung. Als „Lehrer“ fungieren vorwiegend die Mütter, bei den Elefanten die erfahrenen Leitkühe (meist Tanten).
Also auch hier erhalten wir kein trennscharfes Unterscheidungskriterium zwischen Mensch und Tier. Somit gelangen wir gesamtheitlich zu dem Resultat, dass keines der traditionellen Unterscheidungskriterien hinreichend trennscharf ist.
Vorschlag alternativer Kriterien
Wenn selbst die bisher ausschließlich dem Menschen zugebilligte Intelligenz als Unterscheidungskriterium keine hinreichende Trennschärfe besitzt, dann werden wir uns bei der weiteren Suche auf eine oberhalb der biologischen Existenz angesiedelte Ebene begeben müssen, die Überbau genannt wird. Dort lassen sich nach vorab geführten vorsichtigen Erkundungen durchaus Ansatzpunkte finden, die weiterhelfen können.
Da die Urahnen des Menschen dem Tierreich entstammen, hat sich der gesellschaftliche Überbau nicht spontan, sondern erst im Verlauf des langfristigen Prozesses der Menschwerdung entwickelt. Dafür erhielt das Menschengeschlecht eine von der Evolution herrührende besondere biologische Mitgift in Form des aufrechten Gangs, der erheblichen Verfeinerung der Hände einschließlich Motorik und vor allem das gegenüber allen Wesen des Tierreiches wesentlich vergrößerte Gehirn, das ihn zu erheblichen Leistungen mentaler Art befähigt. Dazu werden wir im Folgenden der Herausbildung unterschiedlicher Phänomene nachgehen und dabei im Groben der geschichtlichen Entwicklung folgen.
Glaube und Religion
Beginnen wir mit den Erscheinungen von, deren Anfänge möglicherweise bereits auf der Entwicklungsstufe des homo sapiens (verständiger Mensch) entstanden und ab etwa 160.000 Jahren anzusetzen sind. Die frühzeitlichen Menschen sahen sich damals einer übermächtigen Natur mit vielerlei Gefahren ausgesetzt, deren Erscheinungen und Zusammenhänge ihnen ungeheuerlich erschienen. Sie fühlten sich in ihrer Existenz bedroht, waren von wechselhaften Wetterlagen abhängig und hatten auch unterschiedlichen Jagderfolg, um nur wenige der Unwägbarkeiten zu nennen. Hinter all dem Wechselhaften und Unbekannten sahen sie übernatürliche Kräfte walten, denen irgendwann Götter zugeordnet wurden. Dabei entstand eine immer zahlreicher werdende Götterwelt. Auf die geschilderte Weise mögen die vielerlei Naturreligionen entstanden sein. In ihrer Ohnmacht versuchten die Menschen ihre Götter gnädig zu stimmen, indem man diese anbetete und ihnen Opfer (manchmal sogar Menschenopfer) darbrachte. Später wurden – die oft einzigen – Bauwerke errichtet, welche ausschließlich der Religionsausübung dienten. Die ersten dieser religiösen Zentren entstanden bereits im Neolithikum (5.000 – 2.000 Jahre v. Chr.), also auf der Menschheitsstufe der Jäger und Sammler. Manche dieser religiösen Anlagen orientierten sich an kosmischen Erscheinungen (bspw. Stonehenge im heutigen England). Mit dem Übergang von Jäger- und Sammlergesellschaften (aneignendes Verhalten) zur Hirten – und Ackerbauerkultur (produzierendes Verhalten) im Neolithikum entwickelten sich nicht nur komplexere gesellschaftliche Organisationsformen, sondern es erweiterte sich auch der Wunschkatalog der Menschen an die Götterwelt. Dabei begünstigte die Sesshaftwerdung den Bau von Tempeln für die Götter.
Ein religiöser Umsturz erfolgte zuerst im antiken Ägypten, als der Pharao Echnaton (vormals Amenhotep IV und Gemahl der schönen Nofretete) um 1350 v. Chr., die vielfältige ägyptische Götterwelt mit einem Schlag beseitigte und den Sonnengott Aton zum alleinigen Gott für seine Untertanen erhob. Dieser erste monotheistische Aufbruch wurde allerdings zwei Generationen später zugunsten der alten Götterwelt wieder getilgt. Später entstanden im sog. Nahen Osten wiederum monotheistische Religionen. Diese hatten ihre Wurzeln in der jüdischen Religion. Die Juden nannten ihren zentralen Gott Jahwe. Später verzweigte sich der jüdische Glaube in mehrere Richtungen. So entstand mit dem Auftreten von Jesus vor 2.000 Jahren auf jüdischer Grundlage (Altes Testament) die christliche Religion. Etwa 600 Jahre später begründete der Prophet Mohammed den Islam, dessen einziger Gott Allah genannt wurde. Unabhängig davon entstanden in Indien sowie im alten China mit dem Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus weitere große Religionen. Diese Religionen breiteten sich mit unterschiedlicher Verteilung auf der gesamten Welt aus und wurden so zu Weltreligionen.
In den Religionen finden viele Menschen auch heute noch ihre Zuflucht, schöpfen dort Kraft, neue Hoffnung, fühlen sich geborgen und mit ihren Sorgen nicht alleingelassen. Die zugehörigen Institutionen leisten auch eine beachtliche humanitäre Lebenshilfe, die den wirtschaftlich Bedürftigen sowie den Opfern von Naturereignissen und Gewalt zugutekommt.
Diktatorische Regimes haben immer wieder den Versuch unternommen, den religiösen Glauben der Menschen zu tilgen, indem sie den Atheismus zur Staatsdoktrin ausriefen. In Wahrheit ging es wohl darum, die vorhandene Glaubensfähigkeit der Menschen auf ihre Ideologie umzulenken. Wie bekannt, ist die mit staatlicher Macht versuchte Durchsetzung des Atheismus jedoch ausnahmslos gescheitert, wenngleich die Nachwirkungen mancherorts (bspw. in Tschechien) noch zu spüren sind.
Sorgen bereitet inzwischen die freiwillige Abkehr vieler Menschen von Glaube und Religion, wie an der nicht geringen Zahl von Kirchenaustritten speziell in den christlichen Kirchen zu erkennen ist. Dies signalisiert einen schleichenden Bedeutungsverlust der Religion. Dafür wird neben der nicht immer zeitgemäßen Haltung der etablierten Kirchen zu drängenden Fragen, oft mangelnden Angeboten und der dem wissenschaftlichen Fortschritt zu verdankende Erkenntnisgewinn verantwortlich gemacht. Allerdings räumt die Wissenschaft wiederum selbst ein, auf die echten metaphysischen Fragen nach der Herkunft und dem Sinn des Universums und seiner Geschöpfe keine schlüssige Antwort geben zu können. Dem von manchen Landesteilen zu beobachtenden Niedergang der Religionen steht andernorts aber auch eine Belebung der Frömmigkeit gegenüber. Fakt ist jedenfalls, dass in den meisten Menschen ein immanentes Bedürfnis nach Religiosität besteht, unabhängig davon, ob und wo es in einer Glaubensrichtung seine Heimat gefunden hat. Auch beobachtet man, dass selbst sehr nüchterne Menschen, wie gestresste Manager und Banker, ein zunehmendes spirituelles Bedürfnis erkennen lassen, das sie auf verschiedene Weise zu befriedigen suchen. Somit können Glaube und Religion durchaus als Unterscheidungskriterium herangezogen werden.
Dem bei den christlichen Kirchen erkennbaren Trend der Bedeutungsverminderung steht andererseits eine Welle der Islamisierung besonders in den Kernländern dieses Glaubens gegenüber.
Das Ergebnis der vorstehenden Betrachtung führt somit zu der Feststellung, dass Glaube und Religiosität nur in der menschlichen Gesellschaft tiefverwurzelte Erscheinungen sind, die mehr oder weniger deren Leben bestimmt. Tiere haben in den modernen Religionen – wenn überhaupt – höchstens als schmückendes Beiwerk oder schlimmstenfalls als Opfer ihren Platz (Ausnahme: Naturreligionen).
Kultur und Kunst
Auch diese gesellschaftlichen Kategorien entwickelten sich aus bescheidenen Anfängen über lange Zeiträume hinweg und führten in den verschiedenen Regionen der Welt zu tlw. ganz unterschiedlichen Ausprägungen.
Die Kultur ist ein komplexes Phänomen des gesellschaftlichen Überbaus. Zur Kultur zählen die Mythen, Rituale, Gebräuche und Traditionen, die vom Menschen geschaffenen Bauwerke und (Kultur-)Landschaften sowie technische Produkte, aber auch die Mode, Ess- und Trinkgewohnheiten und vieles andere. Besonders herausragende Zeugnisse der Kultur sind heute in der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO erfasst.
Ein besonderer Bestandteil der Kultur ist die Kunst. Anhand der Kunst lassen sich die Entwicklungsgeschichte der Kultur und ihr Einfluss auf die Menschheit gut verfolgen, weshalb wir dieser Komponente hier speziell nachgehen werden.
Das Bedürfnis nach künstlerischer Tätigkeit war beim Menschen bereits frühzeitig ausgeprägt. Die ersten bildhaften Werke entstanden in prähistorischer Zeit auf der Grundlage der neuen biologischen und soziologischen Ausprägung des Menschgeschlechts. Einige der frühen, aus dem Neolithikum (5.000 – 2.000 v. Chr.) stammenden Zeugnisse haben in Höhlen oder auf Felsplateaus in Trockengebieten die Zeiten überdauert. Die älteste und bedeutendste Bilderhöhle findet sich in der Grotte Chauvel, deren künstlerische Gestaltung auf 31.500 Jahre zurückdatiert wird. Weitere eindrucksvolle bildhafte Darstellungen aus paläolithischer Zeit sind in den Höhlen von Lascaux (Frankreich, Dordogne) sowie bei Tassili-u-Ajjer und Ennedi (marokkanische bzw. lybische Sahara) zu bewundern. In den mit Naturmitteln hergestellten Malereien und Gravuren finden sich vorzugsweise figurale Darstellungen aus der umgebenden Natur in teilweise abstrahierter Form. Auch die ersten plastischen Darstellungen von Figuren, die vorwiegend Grabbeigaben entstammen, wurden bereits vor über 30.000 Jahren (Paläolithikum) hergestellt. Besonders reichhaltig waren auch die Funde an Keramiken, welche von den Archäologen verschiedenen Kulturen zugeordnet wurden. Die frühen Artefakte stammen aus dem Meso- und Neolithikum (8.000 – 5.000 bzw.6.000 – 1.8000 v. Chr.) und zeigen eine im Laufe der Zeit immer aufwändigere künstlerische Gestaltung. Aus dieser Zeit sind uns auch die ersten Zeugnisse einer piktografischen Schrift überliefert, deren Zeichen aus konkreten Bildelementen bestanden. Aus dieser Urform gingen später die verschiedenen Buchstaben-Laut-Schriften hervor.
Die entstandene Möglichkeit der Ausübung von Kunst bedeutete für den Menschen eine neue und nicht mehr rein produktbezogene Form bewusster Tätigkeit. Die Arbeit wird nun zur schöpferischen Tätigkeit. Damit verbunden prägte sich eine Sinnlichkeit aus, bildete sich das „musikalische Ohr“, das Schönheit und Harmonie empfindende Auge und entwickelte sich ein ästhetisches Empfinden. Es entstanden neue geistige Bedürfnisse. Die mit der Erstellung von Abbildern erhaltenen Zeitdokumente führten bei den Menschen zu einem neuen Umgang mit der Zeit und damit zu einer höheren Form des Seins. Die mit der Entwicklung von Schriften gegebene Möglichkeit der Beschreibung der Besonderheit realer Sachverhalte förderte weiterhin das abstrakte Denken und war ebenfalls den sozialen Beziehungen zuträglich. Mit der Kunst trat somit ein neues Element auf den Plan, das sich als von herausragender Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung der Menschengattung erwies, indem sie diese auf eine qualitativ höhere Stufe erhebt. Sie leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Herausbildung des modernen Vernunftmenschen.
Da Kultur und speziell Kunst den Geschöpfen des Tierreichs nicht anzutreffen sind, handelt es sich hier um Alleinstellungsmerkmale des Menschen. Somit sind diese Kategorien als weiteres Unterscheidungskriterium tauglich. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass die Basis aller bisherigen Kulturen eine Religion, ein bildhafter Glaube, war. Alle Ebenen, auf denen sich das Leben in den alten Kulturen abspielte, basierten auf einer Religion. Den Religionen entstammt auch ein Wertekanon, der die grundlegenden Regeln für eine gedeihliche gesellschaftliche Ordnung vorgibt wie auch als Richtschnur für das Verhalten als Individuum dient, und es ist fast verwunderlich, dass die Vorstellungen von Moral und Ethik über alle Religionen hinweg nahezu identisch sind. Daraus ist zu folgern, dass Religionen neben der Kunst zu den Kernpunkten jeder (menschlichen) Kultur zählen. Somit ist Kultur als eine Art Überbegriff zu werten.
Wissenschaft und Technik
Zu Leistungen dieser Art ist wohl nur der Mensch befähigt. Diese Disziplinen sind folglich in die Liste möglicher Unterscheidungskriterien mit aufzunehmen.
Bezüglich der Wissenschaft steht der Mensch gegenüber den Wesen des Tierreiches wohl einzigartig da. Seit der Antike wurde eine unglaubliche Fülle an Erkenntnissen über das Entstehen des Kosmos und unseres Planeten, die Entwicklung des Pflanzen- und Tierreiches, der menschlichen Gesellschaft, unsere Befindlichkeiten und Krankheiten und auf vielen anderen Gebieten gewonnen. Diese Leistungen verdankt der Mensch vor allem seinem Gehirn, einem hochleistungsfähigen Denkorgan von rund 1,3 kg Gewicht und bestehend aus 100 Mrd. Nervenzellen und einer ihm eigenen unstillbaren Neugier und ausgeprägtem Erkenntnisdrang. Bezüglich der wissenschaftlichen Spitzenleistungen sei hier an die von Albert Einstein erstellte Relativitätstheorie erinnert, die einer reinen Denkleistung entstammt. Ihre tatsächliche Gültigkeit konnte erst in unseren Tagen anhand gezielter Beobachtungen und aufwändiger Experimente nachgewiesen werden. Eine weitere wissenschaftliche Großtat ist die vollständige Entschlüsselung des menschlichen Genoms, die 2003 gelungen ist.
Das geistige Vermögen der Menschen wird leider auch in negativer Weise eingesetzt. Beispiele sind die ausgeklügelten Vorbereitungen mancher Straftaten wie auch Kriege oder – um einen aktuelleren Fall zu nennen – die Entwicklung undurchschaubarer Finanzkonstrukte zur Steuerhinterziehung und Schwarzgeldwäsche.
Ein wesentlicher Teil der im Rahmen wissenschaftlicher Tätigkeit erbrachten Ergebnisse kam nicht nur der Landwirtschaft, Chemie, Medizin, sondern vor allem auch der Technik zugute. Vom technisch begründeten Fortschritt profitierten zunächst der Straßen-, Tunnel-, Wasserbau und später die Errichtung erstaunenswerter Kirchen, Theater, Rathäuser und respektabler Geschäfts- und Wohnungsbauten. Diese technischen Leistungen sind das Ergebnis der Tätigkeiten genialer Architekten, Baumeister und Künstler, aber auch das Werk namenloser Arbeiter und Handwerker.
Im 19. Und 20. Jahrhundert gab es eine Reihe bahnbrechender Erfindungen, an deren Beginn die Dampfmaschine (J. Watt) stand. Damit verfügte man über eine gewaltige mechanische Antriebskraft, die zum Aufblühen ganzer Industriezweige, wie der Textilindustrie, Montanwirtschaft, Maschinenbau und anderer Branchen führte. Hinzu kamen grundlegende Neuerungen auf dem Gebiet der Mobilität, welche zum Entstehen des Eisenbahnwesens führte und auch die Schifffahrt revolutionierte. Mit der Erfindung des Verbrennungsmotors (N. Otto) entstanden die Technologien von Automobil und später auch Flugzeug. Dies zusammen führte zu einer enormen Ausweitung der Mobilität der Menschen. Eine wesentliche Bereicherung unseres Daseins erbrachten auch Erfindungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik (M. Faraday, Th. A. Edison,W. v. Siemens). Diesen verdanken wir nicht nur das künstliche Licht, sondern vor allem auch den Elektromotor mit all seiner vielseitigen Verwendbarkeit als stationäre wie auch mobile Antriebsquelle. Neuerdings erlangt die Elektrotechnik eine weitere Bedeutung im Zusammenhang mit der Stromerzeugung aus natürlichen Quellen. All diese technischen Fortschritte wurden innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeit erlangt, sodass zurecht von einer Industriellen Revolution gesprochen wird. Dabei kam es zu gewaltigen Umbrüchen, die u. a. zur Herausbildung einer neuen gesellschaftlichen Klasse, der Arbeiterschaft, führte.
Inzwischen gelang es auch, künstliche Wesen zu entwickeln, auf die bestimmte Aufgaben des Menschen delegiert werden können. Dazu zählen die aus der Fertigungsindustrie und anderen Produktionszweigen nicht mehr wegzudenkenden Industrieroboter, die mit großer Beharrlichkeit einprogrammierte Handhabungs- und Arbeitsaufgaben ausführen. Ihre Weiterentwicklung führte zur Ausstattung mit bestimmten kognitiven Fähigkeiten, wie Wahrnehmen, Erkennen, Entscheiden und sogar Lernen, womit diese auch höherwertige menschliche Eigenschaften erlangen. Derzeitige Spitzenprodukte sind intelligente Automaten, künstliche Agenten, lernfähige Dienstleistungsroboter, selbstnavigierende Drohnen u. a. m. Somit gelingt es beständig, die Grenzen dessen, was möglich ist, immer weiter hinauszuschieben. Dies gilt auch bezüglich der Erweiterung des Handlungsraums des Menschen, wofür die Fortschritte auf dem Gebiet der Weltraumtechnologie Zeugnis ablegen. Dank der enormen Fortschritte der Raketentechnologie seit Mitte des vorigen Jahrhunderts haben Menschen mit Apollomission 11 bereits im Sommer 1969 erstmals ihren Fuß weitab der Erde auf den Mond gesetzt. Inzwischen ist die Internationale Raumstation ISS beständig von internationalen Teams besetzt, welche mittlerweile sogar von autonom agierenden Raumtransportern versorgt wird. Gegenwärtig ist man dabei, die Voraussetzungen zu schaffen, um in absehbarer Zeit auch zum Mars zu gelangen.
Informationstechnologie
Ein wesentlicher Ausdruck unseres heutigen Daseins wird durch Information, Kommunikation, und – wie man heute sagt – der Digitalisierung geprägt. Am Beginn diesbezüglicher Entwicklungen stand die Erfindung des Telefons (P. Reis, A. G. Bell). Weitere Meilensteine sind die frühzeitige Bereitstellung von Lösungen für die mündliche Fernkommunikation auf der Basis von Fest- und später von Funknetzen, die Einführung der Rundfunk-, Audio- und Fernsehtechnik. Von weitreichender Bedeutung war weiterhin die Erfindungen des speicherprogrammierbaren Computers (K. Zuse), des mobilen Telefons und später des Smartphones einschließlich des späteren Internetzugangs. Daraus resultierte eine Unzahl von Anwendungsmöglichkeiten in weiten Bereichen. Als weiteres Medium ist in jüngster Zeit Smartphone hinzugekommen, dessen rasante Entwicklung bereits jetzt über die Sprach- und Bildkommunikation weit hinausreichende Anwendungsmöglichkeiten, wie Ferninformation und -steuerung, Navigation, Internetnutzung u. a. m. bietet.
Wie ersichtlich, beschert uns die fortschreitende technologische Entwicklung in beständiger Folge eine Fülle nützlicher Dinge. Diese bereichern unser Leben, erleichtern die Arbeitstätigkeit, bieten einen beständig erweiterten Komfort und mehren auch unseren Wohlstand. Der technische Fortschritt veränderte unser Dasein in ungeahnter Weise, so dass dieses mit dem Leben unserer Vorfahren nur noch wenig gemein hat. Nie zuvor ging es – zumindest in den Industrieländern – den Menschen besser als heute. Leider gibt es in einigen Regionen aber auch noch bittere Armut.
Der technische Fortschritt hat leider auch seine Kehrseite. So gelingt es, immer verheerendere Waffen herzustellen. Besonders bedrohlich sind die seit der Zeit des sog. Kalten Krieges verfügbaren atomaren Kampfmittel, deren Anwendung die Auslöschung des gesamten Menschengeschlechts ermöglichen würde. In jüngster Zeit hat man auch die Verwendbarkeit der modernen Kommunikationstechnologien für kriegerische Zwecke erkannt. Hier laufen im militärischen Bereich unter dem Stichwort Cyberwar bereits entsprechende Entwicklungen. Auch Terroristen versuchen diese Technologie für ihre Zwecke einzusetzen.
Medizin
Ein weiterer Komplex, auf dem in verhältnismäßig kurzer Zeit ungeahnte Fortschritte erzielt wurden, ist die. Die Anfänge medizinischer Betreuung von Menschen reichen weit zurück in prähistorische Zeit. Die damalige Kunst der Mediziner basierte weitgehend auf der Verwendung von Naturheilmitteln. Auch wurden bereits frühzeitig chirurgische Eingriffe von mitunter hochriskanter Art ausgeführt. In der Folgezeit entwickelte sich die Medizin unter Abspaltung einzelner Fachbereiche, wie der Chirurgie, inneren Medizin, Hygiene, Zahnmedizin, Pharmazie, Orthopädietechnik, Psychologie und vieler anderer Disziplinen beständig weiter. Dabei gelang es, viele Krankheiten, die früher als unheilbar galten, nunmehr erfolgreich zu behandeln, chirurgische Eingriffe auf humane Weise vorzunehmen, die Sterblichkeit von Säuglingen und Müttern drastisch zu senken, frühere Epidemien durch rechtzeitige Impfungen praktisch auszurotten und auch der menschlichen Schönheit ein wenig nachzuhelfen. Das Tragische daran ist allerdings, dass nach jedem medizinischen Sieg neue Krankheiten in das Blickfeld traten. Manche davon ergeben sich aus der fortschreitenden Zivilisation, andere wiederum resultieren aus dem stetigen Älterwerden der Menschen. Insofern unterliegt die Medizin einem beständigen Wettlauf.
Besonders in den letzten Jahrzehnten wurden auf medizinischem Gebiet grandiose Fortschritte erzielt. So ermöglicht die sog. Apparatemedizin bei schwersten Schädigungen die Erhaltung der biologischen Lebensfunktionen über fast beliebige Zeit hinweg. Weitere Höchstleitungen sind die Möglichkeiten des Klonens von Lebewesen, die frühzeitige Abwehr genetisch bedingter Krankheiten durch Anwendung der pränatalen Diagnostik, um negative genetische Mutationen abzuwenden. Im Rahmen der regenerativen Medizin gelingt es auch zunehmend, geschädigte Organe durch Neuzüchtung aus körpereigenen Stammzellen herzustellen und damit die befürchteten Abstoßreaktionen weitgehend zu vermeiden. Auch Genmanipulationen werden schon weitgehend beherrscht, womit sich die Möglichkeit eröffnet, Nachkommen mit wünschbaren Merkmalen und Eigenschaften zu designen. Damit wagt sich der Mensch auf Gebiete vor, die früher nur einer höheren Macht vorbehalten schienen. Hier kommen ethische, religiöse und juristische Sachverhalte mit ins Spiel, die zu einem sehr zurückhaltenden Gebrauch der verfügbaren Möglichkeiten mahnen. Sehr viel realistischer sind in Gemeinschaft von Medizinern und Technikern entwickelte Gesundheitshilfen, die vor allem Geschädigten zugutekommen. Genannt seien hier vor allem sog. Bioprothesen, gedankengesteuerte Geräte, behindertengerechte Fahrzeuge sowie persönliche Assistenzroboter, die ihr Verhalten an die Bedürfnisse ihrer menschlichen Partner adaptieren.
Insgesamt hat der medizinische Fortschritt ganz wesentlich zum Wohl der Menschheit beigetragen. Dies lässt sich u. a. an der geradezu erstaunlichen Erhöhung der Lebenserwartung innerhalb der letzten 150 Jahre ablesen. Betrug zu Beginn der diesbezüglichen Erhebung in den Jahren 1870/1871 die nach der Geburt zu erwartende Lebenszeit im Durchschnitt 35,58 Jahre, so liegt die Lebenserwartung deutscher Frauen jüngsten Angaben zufolge derzeit bei 83,1 und bei Männern 78,1 Jahren [1]. Allerdings gibt es hier noch ein großes Gefälle zwischen den Lebenserwartungen in den Industrie- und schwach entwickelten Ländern.
Relation von Mensch und Natur
Kommen wir zu den Spuren, die der Mensch auf seinem Heimatplaneten hinterlässt. Keine Gattung der Lebewesen hat die Welt annähernd so verändert wie der Mensch. Bis vor ca. 12 000 Jahren lebten unsere Vorfahren als Jäger und Sammler. In der Folgezeit gelang die Kultivierung von Pflanzen und Domestizierung geeigneter (Nutz-) Tiere. Die Agrarwirtschaft und Tierhaltung führte zur Sesshaftigkeit der früher nomadisierenden Menschen und zur Herausbildung der Berufsstände von Bauern und Viehzüchtern. Diese sorgten mit ihren durch planmäßige Landwirtschaft gewonnenem Getreide und von Schafen, Rindern und Schweinen gewonnenen Tierprodukten für eine stabile Ernährung größerer Menschenansammlungen. Daher kam es in der Folge zu einer regelrechten Bevölkerungsexplosion. Hinzu kam, dass einige Tierarten, wie Pferde, Esel, Kamele, Yaks die eigene Mobilität verbesserten oder als Transportmittel genutzt werden konnten.
Die Eingriffe des Menschen verändern ganze Landschaften durch Aufreißen der Erdoberfläche, Errichtung ausgedehnter Verkehrsnetze, Veränderung von Flussläufen und Bau von Staudämmen sowie Korrektur von Küstenlinien. Des Weiteren werden die Schätze dieser Erde ausgeplündert, indem ihnen Erdöl, Erdgas und wertvolle Metalle entnommen werden. Zu den Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten gehören auch die vielfach vorgenommenen massiven Eingriffe in die Natur, indem durch Umgestaltung landwirtschaftlicher Flächen im Sinne der Großfelderwirtschaft und Roden wertvoller Waldbestände großräumig neue Agrarflächen gewonnen werden. Ebenso wird der Fischreichtum der Meere bis an die Grenze des Leerfischens ausgebeutet. Damit ist der Mensch dabei, das Antlitz der Erde tiefgreifend zu verändern, in Einklang mit dem Bibelwort: „Macht euch die Erde untertan“. Diese Eingriffe sind für die Pflanzen- und Tierwelt jedoch vielfach schädigend, indem die Lebensräume vieler Tierarten zerstört werden. Manche Eingriffe des Menschen wirken geradezu aberwitzig, wenn man beispielsweise an die großflächige Aufschüttung palmenförmiger Inseln zwecks Bau sündhaft teurer Feriendomizilen oder die Errichtung des mit 828 m welthöchsten Gebäudes Burj Khalifa im Emirat Dubai denkt. Auf unserer Erde finden sich jedoch auch noch riesige Gebiete mit unberührter Natur, teils weil diese den Menschen keinen erstrebenswerten Lebensraum bieten oder für sie gar unzugänglich sind.
Am bedrohlichsten ist der vermehrte CO2-Ausstoß, verursacht durch den beständig wachsenden Verkehr und die Deckung des Energiebedarfs aus fossilen Quellen. Inzwischen sind die Auswirkungen auf den Klimahaushalt unverkennbar. Die Folgen führen zu vermehrten Wetterkapriolen und zum Anstieg des Meeresspiegels, der damit nun auch Lebensräume von Menschen bedroht. Es ist also an der Zeit, wesentlich sorgsamer mit der Mitgift unserer Erde umzugehen, was mit dem Slogan vom nachhaltigen Wirtschaften ausgedrückt werden soll.
Ergebnis
In den vorstehenden Darlegungen wurde der gewiss interessanten Frage nachgegangen, was eigentlich das Besondere an uns Menschen in Referenz zu den Wesen des Tierreiches ist. Zunächst musste eingestanden werden, dass das Menschengeschlecht manchen Vertretern des Tierreiches bei gleicher entwicklungsgeschichtlicher Herkunft in einigen Bereichen teilweise weit unterlegen ist. Also mussten die Besonderheiten auf anderen Gebieten gesucht werden. Dazu wurde zunächst der Eignung der üblicherweise benutzten Unterscheidungskriterien nachgegangen. Im Ergebnis einer kritischen Überprüfung wurde dabei eine weitgehende Untauglichkeit bzw. ungenügende Trennschärfe dieser Kriterien festgestellt.
Entsprechend diesem unbefriedigenden Resultat wurden auf der Suche nach brauchbareren Unterscheidungsmerkmalen eigene Überlegungen angestellt. Dabei wurden zunächst Glaube und Religion als möglicherweise geeignete Kandidaten betrachtet. Als weiterhin taugliche Kriterien erwiesen sich Kunst und Kultur. Große Fortschritte sind insbesondere der Wissenschaft, Technik und Medizin zu verdanken. Im Ergebnis dieser Untersuchungen gelangte der Autor zu einem – wie er glaubt – tragfähigen Kriterienkomplex, welcher die Frage nach der Besonderheit der menschlichen Wesen gegenüber dem Tierreich zu beantworten hilft.
Die Menschen haben auf der Grundlage einer spezifischen biologischen Ausstattung eine Vielzahl z. T. tiefgreifender eigener Leistungen hervorgebracht, die ihnen zu wesentlichen Teilen selbst zugutekommen. Besonders hervorzuheben sind die Früchte der Denkleistungen, welche sich in tiefgreifenden Erklärungen und Erkenntnissen sowie einer unüberschaubaren Fülle von gestalterischen Leistungen und Produkten manifestieren. Ein wesentlicher Teil der erzielten großen Fortschritte resultiert aus Leistungen der Wissenschaft, Technik und Medizin. Einen großen Schub brachte in den zurückliegenden 200 Jahren die sog. Industrielle Revolution. Im Ergebnis wurde die Arbeitstätigkeit signifikant erleichtert, den Spielraum der Mobilität um Größenordnungen erweitert und unser Leben insgesamt wesentlich bereichert. Dies zeigt sich u. a. darin, dass die Menschen in den entwickelten Ländern über Behausungen verfügen, die mit beachtlichem Komfort ausgestattet und von den Unbilden der Natur wenig abhängig sind, sie unter hygienischen Bedingungen leben, im Besitz von elektrischem Licht sind und die Möglichkeit haben, eine Vielzahl elektrischer Geräte und Antriebe zu nutzen, verschiedene Verkehrsträger in Anspruch zu nehmen, die sie bedarfsweise bis an weit entfernte Orte des Erdballs bringen, über funktionierende Infrastrukturnetze verfügen, welche die Versorgung und Entsorgung, Verkehrsverbindungen, Wasser- und Energieversorgung, die stationäre und mobile Kommunikation und das Surfen im Internet und vieles andere ermöglichen. Weitere große Menschheitsleistungen hat die Medizin hervorgebracht, dem Befinden der Menschen unmittelbar zugutekommen. Dies drückt sich u. a. in einer überraschend großen Steigerung der Lebenserwartung aus. Im Zuge des allgemeinen Fortschritts haben sich Religionen etabliert und sind vielerlei Kulturen erblüht. Die Menschen haben sich auch auf verschieden Weise künstlerisch betätigt und stellen erzeugte Kunstprodukte in Kathedralen, Museen, Galerien, Theatern und Kinos für jedermann zur Schau. Allerdings dienen leider nicht alle Segnungen der Technik dem Wohl der Menschheit.
Der Mensch verändert – wie kein anderes Lebewesen – das Antlitz unseres Planeten und das nicht immer in Einklang mit der Natur. Er nimmt vielfältige Eingriffe in die Geografie, Pflanzen- und Tierwelt vor und beutet die Schätze der Natur zu seinem Nutzen aus. Darüber hinaus gibt es Anzeichen, dass aus menschlichem Handeln gegenwärtig dabei ist, das Klimas unseres Planeten zu schädigen. Daraus könnten weitreichende Folgen resultieren, die sich dann gegen die Menschheit richten. Somit schließen wir mit dem Appell, alles die Natur Schädigende in Zukunft weitgehend zu unterlassen, denn wir haben nur diese eine Erde.
2. Werden, existieren, vergehen
– Betrachtungen über die Vielfalt des Lebens –
Motivation
Bei näherem Nachdenken über das Leben stößt man auf eine außerordentliche Bandbreite an Existenzen, Lebensformen, Veränderungen und Wechselbeziehungen. Daher erschien es sinnvoll, die dazu durchgeführten Betrachtungen einmal in geordneter Form darzulegen.
Bei dem hier gewählten Thema handelt es sich angesichts der Überfülle und Verschiedenartigkeit der Lebensformen um einen außerordentlich komplexen Behandlungsgegenstand. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden wir daher die Darlegungen in einzelne Aspekte aufgliedern sowie versuchen, die Fülle der Erscheinungen durch Verweise auf Beispiele etwas deutlicher zu machen.
Das Erscheinungsbild dieser Welt präsentiert sich bei abstrahierender Betrachtung als eine Abfolge und Verquickung einer unendlichen Fülle von Gebilden, Gesamtheiten, Dingen, Produkten und Wesen, die wir hier unter dem Überbegriff Systeme subsumieren. Dieser Systembegriff entstammt der kybernetischen Betrachtungsweise, der wir hier weitgehend folgen wollen.
Dort, wo es sich um natürliche Systeme handelt, zu denen ja auch wir Menschen gehören, werden ebenfalls nur formale Betrachtungen angewendet. Auf die mindestens ebenso wichtige ethisch-moralische Seite wird hingegen kein Bezug genommen.
Die allermeisten der außerordentlich zahlreichen Erscheinungsformen von Systemen haben eine endliche Lebenszeit, unterliegen also einem beständigen Wechsel von Werden und Vergehen. Darüber hinaus stößt man in Sonderfällen aber auch auf Systeme, die scheinbar oder zumindest theoretisch unendlich lange leben können. Dementsprechend werden wir die Behandlung aufteilen in solche mit endlicher und unendlicher Lebensdauer.
Betrachtete Systemarten
Als erstes stellt sich die Frage, was wir in die Kategorie des Lebendigen alles aufnehmen müssen. Merkmale des Lebens finden sich in einer ungeheuren Vielfalt von Gebilden und Erscheinungsformen. Betrachtet man die Ausdehnung der Gebilde, so reicht die Spanne von subatomarer über die globale bis in galaktische Größenordnung. Ebenso weit gefächert ist auch das Wesen bzw. sind die Erscheinungsformen von Gebilden mit dem Anspruch lebensartigen Daseins. Hier kann zunächst grob zwischen Gesamtheiten, wie Staaten, Regimen, Dynastien, Kulturen, Industriestandorten und ähnlichen Erscheinungen sowie andererseits der nahezu unendlichen Vielfalt von Geschöpfen dinglicher Art unterschieden werden. Bei Letzteren wiederum lässt sich eine Einteilung in natürliche und künstliche Objekte treffen. Die Kategorie der natürlichen Objekte ist die bei weitem umfassendere, da alle astronomischen, geologischen, floralen und lebendigen Objekte der Natur zugerechnet werden. Die lebendigen Wesen sind für uns natürlich die interessanteste Gruppe, da nicht nur das gesamte Tierreich von den Einzellern bis zu den Säugetieren, sondern auch wir Menschen mit dazugehören. Künstliche Objekte können weitgehend als Produkte bezeichnet werden, die deren Urheber Menschen sind. Zu diesen zählen u. a. Bauwerke in Form von Straßen, Brücken, Kanälen, Kraftwerken, Gebäuden verschiedenster Art wie auch Produkte, etwa Autos, Möbel, Kleidung bis hin zu Computern und Smartphones. Alle diese Objekte werden „geboren“, haben eine gewisse Lebensdauer und verschwinden eines Tages auch wieder in der Versenkung.
Entstehung des Lebens
Auch bei Betrachtung der Geburt von Leben stoßen wir auf eine große Vielfalt. Einige Wesen oder Gebilde erscheinen spontan, möglicherweise also unter Zufallseinfluss. Solche Ereignisse sind daher unvorhersehbar. Ein Beispiel dafür ist das Entstehen bestimmter subatomarer Materie beim Zusammenprall hochbeschleunigter Kernbausteine. In anderen Fällen, etwa dem Entstehen vulkanischer Inseln im Ozean, kommt es aufgrund tektonischer Prozesse zunächst in der Tiefsee zur längerfristigen Materialausschüttung, bis diese soweit aufgetürmt ist, dass sie irgendwann die Meeresoberfläche überschritten hat und somit eine Insel geboren wurde. In der Politik kommen hingegen neue Regime entweder durch Wahlen oder durch einen Putsch an die Macht. Weltreiche entstehen wiederum im Ergebnis oft jahrelanger Kriege und Eroberungen. Auch Kulturen bilden sich langsam heraus, sodass deren Anfang meist nur schwer bestimmbar ist. Im Reich der Pflanzen kommen neue Ableger vorwiegend durch Keimen von Samen in periodischer Folge und gesteuert durch den jahreszeitlichen Rhythmus zur Welt. In den Wüsten und Savannen werden neue Pflanzen hingegen erst nach Eintreffen der nur bedingt vorhersehbaren Regenfälle zum Leben erweckt. Während im Tierreich bei den niederen Formen eine ungeschlechtliche Vermehrung vorherrscht, dominiert bei den höheren Arten die geschlechtliche Fortpflanzung auf der Grundlage der Befruchtung weiblicher Eizellen durch männlichen Samen. Die befruchteten Eier führen dann nach artspezifisch festgelegter Tragzeit zur Geburt neuen Lebens. Dazu ist bei manchen Arten der letztgenannten Kategorie, beispielsweise den Vögeln, aber auch Großtieren wie Bären, Hirschen und anderen Arten, ebenfalls ein jahreszeitlicher Einfluss auf die Zeugung und damit auch Geburt des Nachwuchses feststellbar. Die Primaten und auch wir Menschen sind hingegen nahezu jederzeit zeugungs- und damit auch gebärfähig.
Besonders bei den natürlichen Systemen haben neu entstandene Lebewesen Vorgänger, die allgemein als Eltern bezeichnet werden. Die Neugeburten sind somit die Nachkommen dieser Eltern. Eine Variante besteht darin, dass quasi gleichzeitig mehrere Nachkommen geboren werden. Davon machen zahlreiche Tierarten regen Gebrauch, damit trotz der in der ersten Lebenszeit hohen Sterberate bzw. dem hohen Überlebensrisiko ein genügend großer Anteil an Nachkommen überlebt und somit das Fortbestehen der Art gesichert wird.
Bei den biologischen Objekten zumeist um Wesen, die Gattungen bzw. Arten angehören und Mitglieder von Generationsfolgen sind. Solche Wesen treten uns also nicht als isolierte Individuen, sondern als Folgen von aus diesen hervorgegangene Nachkommen entgegen. Eltern und Nachkommen existieren zumeist zeitgleich. Zwischen ihnen bestehen Beziehungen verwandtschaftlicher Art. Auch Geschwister weisen untereinander Ähnlichkeiten auf. Beim Generationswechsel werden lebensbestimmende Eigenschaften von den Eltern an die Nachkommen übertragen, also vererbt. Außer der Vererbung der ist auch eine zufällige Komponente mit im Spiel. Die Nachkommen sind somit keine Kopien ihrer Eltern. Diese Mischung aus Merkmalen beider Elternteile sowie eines Zufallsanteils sind somit die Mitgift an die Kinder. Jedes dieser Wesen ist somit einzigartig.
Genau diesen Mechanismus, bestehend aus Vererbung, Mutation, Rekombination und Selektion, nutzt bereits auch die Evolution, aus deren Wirken die großartige Vielfalt wohlangepasster und damit lebenstüchtiger Arten hervorgegangen ist, die inzwischen alle Nischen unserer Erde besiedelt.