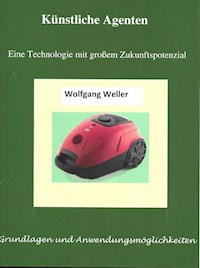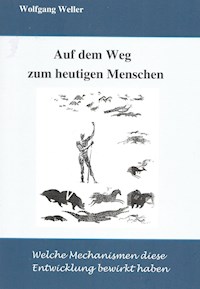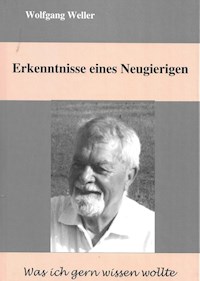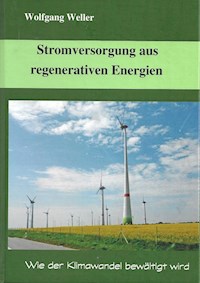
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Weller Stromversorgung aus regenerativen Energien Im vorliegenden Band wird eine Darlegung des Klimawandels und den dazu ergriffenen entgegenwirkenden Maßnahmen zur Umstellung auf regenerative Energiequellen gegeben. Der im Vordergrund stehende Behandlungsgegenstand betrifft die Gewährleistung der elektrischen Stromversorgung unter den Bedingungen des zunehmenden Beitrags der eingesetzten natürlichen Energieträger. Dazu wurden technische Lösungsvorschläge zur Nutzung der Sonnenstrahlung, Windströmung und Meereswellen an Land, in Ufernähe und auf offener See vorgestellt. Die Stoffdarbietung stützt sich weitgehend auf eigene Ausarbeitungen zu unterschiedlichen Teilthemen, die teilweise auch bereits veröffentlicht wurden. Dennoch war es keine leichte Aufgabe, die zu verschiedenen Zeiten aus eigener Tätigkeit unabhängig voneinander entstandenen Beiträge zu verschiedenen Teilaspekten zusammenzuführen, sodass am Ende eine kohärente Darstellung des facettenreichen Gebiets entstand. Wenn das Buch diesem Anspruch genügte, dann hätte sich die Mühe gelohnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Weller
Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen
mit überwiegend eigenen Fotos und Grafiken des Autors
Wie der Klimawandel bewältigt wird
Impressum
Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen
Wolfgang Weller
Copyright: © 2020 Wolfgang Weller
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin
ISBN s. Cover Rückseite
Inhaltsverzeichnis
Kap.
Thema
Seite
Prolog
7
1
Ausführungen zum Klimawandel
9
2
Der Treibhauseffekt bedroht das Weltklima
21
3
Einsatz regenerativer Energien zur Stromerzeugung
29
4
Von der Energiewende besonders betroffene Gebiete
33
5
Stromgewinnung aus solarer Energie auf Basis der Photovoltaik
37
6
Dezentrale Inselnetze auf Basis photoelektrischer Stromgewinnung
43
7
Selbstversorgende Stromnetze mit integrierter Kleinwindkraftanlage
51
8
Hybride energieautarke Stromversorgungssysteme mit Wasserstofftechnologie
57
9
Erzeugung von Wüstenstrom aus solarer Quelle
10
Meerwasserentsalzung durch Einsatz solarer Energie
73
11
Stromgewinnung aus Abwärme insbesondere von Wärmekraftwerken
79
12
Stromgewinnung aus Windkraft an Land und im Offshore- Bereich
87
13
Stromgewinnung aus Windkraft im Bereich der Tiefsee
97
14
Stromgewinnung aus der Energie der Meereswellen in flachen Uferzonen
107
15
Stromgewinnung aus der Energie der Meereswellen an steilen Küsten
115
16
Architektur künftiger Stromversorgungssysteme mit regenerativen Energien
123
Epilog
133
Prolog
Der Autor hat sich über mehr als ein Jahrzehnt mit Fragen des Klimawandels und insbesondere mit der Entwicklung tragfähiger Problemlösungen für den Einsatz regenerativer Energien befasst. Dabei entstand eine Anzahl von Beiträgen, die sich auf seinem Computer, verstreut in unterschiedlichen Dateien, befinden. Aus einigen von ihnen sind Veröffentlichungen in anerkannten Fachjournalen hervorgegangen.
Es erschien nun an der Zeit, das erworbene Wissen auf dem Gebiet der Energiewende und speziell der Erneuerbaren Energien zusammenzuführen, zu überarbeiten und in eine einheitliche Form zu bringen. Einige Kapitel mussten auch neu erstellt werden. Aus der Notwendigkeit, die einzelnen Beiträge sachgerecht zu ordnen, resultierte dann die Einführung von Kapitelbezeichnungen, was wiederum die Möglichkeit zu Querverweisen innerhalb des Gesamtwerkes bot. Aus all dem entstand eine gesamtheitlichen Darstellung, welche die Entwicklung eines Teilgebiets der modernen Energietechnologie widerspiegelt und möglichweise als Monografie betrachtet werden kann.
Die inhaltliche Stoffbehandlung nimmt ihren Ausgang von den stattfindenden Klimaveränderungen und den zur Abwehr ihrer Folgen festgelegten Ziele. Danach werden die wesentlichen, bei der Umstellung eingesetzten regenerativen Energiequellen und deren Eigenschaften dargelegt. Den Schwerpunkt der Behandlung bilden dann die Darlegung zahlreicher Ideen und Lösungsvorschläge zur Umgestaltung der Anlagen zur Stromversorgung unter Verwendung natürlicher Energien unter Berücksichtigung der in Deutschland bestehenden Bedingungen.
Der Autor wünscht dazu eine interessante Lektüre.
Kapitel 1
Ausführungen zum Klimawandel
Der Klimawandel als weltweite Herausforderung
Der Klimawandel ist globaler Natur und zeigt sich in einer zunehmenden Erwärmung der Atmosphäre und der WeltmeereNach einem Bericht des Weltklimarats IPPC(Intergovernmental Panel on Climate Change) könnte die globale Erwärmung der Atmosphäre im Lauf des 21. Jahrhunderts um 1,8 – 4 0C ansteigen [1]. Nach jüngsten Feststellungen hat sich die Globaltemperatur bereits jetzt um 1 0C erhöht. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts wird in einer pessimistischen Prognose mit einem Anstieg im Bereich 2,6 - 4,8 oC gerechnet. Bei sehr ambitionierten Klimaschutzmaßnahem liegt im allergünstigsten Fall die Wahrscheinlichkeit einer Erderwärmung zwischen 0,3 - 1,7 oC. Daraus ist unschwer zu erkennen, dass es dringend nottut, sich dieser Entwicklung entschieden entgegenzustemmen.
Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich an deutlich wahrnehmbaren Erscheinungen.Dazu zählt das Wettergeschehen, begleitet vom Aufkommen extremer Hitzewellen, langer Dürreperioden, gewaltiger Wetterkapriolen sowie dem Abschmelzen der Eisdecke an den Polen wie auch der Gletscher in den Hochgebirgen und dem Auftauen der Permafrostböden. Auch droht mancherorts der Verlust menschlichen Lebensraumes durch den Anstieg des Meeresspiegels, u. a. m.
Diese Entwicklung geht einher mit der in mehreren Regionen der Erde auftretenden Luftverpestung insbesondere in stark belasteten Industriegebieten, in den Megacities und in Gebieten nahe von Waldbränden, welche die Gesundheit schädigen und die Lebensqualität der Menschen mindern. Da nützt es auch nichts, wenn einzelne Persönlichkeiten, wie der USA-Präsident, den Klimawandel als eine Erfindung der Medien bezeichnen, um die USA schädigen, oder namhafte AfD-Politiker die Existenz der Klimaveränderungen überhaupt bezweifeln.
Als Ursachen des Klimawandels gelten die verstärkt emittierten sog. Treibhausgase, unter denen neben Methan vor allem das atmosphärische Gas Kohlendioxid eine herausragende Rolle spielt. Das zuletzt genannte CO2 entsteht aus
jeder Art von Verbrennung. Als Hauptquellen dafür gelten neben Vulkanausbrüchen und Waldbränden vor allem die Verbrennung fossiler Energieträger, insbesondere von Braun- und Steinkohle bei der Stromerzeugung sowie die Benutzung von Benzin, Dieseltreibstoff, Kerosin zum Betreiben von Fahrzeugen. Aber auch die künstliche Vernichtung großer Waldgebiete durch Brandrodungen, wie im Amazonasgebiet, spielt eine negative Rolle. Dies alles verweist wiederum auf uns Menschen als die Hauptverantwortlichen. Der globale Klimawandel ist also weitgehend menschengemacht (anthropogen).
Wenn also dem Klimawandel Ursachen der menschlichen Tätigkeit zugrunde liegen, dann kommt dieser Spezies auch die Hauptverantwortung dafür zu, die negativen Folgen insbesondere des CO2-Ausstoßes auf das Klima weitgehend einzuschränken oder zumindest stark zu begrenzen, damit ein Leben auf unserer Erde auch für die nachfolgenden Generationen noch möglich oder zumindest erträglich sein wird.
Die vorgesehenen Maßnahmen zur Begegnung der Herausforderung
Angesichts der globalen Dimension des Klimawandels ist die Völkergemeinschaft insgesamt gefordert, nachhaltig wirkende Maßnahmen zur Abwehr der drohenden Klimaveränderung zu ergreifen. Ausdruck dieses Bemühens sind die seit Kyoto in Abständen wiederholt durchgeführten Weltklimakonferenzen. Dort sollten die Staaten der Welt sich zur Festlegung von Einsparungszielen verpflichten und zumindest Grenzwerte für den Ausstoß des Treibhausgases CO2 vereinbaren. Weiterhin fand auf UN-Ebene in New York ein Welt-Klimagipfel statt, von dem die Festlegung weiterer, möglichst energischer Schritte zur Eindämmung der Klimaverschlechterung erwartet wurde. Leider hatten sich bis dahin ausgerechnet die Länder mit dem höchsten Ausstoß schädlicher Abgase geweigert, eigene Verpflichtung in einzugehen bzw. waren dieser Vereinigung erst gar nicht beigetreten. Einen Durchbruch hat es unter dem Druck der erkennbaren Auswirkungen der Klimaveränderung erst auf der UN-Klimakonferenz von Paris am 12. Dezember 2015 gegeben. Dort haben sich nach zähem Ringen erstmalig alle Länder auf ein neues weltweites Klimaschutzabkommen geeinigt. Alle Staaten traten nunmehr einem Vertrag bei, dessen erklärtes Ziel die Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5-20 C ist [2].
Es galt nun, die aus übergeordneter Sicht erlassenen Vorgaben auf nationaler Ebene umzusetzen. In Deutschland hat die Bundesregierung nach zähen Beratungen ein sog. Klimaschutzpaket verabschiedet, welches die nationalen Ziele bis zum Jahr 2030 festgelegt und terminierte Vorgaben für ein Bündel von Maßnahmen enthält. Darin ist vorgesehen, Einsparungen von 40% gegenüber 1990 bis zum Jahr 2020 vorzunehmen und diese dann bis 2050 auf 80 – 95% zu steigern [3], [4]. Darüber hinaus wurde auch für die Zukunft ein ehrgeiziges Ziel vorgegeben, wonach unser Land bis 2050 klimaneutral sein will. Auch das Bundesland Berlin schließt sich diesem Ziel an, indem es laut Senatsbeschluss anstrebt, die Stadt bis 2050 klimaneutral umzugestalten.
Eine wesentliche Maßnahme wird nach dem bereits verfügten Ausstieg aus der Kernkraft eine schrittweise Substitution der bisherigen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerke sein. Dazu wurde kürzlich vom Bundestag das sog. Kohleausstiegsgesetz verabschiedet, in dem festgelegt ist, dass die Kohleverstromung schrittweise abgebaut und das letzte Kohlekraftwerk spätestens 2038 stillgelegt wird [2].
Systembeschreibung
Der Autor ist es von Berufswegen gewohnt, bestehende Zusammenhänge aus kybernetischer Sicht zu behandeln. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn es sich – wie hier – um ein höchst komplexes Problem handelt, welches nur schwer zu durchschauen ist. Und genau an dieser Stelle setzt unser Bemühen an, unter Anwendung moderner theoretischer Verfahren möglicherweise eine Hilfestellung zu bieten. Dazu werden wir hier versuchen, das Phänomen der Klimaveränderung und dessen Management von Seiten der Systemtheorie anzugehen [3]. Merkmale dieses Zugangs sind
die Unterscheidung von
System
und
Umgebung
, die durch einen (wählbaren)
Systemrand
voneinander getrennt sind und miteinander wechselwirken,
ein interner Systemaufbau, gekennzeichnet durch eine Anzahl von
Elementen
, die miteinander verbunden sind und eine
Struktur
bilden,
das Vorhandensein von
Inputs
und
Outputs
sowie von
Systemzuständen,
sowie ein internes zielorientiertes
Verhalten
des Systems.
Die Behandlung des Problems der Klimaveränderung und seiner Eindämmung soll durch die nachfolgend dargestellte systemorientierte Grafik unterstützt werden.
Kybernetische Systeme betrachten wir allgemein alsfunktionsfähige Einheiten, die aus einer Gesamtheit im Innern befindlicher Elemente bestehen. Was hier als eine existenzielle Gesamtheit herausgegriffen wird, bestimmt der Systemrand – eine endlose Hüllfläche – deren Umfang wählbar ist. Im vorliegenden Fall können wir selbst bestimmen, ob unser betrachtetes System das weltumspannende Klimasystem, eines Staatenverbundes, eines Landes – ggfs. also Deutschlands – oder einer Region sein soll. Dementsprechend wird es also eine unterschiedliche Anzahl und auch verschiedene Arten von Elementen enthalten. Wir werden hier keine Festlegung bezüglich des Systemumfangs treffen, sondern die bestehende Wahlmöglichkeit offen halten.
Als nächstes führen wir die Interpretation unseres Systems als eine Art künstlicher Organismen ein. Dementsprechend handelt es sich um vitale Systeme. Diese Metapher halten wir für geeignet zur Unterstützung der nachfolgenden Darlegungen, da wir ja selbst auch ein lebender Organismus sind und somit dementsprechend die gegebenen Erläuterungen gut nachvollziehen können.
Den Gegenpart zum System bildet die Umwelt. Theoretisch gehört zur Umwelt sozusagen der „Rest der Welt“. Davon haben wir jeweils nur einen speziellen Ausschnitt zu berücksichtigen
Zwischen den Systemen und ihrer Umwelt gibt es bestimmte Wirkbeziehungen. Einige dieser Beziehungen wirken als Inputs. Dazu zählen im vorliegenden Fall die verschiedenen Arten der verwendeten Energien, die zugeführt werden. Dazu knüpfen wir wieder an unsere Interpretation der betrachteten Systeme als vitale Systeme an. Wie allgemein bekannt, bedürfen Organismen zu ihrer Lebenserhaltung der Nahrungszufuhr. Diese Notwendigkeit übertragen wir auf unsere Betrachtungen, indem es sich bei den Inputs hier um die Zufuhr von Energie handelt. Berücksichtigen wir den vorliegenden Istzustand, so sind bei der betrachteten Systemkategorie durchaus mehrere Energiequellen zu berücksichtigen, die von unterschiedlicher Art sind. Dazu gehören einerseits fossile und auch atomare Brennstoffe sowie auch andere thermische Quellen, etwa in Form von Bränden oder Vulkanausbrüchen. Solche Energiequellen sind derzeit durchaus noch vorhanden und werden einerseits in den noch vorhandenen Kraftwerken dieser Art zur elektrischen Stromerzeugung sowie in Industrieanlagen in der Produktion verwendet. Fossile Brennstoffe, diesmal in Form von Benzin und Dieselkraftstoffen, werden derzeit außerdem in großem Umfang noch für den Antrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren eingesetzt.
Die Nutzung dieser klimaschädlichen Energiequellen soll im Sinne der Umweltschonung möglichst schnell abgebaut werden. Geeignete Ersatzmöglichkeiten, die von klimaneutraler Wirkung, bieten die regenerativen Energiequellen, welche die Umwelt in verschiedener Form quasi kostenfrei zur Verfügung stellt. Zu dieser Gruppe zählen die aus dem Weltraum zugeleitete solare Strahlung, die aus der Atmosphäre stammende Windströmung sowie auch die Wellenbewegungen der Meere. Solche Energiearten werden teilweise bereits jetzt zur Stromerzeugung genutzt, wofür neuartige Kraftwerke in Form von Solar-, Wind- und – soweit die Bedingungen gegeben sind – auch Meereskraftwerke eingesetzt werden. Bei den Fahrzeugen wird vor allem ein Umstieg auf Elektroantriebe unter vorzugsweiser Nutzung von Ökostrom propagiert, was aus mancherlei Gründen jedoch nur zögerlich angenommen wird.Damit sind die beiden Hauptverursacher für den Ausstoß von Kohlendioxid benannt.
Bei unseren vitalen Systemen besteht also gegenwärtig noch ein gewisses Sammelsurium an Energiequellen, wovon allerdings im Zuge der Energiewende einige zugunsten der erneuerbaren Energien verabschiedet werden sollen. Somit entpuppt sich der Klimawandel aus der Sicht der hauptsächlich eingesetzten Gegenmaßnahmen als ein Problem der Energiewende.
Die den vitalen Systemen aus verschiedenen Quellen zugeführten Energien werden – wie auch in jedem anderen Organismus – intern zur Erhaltung ihrer Lebensfunktionen, wie man landläufig sagt, „verbraucht“. Genauer betrachtet, lehrt uns allerdings der 2. Hauptsatz der Wärmelehre, dass Energie weder gewonnen noch verlorengehen kann. Ergo handelt es sich in Wahrheit um eine Energiewandlung von einer höherwertigen in eine qualitativ niedere Form, zumeist in Wärme.
Die Nutzung der verschiedenen Energiequellen hat auch Auswirkungen auf die innerhalb des Systems vorhandenen Elemente. Dies können je nach Art der Stromquellen Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke, Wasserkraftwerke, Solaranlagen, Windkraftwerke, Industrieanlagen, Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antriebsarten, aber auch Menschen und sogar Tiere sein, sofern diese mit der Klimaänderung in einer Beziehung stehen. Bei dem zu bewältigenden Klimawandel handelt es sich nicht nur um die bereits vereinbarte sukzessive Abschaltung vorhandener Kernkraftwerke und schrittweise Stilllegung der Kohlekraftwerke, sondern auch einen gravierenden Umbau des Verkehrswesens. Auf der Gegenseite werden neuartige Stromerzeugungsanlagen und Fahrzeugantriebe auf Basis erneuerbarer Energien zum Einsatz kommen. Somit findet ein beständiger Umbau des Systeminneren statt. Die diesbezüglichen Maßnahmen haben vielfältige Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Elementen, wobei die Folgen für die betroffenen Menschen besonders schwerwiegend sind. Im vorliegenden Fall handelt es sich hier um Systeme, die sich selbst verändern und folglich dynamische Systeme genannt werden. Dies ist nicht zu verwechseln mit Systemen, in denen zeitabhängige Vorgänge stattfinden, während diese selbst zeitinvariant sind.
Auch wenn es weniger appetitlich ist, so produzieren organismische Systeme, also auch wir, einen Output. Sagen wir es etwas verblümt: Jedes System erzeugt auch Rückstände, Abfall oder wie immer man es nennen will. Im Falle unserer Klimasysteme handelt es sich bei dem Output in erster Linie um die Emission schädlicher Treibhausgase, allen voran das Kohlendioxid, sowie in der Übergangsphase auch um die Freisetzung langzeitlich strahlender atomarer Rückstände. Auch Asche und ähnliche Materialien gehören dazu. Beim CO2-Ausstoß geht es vor allem darum, diese Hinterlassenschaft durch die Einführung geeigneter system-immanenter Maßnahmen so schnell wie möglich herunterzufahren. Weitere Wechselbeziehungen, die wir in unserer Grafik ebenfalls berücksichtigen, bestehen zwischen den betrachteten Systemen und der zur Umwelt gehörenden Natur. So hat einerseits der verstärkte Ausstoß schädlicher Gase Auswirkungen auf das Weltklima, indem es dort zu einem sich derzeit immer noch fortsetzenden Temperaturanstieg kommt. Des Weiteren gibt es durchaus erhebliche Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt. Umgekehrt wirkt sich die Klimaerwärmung auf das globale Wettergeschehen aus, wobei es zu Wetterkapriolen bisher nicht bekannter Intensität kommt.
Systemverhalten
Wir befassen uns nun mit dem dynamischen Verhalten des globalen Klimasystems in der hier betrachteten Form eines vitalen Systems. Dieses System soll einem bestimmten Zweck dienen, nämlich der schädlichen CO2-Emission entgegenwirken, sodass ein weiterer Temperaturanstieg und damit Schädigungen von Menschen und der Natur abgewendet werden. Konkret bedeutet das vor allem Erhalt der
Vitalität
Lebensqualität
Mobilität
Damit ist eine grobe Zielstellung bereits vorgegeben. Die Umsetzung dieses Ziels ist aus verschiedenen Gründen nicht sofort erreichbar, weshalb ein dynamischer Prozess zu durchlaufen sein wird, an dessen Ende die erwartete Zielerreichung stehen soll. Dabei sind vorwiegend aus Kreisen der Politik bestimmte terminierte Zwischenziele vorgegeben, auf die im Falle Deutschlands bereits vorstehend verwiesen wurde.
Der Prozessablauf unterliegt bestimmten Forderungen, die als sog. Randbedingungen einzuhalten sind. Dazu zählen insbesondere
verträglicher Strukturwandel, realisiert durch einen geeigneten schrittweisen Systemumbau
weitgehender Erhalt der kommunalen Standorte als lebensfähige Einheiten
behutsame Umstellung der Beschäftigungssituation der Menschen durch Bereitstellung neuer Arbeitsplätze
Einbeziehung des Rückbaus nicht mehr benötigter Produktionsmittel und Renaturierung erzeugter Brachen
kluger Einsatz der begrenzt verfügbaren finanziellen Mittel in Form staatlicher Hilfen und Fördermaßnahmen
Berücksichtigung der Auswirkungen der Umstellung auf das Meinungsbild der betroffenen Menschen
Beachtung parteipolitischer Interessen
Das System soll aus sich selbst heraus diesen Wandlungsprozess vollziehen. Dazu bedarf es einer internen Steuerung, die ein komplexes und intelligentes Verhalten realisiert.
Es stellt sich noch die Frage, welche Strategien der systeminternen Steuerung zur schrittweisen Reduzierung des CO2 -Ausstoßes zur Verfügung stehen, um den zielorientierten Umstellungsprozess bis hin zur eines Tages erreichten Klimaneutralität zu gewährleisten. Diese beziehen sich auf die verfügbaren Einzelkomponenten (Systemelemente), wie Fahrzeuge, Kraftwerke, Industrieanlagen etc.
Dafür gibt es folgende Wahlmöglichkeiten:
Enthaltung
Enthaltung bedeutet immer Verzicht und passt daher nicht in eine Welt, die auf beständigen Fortschritt gerichtet ist.
Beispiel: So fordern Puristen etwa die generelle Entfernung von Autos aus dem Straßenverkehr, was wohl kaum durchsetzbar sein wird.
Reduzierung
Hier geht es um das Unterlassen von nicht unbedingt Notwendigem, d. h. um Sparen.
Beispiel: Man muss nicht jeden Schritt mit dem Auto oder als Einzelperson unbedingt mit einem SUV fahren, sondern kann auch einen positiven Beitrag leisten, etwas zur Minderung des CO2-Ausstoßes zu tun.
Vermeidung
Nutzung von vorhandenen Alternativen, die ähnliches leisten.