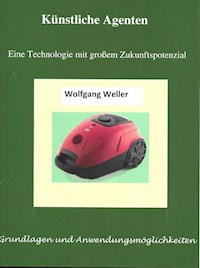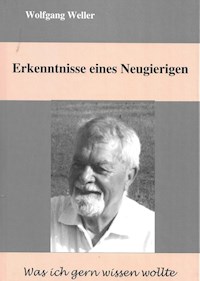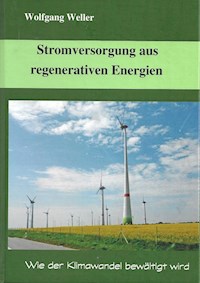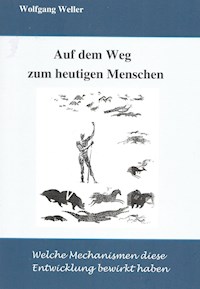
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es werden Entwicklungsprozesse des menschlichen Daseins nachgezeichnet, die zwei unterschiedlichen Perioden angehören. Zum einen wird auf die biologische Evolution eingegangen, die, ausgehend vom modernen Menschen den heutigen Menschen hervorgebracht hat, der mit einer besonderen biologischen Mitgift ausgestattet ist. Die nachfolgende Etappe menschlichen Daseins wird kulturelle Etappe genannt, in der der heutige Mensch seine besonder biologische Ausstattung genutzt hat, um in Eigenaktivität fortlaufend erhebliche Fortschritte zu erzielen. Diese haben Auswirkungen gehabt, die zu grundlegenden Verbesserungen seines Daseis führten. Außer den zahllosen positiven Effekten diese Entwicklung sind auch immer wieder negative Anwendungen zu verzeichnen. Ebenso wird auf die Auswirkungen menschlicher Tätigeit auf die Natur eingegangen. Den Abschluss bildet ein vorsichtiger Blick in die Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Weller
Auf dem Weg zum
heutigen Menschen
Welche Mechanismen diese
Entwicklung bewirkt haben
Impressum
Copyright: © Text by Wolfgang Weller (2019)
Druck und Verlag: epubli GmbH. Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-xxx-xxxx-x
Vorwort
Vor 2 ½ bis 2 Mrd. Jahren haben sich auf der Erde erstmals Zeichen des Lebens gezeigt. Daraus ist eine gigantische Entwicklung entstanden, in deren Folge eine Unzahl von Pflanzen- und Tierarten entstanden sind, die unserem Planeten besiedelten. Im Zuge der Entstehung so vieler Arten kam es später auch zur Herausbildung des Modernen Menschen. In neuerer Zeit schloss sich daran die Entwicklung zum heutigen Menschen an, so wie er sich derzeit darbietet.
Da kann in einer Mußestunde schon mal die Frage aufkommen, auf welche Weise es zu dieser Entwicklung gekommen ist.
Mit den folgenden Ausführungen wollen wir versuchen, auf diese Fragestellung eine Antwort zu geben. Bei diesem Bemühen wurde schnell klar, dass es sich hier um das Ergebnis von Entwicklungsprozessen handelt. Dies lenkte dann unser Interesse auf das Erkennen der dahinter stehenden Wirkmechanismen. Diese sollen erklären, auf welche Weise die Welt des Menschen, so wie wir sie jetzt vorfinden, entstanden ist und wie sich entfalten konnte.
Der Entwicklung zum Modernen Menschen zunächst nachgehend, stößt man auf das Wirken der biologischen Evolution. Dieses Prinzip hat offenbar während sehr langer Zeiträume zur Entwicklung dieser Unzahl verschiedenartigster Pflanzen und Tiere einschließlich des Menschen geführt und die bestmögliche Anpassung an ihren jeweiligen Lebensraum ermöglicht. Daraus resultiert sofort das Interesse, zu erfahren, wie dieses Prinzip funktioniert, welches solche Leistungen hervorbringt. Ergo werden wir besonders die Geschichte verfolgen müssen, in welcher Weise die biologische Evolution den Modernen Menschen hervorgebracht hat und was diese Spezies gegenüber den anderen Gattungen von Lebewesen auszeichnet.
Es ist unverkennbar, dass der Moderne Mensch nach seiner Herausbildung nochmals eine beträchtliche Entwicklung durchlaufen hat, die sein Dasein tiefgreifend veränderte. Da dieser Prozess in einer vergleichsweise geschichtlich kurzen Zeitspanne abgelaufen ist, müssen dafür andere Wirkprozesse verantwortlich sein. Da diese Mechanismen ebenfalls evolutive Züge tragen. werden wir dafür die Bezeichnung kulturelle Evolution wählen. Dennoch ist zu erwarten, dass diese Prinzipien auf völlig anderen Effekten beruhen. Dabei soll auch verdeutlicht werden, zu welch erstaunlichen Ergebnissen die im Laufe der Entwicklung zum heutigen Menschen erbrachten Leistungen bisher geführt haben.
Schließlich wollen wir auch – so gut es geht – einen Blick in die zukünftige Entwicklung der Menschheit wagen und dabei auf besondere Herausforderungen hinweisen.
Entsprechend dieser Vorschau scheinen die benötigten Zugangsmöglichkeiten gefunden zu sein, um die eingangs aufgeworfene Problemstellung mit einer gewissen Erfolgsaussicht behandeln zu können. Also machen wir uns getrost ans Werk.
Der Einfluss der biologischen Evolution auf die
Entwicklung zum Menschen
1.1 Abriss der biologischen Entwicklung zum heutigen Men schen
Schaut man sich in der Natur um, so ist es im Verlauf eines überaus langen Zeitraums zur Entstehung einer ungeheuren Vielzahl und Verschiedenartigkeit vorhandenen Pflanzen oder Lebewesen, gleichgültig, ob an Land oder im Wasser lebend, gekommen, die an ihren jeweiligen Lebensraum perfekt angepasst sind. Verantwortlich dafür muss also ein Wirkprinzip sein, das diese Artenvielfalt generiert und die Adaption an den jeweiligen Lebensraum ermöglicht. Diesem Problem ist schon Charles Darwin nachgegangen und hat im Ergebnis seiner vielseitigen Forschungen die Evolution als Ursache erkannt. Die wissenschaftliche Welt würdigte seine außerordentlichen Verdienste des Schöpfers der Evolutionstheorie vor wenigen Jahren aus Anlass der 200-jährigen Wiederkehr des Geburtsjahres mit einer Fülle von Beiträgen zu seinem Lebenswerk.
Dank dieser Leistung Darwins ist mit der Evolution nun der Weg gefunden, um bei der Problembehandlung ein Stück voranzukommen. Diese Art der Evolution ist biologischer Natur, weshalb wir diese zwecks späterer Unterscheidung die biologische Evolution nennen wollen.
1.2 Mechanismus der biologischen Evolution
Im Sinne der beabsichtigten Aufklärung soll zunächst der Mechanismus der biologischen Evolution dargelegt werden. Dazu ist auf die grundlegenden Arbeiten von Ingo Rechenberg [1] und später auch seines Mitarbeiters Paul Schwefel zu verweisen. Bei der Beschreibung des inhärenten Mechanismus bedienten sie sich weithin geläufiger biologischer Metaphern, die die Verständlichkeit unterstützen. Später folgte dann eine algorithmische Fassung.
In Kurzform lässt sich das Evolutionsprinzip wie folgt erläutern. Die Evolution wirkt auf eine Folge von Generationen und hat rekursiven Charakter. Die Merkmale des auf evolutionärem Weg erreichten Entwicklungszustandes der Individuen der jeweiligen Generation sind in deren Genen verankert (gespeichert). Diese Gene werden durch Vererbung von den Eltern auf die Nachkommen (Kinder) weitergegeben. Diese Übertragung unterliegt zugleich aber auch einem Zufallseinfluss, was als Mutation bezeichnet wird. Dieser überlagerte Prozess variiert in zufälliger Weise, welche Anteile (Gene) der jeweiligen Elternteile auf die einzelnen Nachkommen vererbt werden, und führt zur Variation des ererbten Gensatzes. Dies ist der entscheidende Schritt, bei dem Neues generiert wird. Die Nachkommen bzw. deren Gene sind somit keine exakten Kopien (Klone) der Eltern, sondern verfügen sowohl gegenüber ihren Eltern als auch untereinander über etwas differierende Merkmale. Der Anteil des Zufallseinflusses kann in weiten Grenzen variieren, wovon die Entwicklungsdynamik beeinflusst wird. Im nächsten Schritt treten die gentechnisch etwas unterschiedlich ausgestatteten Nachkommen, ggfs. zusammen mit ihren Eltern, gemeinsam in einen Wettbewerb, indem sie sich den Bedingungen ihrer Umwelt stellen. Dabei kommt es zu einer natürlichen Auslese, die Selektion genannt wird. Am Ende überleben also in jedem Zyklus nur diejenigen, die mit der jeweiligen Umgebung vergleichsweise am besten zurechtkommen. Das sind dann die auf dieser Entwicklungsstufe Erfolgreichsten, was mit dem Slogan Survival of the fittest zum Ausdruck gebracht wird. Diese werden dann zu Eltern der neuen Generation bestimmt, worauf ein neuer Zyklus durchlaufen wird. Es ist noch darauf hinzuweisen, dass die Fittesten nicht notwendigerweise die Stärksten sind, wie von manchen Ideologen behauptet wird, sondern es sind die momentan am besten Angepassten. Durch wiederholten Durchlauf des beschriebenen Zyklus kommt es dann zur Herausbildung von immer besser an ihre Umgebung angepassten Individuen.
Neben dem beschriebenen Grundmuster der Evolution kann es noch allerlei Variationen geben, sodass man von verschiedenen Evolutionsstrategien spricht. So ist auch möglich, dass Individuen aus verschiedenen Populationen zu gemeinsamen Eltern werden und sich deren Gene auf diese Weise mischen. Wiederum können auch mehrere Populationen bspw. in abgegrenzten Gebieten sich parallel voneinander eigenständig entwickeln und nur gelegentlich zusammentreffen. Auf diese Weise ist es bei längerer Isolation dann auch möglich, dass sich eigene Arten herausbilden, die sich dann nicht mehr mit Mitgliedern aus anderen Regionen paaren können. Neue Arten entstehen auch, wenn Individuen – aus welchen Gründen auch immer – in eine neue Umgebung gelangen und sich deren Bedingungen anpassen müssen. Solche drastischen Änderungen der Lebensbedingungen treiben dann die Evolution oftmals in eine andere Richtung.
Der Evolutionsmechanismus kann noch durch weitere Teiloperationen, wie etwa das sog. Cross-Over, verfeinert werden, worauf hier nicht näher eingegangen wird. Außerdem gibt es mehrere Parameter, wie die Anzahl der Eltern bzw. der Nachkommen, die eingestellt werden können. Somit gibt es nicht nur schlechthin eine, sondern eine Vielzahl von spezifisch wirkender, auf der Basis des geschilderten Grundmechanismus generierbarer Evolutionsstrategien, die sozusagen eine Familie bilden.
Das Wirkprinzip der Evolutionsstrategie lässt sich verallgemeinert in Form des nachfolgenden Blockschaltbildes veranschaulichen.
Bild 1 vereinfachtes Blockschaltbild der biologischen Evolution
Die Evolution ist das Resultat von Experimenten unter Wirkung spezifischer Mechanismen einschließlich des Zufallseinflusses. Wesentlich ist, dass die Evolutionsstrategien kein vollständig deterministisches Verhalten besitzen und daher auch kein festes Ziel verfolgen.
Die Evolutionsstrategie(n) eignet (n) sich nicht nur als Denkmodell, sondern können in algorithmischer Form zu einen nützlichen Werkzeug mit vielerlei Anwendungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Dazu wurde beispielsweise an der Humboldt-Universität zu Berlin eine sog. Evolutionsstrategische Maschine in Form eines Softwareprodukts entwickelt und erprobt [2], [3], welche aus Graduierungsarbeiten eines fähigen Studenten unter der Leitung des Autors hervorging. Diese bietet die Möglichkeit, über eine komfortable Bedienoberfläche verschiedene Strategieparameter einzustellen und somit weitgehend beliebige Strategievarianten zu kreieren. Diese können im Zusammenspiel mit simulierten Anwendungsumgebungen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit getestet und damit die geeignetste herausgefunden werden.
1.3 Anwendung des Evolutionsmechanismus zur technischen Optimierung
Nach erfolgreicher Entschlüsselung des Mechanismus der Evolution in seinen wesentlichen Spielarten wurde dieses Prinzip von mehreren Anwendern auf seine Anwendungsmöglichkeiten für technische Zwecke untersucht. Als wesentliche Einsatzgebiet der – sozusagen künstlichen – Evolution zeigte sich zunächst die Verwendbarkeit als innovatives Optimierungsverfahren, um damit Bestlösungen vor allem technischer Gebilde zu ermitteln.
Die ersten Einsatzfälle der künstlichen Evolution waren auf die strömungstechnische Optimierung der Profile von Tragflügeln und Düsenformen gerichtet und wurden von I. Rechenberg selbst durchgeführt. Dazu wurden die Evolutionszyklen in der ersten Phase an den zu optimierenden Bauteilen in realer Weise durchgeführt, wobei Stellschrauben, Bleistift und Papier zum Einsatz kamen. Die dabei mit einem vergleichsweise größeren Aufwand und längerer Experimentierzeit erreichten Ergebnisse waren in der Tat vielversprechend. Eine wesentliche Verkürzung der Entwicklungszeit ergab sich, nachdem die Evolutionsmechanismen algorithmiert wurden, sodass der Evolutionsprozess auf Computer verlagert und damit simuliert werden konnte. Dies führte nicht nur zur Einsparung des bisher nötigen Bauaufwandes, sondern vor allem zu einer drastischen Zeitverkürzung dank der hohen Rechengeschwindigkeit von Computern. In diesem Falle musste auch die jeweilige Umgebung auf dem Computer simuliert werden, um den im Evolutionsschritt „Selektion“ vorgesehenen Test auszuführen, d. h. die Qualität der ermittelten Lösung zu bestimmen. Optimierungssysteme dieser Art sind seit einiger Zeit verfügbar und wurden bereits für unterschiedliche technische Anwendungen eingesetzt. Damit waren gute Voraussetzungen zur Optimierung vieler technischer Systeme auf der Basis von Evolutionsprozessen gegeben. Zu den erfolgreichen Anwendungen zählen u. a. die Optimierung von Strömungsprofilen, Rohrkrümmern, Stabtragwerken, Baukörperformen, optischen Linsen. Die erhaltenen Lösungen wiesen oft eine unerwartete Form auf, was auf die unorthodoxe Herangehensweise dieses Optimierungsprinzips zurückzuführen ist.
1.4 Besiedelung der Erde unter der Wirkung von Evolutionsstrategien
Im hier betrachteten Zusammenhang interessieren wir uns jedoch weniger für die Anwendungsmöglichkeiten von Evolutionsstrategien zur Systemoptimierung, sondern für deren Wirksamkeit im Zusammenhang mit der Entstehung der Vielfalt der Arten und der sukzessiven Besiedelung unseres Planeten zu Lande, in der Luft sowie auch auf und vor allem unter Wasser. Dabei kam es bekanntlich im Verlauf von Jahrmilliarden zur Herausbildung einer ungeheuren Vielzahl und großen Verschiedenartigkeit von Pflanzen und Lebewesen, die sich über die Erde verteilten und selbst in kleinste Nischen vordrangen. Die langzeitlich wirkende Evolution führte nicht nur zur perfekten Adaption der Pflanzen und Lebewesen an den jeweiligen Lebensraum, sondern brachte auch dank des in der Mutation enthaltenen Zufallseinflusses die Entstehung neuer Arten hervor.
Es gibt durchaus Lebewesen, deren Umgebung über sehr lange Zeit unverändert geblieben ist und die sich bereits sehr frühzeitig in ihrer Nische eingerichtet haben. Damit entfällt weiterer Anpassungsdruck und die Evolution stagniert. Ein extremes Beispiel dazu bilden die Bakterien, die sich z. T. über Milliarden von Jahren nicht verändert haben. Aber auch höher entwickelte Tiere, wie Krokodile oder Knochenfische, haben über sehr große Zeiträume hinweg keine merkliche Weiterentwicklung erfahren.