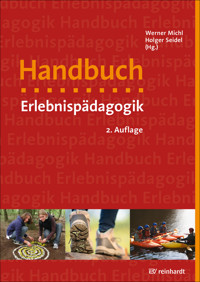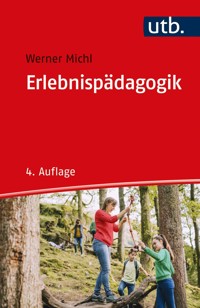
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Bildung
- Serie: utb Profile
- Sprache: Deutsch
Lange Zeit galt die Erlebnispädagogik als umstritten, sie hat sich allerdings mittlerweile durchgesetzt und wird heute in nahezu allen (sozial-)pädagogischen Praxisfeldern angewendet. Seit einigen Jahren ist sie nun auch in den Mittelpunkt von Hochschulen und Universitäten gerückt, als effiziente Methode des Lehrens und Lernens und als Gegenstand von empirischer Forschung. Werner Michl beantwortet in einem kompakten Einstieg die wichtigsten Fragen, z. B. zu Herkunft, Wirkung, Lernmodellen, Aktionsfeldern, Trägern und Zielgruppen der Erlebnispädagogik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
utb 3049
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
Narr Francke Attempto Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Ernst Reinhardt Verlag · München
Ferdinand Schöningh · Paderborn
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlag · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Prof. Dr. Werner Michl lehrte an der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und war außerordentlicher Professor an der Universität Luxemburg.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
UTB-Band-Nr.: 3049
UTB-ISBN 978-3-825-25334-9 (Print)
ISBN 978-3-838-55334-4 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-846-35334-9 (EPUB)
4., aktualisierte Auflage
© 2020 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Zeichnungen im Innenteil: Sibylle Roth, Freiburg i.Br.
Umschlagumsetzung: Atelier Reichert, Stuttgart
Satz: JÖRG KALIES – Satz, Layout, Grafik & Druck, Unterumbach
Printed in EU
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Einleitung
Hauptteil
1 Geschichte: Woher kommt die Erlebnispädagogik?
2 Kurt Hahn: Wie wird Erlebnistherapie zur Pädagogik?
3 Die Wiederentdeckung der Erziehung: Was hat die Erlebnispädagogik dazu beigetragen?
4 Lernmodelle: Last oder Lust des Lernens?
5 Von der Praxis zur Forschung: Wie wirkt Erlebnispädagogik?
6 Metaphorisches Lernen: Königswege oder Sackgassen?
7 Erlebnispädagogische Aktivitäten: Was und wie?
Anhang
Literatur
Sachregister
Danke für hilfreiche Tipps und Beratung:
Bernd Heckmair, Dr. Mario Kölblinger, Prof. Dr. Torsten Fischer,
Holger Seidel
Einleitung
Die Erlebnispädagogik ist für viele Pädagoginnen und Psychologen ein Königsweg des Lernens, für Politik und Presse manchmal eine teure und überschätzte Methode. Ausgewogene Einschätzungen sind selten. Blickt man zurück auf die Wurzeln der Erziehung und des Lernens, dann findet man jedoch zuhauf Hinweise auf die Wirksamkeit des handlungs- und erlebnisorientierten Lernens. Zudem werden die Lernprinzipien der Erlebnispädagogik derzeit durch die Ergebnisse der Lernforschung, des Konstruktivismus und der Neurobiologie (vgl. dazu Kapitel 4) bestätigt. Dieses Buch bietet einen Einstieg in die Erlebnispädagogik, geht – freilich stark verkürzt – auf die Geschichte des handlungsorientierten Lernens von Platon bis Kurt Hahn ein, will Thesen, Trends und Daten zur Erlebnispädagogik vorstellen und somit einen ersten Einblick in diese wirksame Methode des Helfens, Heilens und Lernens geben. Natürlich wurde schon Vieles zum Thema Erlebnispädagogik veröffentlicht. Sozusagen als Entschuldigung für diese mangelnde Innovation sei eine Anmerkung von Kurt Hahn, dem Begründer der Erlebnispädagogik, zitiert:
„Es ist in der Erziehung wie in der Medizin. Man muß die Weisheit der tausend Jahre ernten. Wenn Sie je zu einem Chirurgen kommen, und der will Ihnen den Blinddarm in einer möglichst originellen Weise herausnehmen, so rate ich Ihnen dringend, gehen Sie zu einem anderen Chirurgen“ (Hahn 1998, 292).
Über den Tellerrand blicken, Grenzen überschreiten, Herausforderungen annehmen, Hindernisse überwinden, Risiken abwägen und annehmen, Entscheidungen fällen und dazu stehen, einen eingeschlagenen Weg durchhalten, kreative Lösungen finden – das alles sind Kompetenzen, die heute gefordert werden und mit deren Vermittlung sich Schulen und Hochschulen schwer tun. Vermutlich deshalb, weil es hier nicht um Wissen geht, sondern um Haltungen, Einstellungen, um persönliches Wachstum, um – nehmen wir einfach ein altbackenes Wort – Charaktererziehung. Immer mehr setzt sich nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie die Einsicht durch, dass handlungs- und erlebnisorientiertes Lernen viel zu den oben genannten Kompetenzen beitragen kann.
Wer heute Soziale Arbeit, Heilpädagogik oder Erziehungswissenschaft studiert, wird mit großer Wahrscheinlichkeit während seines Studiums auf den Begriff Erlebnispädagogik stoßen. Diese pädagogische Methode, die mit Abenteuer und tiefen, prägenden Eindrücken verbunden wird, war lange Zeit umstritten. Sie hat sich jedoch in der Jugendarbeit, der Heimerziehung, der beruflichen Bildung, der Arbeit mit Menschen mit einer Behinderung, eigentlich in nahezu allen (sozial-) pädagogischen Praxisfeldern, durchgesetzt und über viele Umwege nun auch die Hochschulen erreicht. Der Weg ging also von der Praxis zur Theorie. War es 1990 nur eine Handvoll Bücher, so füllt die Fachliteratur zur Erlebnispädagogik heute mehrere Regale. Dieses kleine Buch will erste Einblicke geben für Studierende und interessierte Praktiker, die schnell zur Sache kommen wollen, es will einen Überblick vermitteln, einige Seitenblicke ermöglichen und schließlich einen Blick in die Zukunft werfen.
Erlebnis, Reflexion, Erziehung. Aus einem Schattendasein hat sich die Erlebnispädagogik zu einer mächtigen Methode entwickelt, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Praxis der Jugendarbeit und Heimerziehung erste Schritte getan und dann einen Siegeszug in allen Feldern der praktischen Pädagogik angetreten hat. Sie ist heute aus dem Spektrum der pädagogischen Möglichkeiten nicht mehr wegzudenken und etabliert sich zunehmend als Disziplin an den Hochschulen und Universitäten, an denen Diplom- und Bachelorarbeiten, Dissertationen und Forschungsprojekte zu diesem Themenkomplex stetig zunehmen.
Erlebnispädagogik „leidet“ unter einer mehrfachen Sprachlosigkeit; Erlebnisse sind erstens oft so prägend, so beeindruckend, dass die Sprache versagt. Und oft erscheint, zweitens, die Reflexion eines Erlebnisses als etwas Künstliches, Aufgedrängtes, etwas, durch das Erlebtes zerredet und zerstört wird. So drängt sich die Frage auf: War das Erlebnis nur dazu da, um vorgefertigten pädagogischen Zielen zu dienen? Drittens sind viele Praktiker der Erlebnispädagogik manchmal mund- und öfter schreibfaul. Wer oft mit den Gewalten der Natur konfrontiert wird, beschränkt sich eher auf das Wesentliche. Und schließlich: Je mehr man sich um eine Definition bemüht, umso mehr fließen die Gewissheiten wie Sand durch das Sieb der Erkenntnis.
Dazu kommt, dass Erleben eine sehr subjektive Kategorie ist. Franz Kafka schreibt in seinem Brief an den Vater (1995, 48): „… was mich packt, muss dich noch kaum berühren und umgekehrt, was bei dir Unschuld ist, kann bei mir Schuld sein, und umgekehrt, was bei dir folgenlos bleibt, kann mein Sargdeckel sein“. An anderer Stelle schreibt Kafka Folgendes: „Einmal brach ich mir das Bein. Das war mein schönstes Erlebnis“. Beide Aussagen zeigen, dass Erleben etwas ganz Persönliches ist, und es lässt sich nur genauer beschreiben, wenn man darüber spricht. Sprachlosigkeit und die Notwendigkeit der Kommunikation stehen hier in einem gewissen Spannungsverhältnis.
Erleben und Erziehen stellt eine noch schwierigere Verknüpfung dar. Wie könnte man sich diesem Verhältnis annähern? Dazu dient zunächst eine Spirale aus den drei Tätigkeiten Erleben, Erinnern, Erzählen. Nur Erleben ist blinder Aktionismus, nur Erinnern ist ein Gefängnis, in dem viele alte Menschen sich befinden, nur Erzählen wird zum leeren Geschwätz. Erst wenn ein Erlebnis erinnert und erzählt, und damit neu durchlebt und verarbeitet wurde, kann sich diese Spirale zu einer neuen Schleife aufschwingen. Diese Spirale ist sozusagen der Weg vom Ist zum Soll und beschreibt damit Möglichkeiten der Persönlichkeitsbildung und Kräfteentwicklung.
Das Bild von der „Waage der Erlebnispädagogik“ kann das Verhältnis zwischen Ereignis, Erlebnis und Transfer verdeutlichen (Abb. 1). In der linken Waagschale befinden sich die Ereignisse, die Erlebnispädagoginnen und -pädagogen anbieten. Vom Individuum werden die Ereignisse zu einem Erlebnis verarbeitet. Jedes äußere Ereignis wird unterschiedlich interpretiert und eingeordnet, je nach Biografie, Stimmung, Einstellung und Lebensalter. Dann wieder sind wir Pädagogen am Zuge, um aus diesem Erlebnis einen Lerneffekt zu machen. Das symbolisiert die rechte Waagschale. Was erlebt wurde, was sich auf der seelischen Leinwand eingedrückt hat, muss wieder zum Ausdruck gebracht werden. Daher sind die Reflexionsmethoden in der Erlebnispädagogik so wichtig. Und da es oft beeindruckende Erlebnisse gibt, brauchen wir auch kreative Methoden, um das Erlebte zum Ausdruck bringen zu können – da in diesem Zusammenhang, wie erwähnt, die Sprache oft versagt. Nach der Reflexion muss die Prüfung des Transfers erfolgen: Was habe ich gelernt, was kann ich in meinem Lebensalltag gebrauchen, was nehme ich mit in mein alltägliches Leben? Auch hier gilt: Werden nur Ereignisse angeboten, dann senkt sich die linke Waagschale, und wir befinden uns im breiten Feld der Freizeitpädagogik. Befassen wir uns hauptsächlich mit der Auswertung von Erlebnissen, senkt sich die Waagschale auf der rechten Seite, so haben wir es eher mit dem Bereich der Selbsterfahrung zu tun. Bei der Erlebnispädagogik befinden sich beide Waagschalen in einem Gleichgewicht.
Abb. 1: Waage der Erlebnispädagogik
Erstaunlich viele zentrale Begriffe in der Erlebnispädagogik beginnen mit dem Anfangsbuchstaben E – wie Erziehung. Daraus wurde in der ersten Auflage dieses Buches die sogenannte E-Kette entwickelt. Roland Abstreiter, Rafaela und Reinhard Zwerger (2017, 111 ff) haben sie um die Begriffe Erprobung und Entwicklung erweitert. Zudem ergänzten sie die E-Kette aus der Perspektive der Teilnehmer. Edmund Burke und weitere Philosophen der Aufklärung haben den Begriff der Erhabenheit geprägt, die Ehrfurcht, das Staunen, die Angst, die uns ergreift beim Anblick der wilden Natur. Die Mondnacht, der Sonnenauf- und Sonnenuntergang, der Wasserfall, die Waldlichtung und vor allem Berggipfel, Klüfte, Höhlen, Felswände: Erhabenheit beinhaltet Erlebnis und Erschauern (Becker 2018). Und es ist ein Gefühl, keine intellektuelle Leistung, das sich bis zur Ergriffenheit steigern kann (Jensen 1942). Erhabenheit, Ergriffenheit, Emotionen – zu den Wirkungen der Natur kommen die Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten des Erlebnispädagogen dazu. So entsteht ein komplexes Modell erlebnispädagogischen Handelns. Durch Isomorphien – bewussten Bezug zum beruflichen bzw. privaten Alltag der Teilnehmer – kann der erlebnispädagogische Prozess von Anfang an gesteuert werden. Entscheidet man sich dafür, die Ereignisse einfach wirken zu lassen – „Die Berge sprechen für sich selbst“ – dann hofft man darauf, dass die weiteren Phasen der E-Kette automatisch eintreten. Die Trainerin kann aber auch die pädagogischen Ziele schon vor jeder Aktion mitteilen (direktives Handlungslernen). Natürlich kann der Trainer seine Beobachtungen gleich bei der Beobachtung oder unmittelbar danach mitteilen (kommentiertes Handlungslernen) oder sich jegliches Feedback für den Zeitpunkt der Reflexion vornehmen. Zudem können Ereignisse auf direktem Weg zu einer Erfahrung führen. Wir sind dann nicht aktive Erlebende, sondern eher passiv Zuschauende, aber mit allen Sinnen beteiligt. Erfahrungen sind subjektiv. Erst wenn sie logisch durchdrungen werden, z. B. durch Reflexion oder Unterricht in Schule und Hochschule, entsteht daraus eine Erkenntnis. Nach der Zusammenfassung (Evaluation) der Ergebnisse geht es darum, das Gelernte in der eigenen beruflichen Praxis zu erproben. Erfolgreiches Handeln führt zur Entwicklung, auch Scheitern kann dies bewirken, wenn die Entmutigung nicht übermächtig wird. Nach dem Erfolg beginnt eine neue Lernschleife. Auch nach dem Scheitern und der Entmutigung sollte ein neuer Lernprozess eingeleitet werden. Hier sind die Erlebnispädagogen gefragt, die dafür die motivationale Grundlage schaffen müssen. Die Komplexität des Modells lässt sich noch weiterentwickeln, aber in dieser Einführung soll eine vereinfachte Abbildung genügen (Abb. 2).
Abb. 2: Die E-Kette
Der Satz des Schriftstellers Peter Handke gilt nicht nur für die Literatur, sondern auch für die Pädagogik, insbesondere für die Erlebnispädagogik: „Gute Literatur kommt aus dem Erleben der Dinge und der Gerechtigkeit diesem Erlebnis gegenüber“ – gute Pädagogik ebenfalls.
Eine ähnliche Alliterationskette ergibt sich mit dem Buchstaben B – wie Bildung (vgl. Guardini 1961, 23-43). Wir nennen es daher Bonsai-Modell (Abb. 3). Folgen wir den Ästen von links im Uhrzeigersinn. „Wir bewegen Menschen, damit sich bei ihnen etwas bewegt“, so warb GFE | erlebnistage vor einigen Jahren. Heckmair und Michl (2013, 5) haben vier Dimensionen des Begriffes Bewegung festgehalten:
„Da ist erstens die körperliche Bewegung, die im Handeln und Lernen neue Zugänge eröffnet, im positiven Sinne verstört und veränderte Perspektiven schafft. Zum Zweiten hat uns die moderne Hirnforschung gezeigt, dass in und mit der Bewegung hirnorganische Veränderungen ausgelöst werden, die Lernen prinzipiell begünstigen. Drittens steht Bewegung für bewegt sein im Sinne eines intensiven Erlebens, das, wie wir sehen werden, enorm wichtig ist für nachhaltiges Lernen. Und viertens ist damit intendiert, dass sich das Konstrukt Lernen selbst – also das, was Theoretiker und Praktiker unter dem Begriff Lernen begreifen – bewegt, verändert und weiterentwickelt.“
Alle Motivationsstudien zeigen, dass zum Lernen und Lehren Begeisterung gehört. Übergroße Begeisterung kann dazu führen, dass die Bedürfnisse der Teilnehmer nicht beachtet werden. Für jede Trainerin ist es wichtig, die Bedürfnisse der Teilnehmer zu kennen, z. B. das Bedürfnis nach Pause, nach Besprechung und Besinnung, nach Aktivität. Schließlich führt die Erlebnispädagogik die Teilnehmer in Situationen der Bewährung. Sie zieht die Bewährung der Belehrung vor, wenngleich es auch hier Belehrung geben muss, z. B. im Sicherheitsbereich. Die Erlebnispädagogik will auch berühren, emotional und körperlich, also berührt sein und berührt werden. Bei vielen Problemlösungsaufgaben und Spielen, im Niedrigseilgarten und bei der Höhlentour kommt man sich im Wortsinn und metaphorisch nahe. Wir begegnen Menschen ganz anders, lernen sie neu kennen, wir begegnen unbekannten Menschen, die uns helfen können oder Hindernisse und Herausforderungen sind. Und wir bauen Beziehungen auf, zum Trainer, zu anderen Teilnehmern, zur Natur. In ganz neuen Lebensräumen zu lernen, unabhängig von der Uhrzeit, kann befreiend wirken. Nach der Aktion folgt die Pause, die Müdigkeit, das Nachdenken, die Besinnung. Und immer wieder ist es notwendig, sich zu besprechen.
Abb. 3: „Bonsai“
Merksatz
Wir sprechen erst dann von Erlebnispädagogik, wenn nachhaltig versucht wird, die Erlebnisse durch Reflexion und Transfer pädagogisch nutzbar zu machen. Klettern, Schlauchbootfahren oder Segeln sind Natursportarten, die viel Freude und Sinn vermitteln. Sie bleiben aber lediglich eine Freizeitbeschäftigung, wenn sie um ihrer selbst willen durchgeführt werden.
Der Begriff „Erlebnispädagogik“. Es wäre ein Leichtes gewesen, zu Beginn der Theoriediskussion um 1990, Erlebnispädagogik zu definieren. Man hätte damals ohne Weiteres sagen können, dass Erlebnispädagogik durch Natursport etwas zur Persönlichkeitsbildung beitragen will. Heute, nachdem sich die erlebnispädagogische Bewegung in allen pädagogischen Praxisfeldern und mit einer zunehmenden Vielfalt von Methoden ausgebreitet hat, kann diese Definition die Bandbreite nicht mehr abdecken. Bernd Heckmair und ich haben in der achten Auflage des Buches „Erleben und Lernen. Einführung in die Erlebnispädagogik“ folgende Definition von Erlebnispädagogik formuliert (2018, 108):
Definition
„Das Konzept der Erlebnispädagogik will als Teildisziplin der Pädagogik junge Menschen durch exemplarische Lernprozesse und durch bewegtes Lernen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen – vornehmlich in der Natur – stellen, um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie zu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“.
Manche Autoren haben auf eine Definition verzichtet und versucht, Erlebnispädagogik durch folgende Eigenschaften zu beschreiben (vgl. dazu Schad / Michl 2004, 23):
■ Sie findet in der Regel unter freiem Himmel statt.
■ Sie verwendet häufig die Natur als Lernfeld.
■ Sie hat eine hohe physische Handlungskomponente.
■ Sie setzt auf direkte Handlungskonsequenzen der verwendeten Aktivitäten.
■ Sie arbeitet mit Herausforderungen und subjektiven Grenzerfahrungen.
■ Sie benutzt als Medien eine Mixtur von klassischen Natursportarten, speziellen künstlichen Anlagen sowie eine Palette von Vertrauensübungen und Problemlösungsaufgaben.
■ Die Gruppe ist ein wichtiger Katalysator der Veränderung.
■ Das Erlebte wird reflektiert: Was wurde gelernt und wie wirkt es sich auf den persönlichen und beruflichen Alltag aus? Auf die Reflexion folgt der Transfer in den persönlichen und / oder schulischen und / oder beruflichen Alltag.
Erst wenn alle oder die meisten dieser Kriterien erfüllt sind, kann man von Erlebnispädagogik sprechen.
Inzwischen hat sich dieses Verständnis von Erlebnispädagogik auch durchgesetzt. Wenngleich es nicht zufrieden stellt, weil es nicht das Ziel, sondern nur den Weg in den Mittelpunkt stellt, so ist es doch das Bestmögliche. Relativ unverfänglich, aber letztlich zu allgemein sind die Bezeichnungen „Erfahrungslernen“ oder „handlungsorientierte Methoden“. Das Gleiche meinen die amerikanischen Experten, wenn sie von „Experiential Education“ reden. Dieses erlebnis- und handlungsorientierte Lernen dringt auch in Schule und Hochschule vor, in der Erwachsenenbildung ist es nicht mehr wegzudenken. Action Learning, Open Space, Problemorientiertes Lernen, Projektlernen, Zukunftswerkstatt, Rollenspiel und Improvisationstheater sind einige Zauberwörter dieses Ansatzes.
Ein Abenteuer ist ein Ereignis mit offenem Ausgang und wenig planbaren Hindernissen. Soweit als irgendwie möglich muss in der Erlebnispädagogik aber alles planbar bleiben, daher führt der Begriff „Abenteuerpädagogik“ auf eine falsche Fährte. Wir wissen aus der Praxis, dass zu oft Unplanbares eintritt, aber das darf man dann als Restrisiko der Erlebnispädagogik bezeichnen. „Nature never gets boring“, schrieb der Ethnologe Melvin Konner, als er die San („Buschleute“) Südafrikas erforschte. Natur und Wildnis werden nie beherrschbar sein, daher verzichten wir auf Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Wer sich zum ersten Mal von einem hohen Felsen abseilt, verspürt sicherlich Herzklopfen, Unsicherheit, mitunter lebensbedrohliche Ängste. Unter der fachlichen Leitung eines erfahrenen (und zertifizierten) Erlebnispädagogen kann diese Aktion aber sicherer als eine Fahrradtour durch eine Großstadt sein.
„Aktionspädagogik“, ein Begriff, der gelegentlich in der Fachliteratur auftauchte, fokussiert auf „Action“, auf Thrill, Risiko, Sport, Überwindung, Survival. Davon ist die Erlebnispädagogik meilenweit entfernt. Blickt man die letzten zwei Jahrzehnte zurück, so kann man zusammenfassen, dass die Entdeckung der Langsamkeit, der Einsamkeit, des Schweigens und Fastens, der Dunkelheit und Nacht, der schöpferischen Pause, des gemeinsamen Schweigens in der Höhle oder am Berggipfel ein wesentlicher Aspekt dieser handlungsorientierten Methode war. Die Aktion ist nur das sichtbare, spektakuläre Moment. Sie gehört zwar zur pädagogischen Dramaturgie, ist aber nicht höher zu bewerten als diese stillen, ruhigen, beschaulichen, nachdenklichen Phasen.
Abb. 4: Vektorenmodell der Erlebnispädagogik (in Anlehnung an Ebner, www.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/fhooe/studieren/akademie-fuer-weiterbildung/erlebnispaedagogik/allgemein/docs/fhooe-ep-detailinfos.pdf)