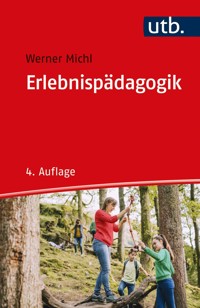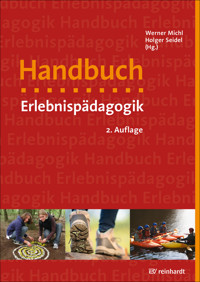
46,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Zielgruppenanalyse, Sicherheit, internationale Entwicklungen - das sind nur einige Aspekte, mit denen sich die Erlebnispädagogik in Theorie und Praxis auseinandersetzen muss. Sie ist mittlerweile eine fest verankerte Disziplin in der Pädagogik, zu der auch an Universitäten zunehmend geforscht wird. Das "Handbuch Erlebnispädagogik" bündelt Wissen, Forschungsergebnisse und Erfahrungen systematisch. Es werden sowohl theoretische Grundlagen als auch konkrete Handlungsfelder wie z. B. City Bound, Zirkuspädagogik oder schulische Erlebnispädagogik beschrieben. Das aktualisierte Standardwerk für die erlebnispädagogische Arbeit!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 880
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Werner Michl • Holger Seidel (Hg.)
Handbuch
Erlebnispädagogik
Mit 15 Abbildungen und 5 Tabellen
2., aktualisierte Auflage
Ernst Reinhardt Verlag München
Prof. Dr. Werner Michl lehrte Sozialwissenschaften an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und war Professor associé an der Universität Luxemburg.
Dipl. Soz. päd. Holger Seidel ist Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung der Erlebnispädagogik „erlebnistage“ sowie Vorsitzender des Reisenetz der Deutsche Fachverband für Jugendreisen.
Im Ernst Reinhardt Verlag ebenfalls erschienen:
Werner Michl: Erlebnispädagogik. (4., aktualisierte Auflage 2020; utb; ISBN: 978-3-8252-5334-9)
In der Reihe „erleben & lernen“:
Heckmair / Michl: Erleben und Lernen. ISBN: 978-3-497-02825-2
Schad / Michl (Hg.): Outdoor-Training. ISBN: 978-3-497-01689-1
Crowther: City Bound. ISBN: 978-3-497-01732-4
Dewald / Mayr / Umbach: Berge voller Abenteuer. ISBN: 978-3-497-01769-0
Einwanger (Hg.): Mut zum Risiko. ISBN: 978-3-497-01934-2
Muff / Engelhardt: Erlebnispädagogik und Spiritualität. ISBN: 978-3-497-02397-4
Bach / Bach: Erlebnispädagogik im Wald. ISBN: 978-3-497-03040-8
Fürst: Gruppe erleben. ISBN: 978-3-497-02094-2
Winter (Hg.): Spielen und Erleben mit digitalen Medien. ISBN: 978-3-497-02245-8
Simek / Sirch: Das Mountainbike erlebnispädagogisch einsetzen. ISBN: 978-3-497-02444-5
Streicher / Harder / Netzer (Hg.): Erlebnispädagogik in den Bergen. ISBN: 978-3-497-02558-9
Weber: Erlebnispädagogik in der Grundschule. ISBN: 978-3-497-02863-4
Schreyer: Outdoortraining für Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung. ISBN: 978-3-497-02676-0
Hildmann: simple things – einfach wirkungsvoll. ISBN: 978-3-497-02718-7
Kamer: Abenteuer planen? ISBN: 978-3-497-02723-1
Mauch / Scholz: Nur spielen! ISBN: 978-3-497-02772-9
Hinweis
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03087-3 (Print)
ISBN 978-3-497-61539-1 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61540-7 (EPUB)
2., aktualisierte Auflage
© 2021 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Cover unter Verwendung von Fotos von (von rechts nach links)
© istock.com / Nick Daly, © istock.com / RuslanDaschinsky, © Martina Schnepf, © istock.com / Olga_Danylenko, © ARochau / Fotolia, © Mediteraneo / Fotolia
Satz: ew print & medien service GmbH, Würzburg
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
1Einleitung
von Holger Seidel und Werner Michl
2 Erlebnispädagogik – Grundlagen
2.1 Hirnforschung und Konstruktivismus – zu den Grundlagen erlebnispädagogischen Lernens
von Bernd Heckmair
2.2 Erlebnis und Pädagogik
von Werner Michl und Holger Seidel
2.3 Zu theoretischer Konzeption und interdisziplinärem Kontext der Erlebnispädagogik
von F. Hartmut Paffrath
2.4 Erlebnispädagogische Interventionen
von Manfred Huber
2.5 Bildung und Kompetenzerwerb
von Wolfgang Wahl
2.6 Die Bedeutung von Emotionen im erlebnispädagogischen Lernkontext
von Stefan Markus, Barbara Jacob und Thomas Eberle
2.7 Reflexion – Nachdenken, Suchen und Erkennen in der Erlebnispädagogik
von Rüdiger Gilsdorf
2.8 Reflexion in der erlebnispädagogischen Praxis
von Jörg Friebe
2.9 Metaphorisches Lernen in der Erlebnispädagogik
von Martin Scholz
2.10 Die Bedeutung der Erlebnispädagogik in der Sozialen Arbeit
von Harald Michels
2.11 Adventure Based Counseling – das Abenteuerlabor
von Martin Lindner
2.12 Entwicklungen und Trends in der Erlebnispädagogik
von Werner Michl
2.12.1 Systemische Erlebnispädagogik
von Roland Abstreiter und Reinhard Zwerger
2.12.2 Inklusion in der Erlebnispädagogik
von Heike Tiemann
2.12.3 Mediengestützte Erlebnispädagogik: Geocaching, Medienrallyes und Alternate Reality Games
von Andrea Übler-Winter
2.12.4 Bildung für nachhaltige Entwicklung und Erlebnispädagogik
von Tobias Kamer
2.12.5 Erlebnispädagogik und Migration
von Thomas Eisinger
2.12.6 Gender und Diversity in der Erlebnispädagogik
von Barbara Grill
2.12.7 Zirkuspädagogik im Kontext der Erlebnispädagogik
von Angelika Martin
3 Historische Entwicklungslinien der Erlebnispädagogik
3.1 Entdeckung und Entfaltung des Erlebnisbegriffes in der Lebensphilosophie
von Robert Josef Kozljanič
3.2 Wegbereiter der Erlebnispädagogik von Rousseau bis zur Reformpädagogik
von F. Hartmut Paffrath
3.3 Erlebnispädagogische Ansätze und Initiativen in der Reformpädagogik (1890–1933)
von F. Hartmut Paffrath
3.4 Kurt Hahn: Erlebnispädagogik als „Erlebnistherapie“
von Michael Knoll
3.5 Was nach 1945 kam – Die Entwicklung zur modernen Erlebnispädagogik
von Rainald Baig-Schneider
4 Erlebnispädagogik im Kontext internationaler Entwicklungen
4.1 Internationale Entwicklungen der Erlebnispädagogik
von Alexandra Albert
4.2 Erlebnispädagogik in den USA
von Ulrich Dettweiler und Pete Allison
4.3 Erlebnispädagogik in Großbritannien
von Jule Hildmann und Pete Higgins
4.4 Friluftsliv – Kultur trifft Pädagogik
von Gunnar Liedtke
4.5 Erlebnispädagogik in den Niederlanden
von Willi Kisters
5 Nationale und internationale erlebnispädagogische Verbände
5.1 Outward Bound International
von Ulrich Dettweiler
5.2 Der Duke of Edinburgh’s International Award
von Klaus Vogel
5.3 AEE und EEE – Association for Experiential Education und Experiential Educators Europe
von Michael Rehm
5.4 Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e. V.
von Katja Rothmeier
5.5 European Ropes Course Association (ERCA) e. V. – der europäische Seilgartenverband
von Meik Haselbach
5.6 ERBINAT – Verband Erleben und Bildung in der Natur Schweiz
von Tobias Kamer
5.7 Die United World Colleges
von Werner Michl
6 Arbeitsfelder und Institutionen der Erlebnispädagogik
6.1 Kinder- und Jugendarbeit
von Manfred Huber
6.1.1 Jugendverbände
von Wolfgang Wahl
6.1.2 Jugendarbeit
von Henning Böhmer
6.1.3 Erlebnispädagogik in den „Hilfen zur Erziehung“
von Daniel Mastalerz
6.2 Freie Träger
von Sven Schuh
7 Erlebnispädagogische Handlungsfelder und Kontexte
7.1 Alpine Erlebnispädagogik
von Bernhard Streicher
7.2 Tour und Unterwegssein
von Torsten Flader
7.3 Naturwerkstatt – Landart
von Andreas Güthler
7.4 Visionssuche und Solo
von Michael Birnthaler und Sylke Iacone
7.5 Erlebnis Winter
von Hajo Netzer
7.6 Höhlentouren
von Andreas Bedacht
7.7 Mountainbiken
von Jochen Simek und Simon Sirch
7.8 Erlebnis Wasser
von Josef Birzele und Robert Wenzelewski
7.9 Segeln – ein Klassiker der Erlebnispädagogik
von Bastian Neuerer
7.10 Hochseilgärten
von Henning Böhmer
7.11 Temporäre Seilgärten
von Henning Böhmer
7.12 Lernprojekte
von Bernd Heckmair
7.13 City Bound
von Christina Crowther
7.14 Erlebnispädagogik und schulische Bildungsziele
von Kurt Daschner
7.15 Project Adventure – wie die Outward-Bound-Idee das schulische Lernen bereichert
von Annette Boeger
7.16 Spiritualität und religiöse Bildung
von Albin Muff und Horst Engelhardt
7.17 Kurt Hahns Dienste und Projekte am Beispiel des Diakonischen Lernens
von Martin Dorner
8 Erlebnisse in Prävention und Therapie
8.1 Erlebnispädagogik in präventiven Ansätzen
von Jens Schreyer
8.2 Erlebnispädagogik in therapeutischen Ansätzen
von Ulrich Lakemann
8.3 Wegbereiter der Erlebnistherapie: von Freud bis Schulze
von Werner Michl
9 Zielgruppen der Erlebnispädagogik
9.1 Erlebnispädagogik mit Kindern von 0 bis
von Tim Bürger
9.2 Erlebnispädagogik mit Kindern von 6 bis 12 Jahren
von Anke Schlehufer
9.3 Jugendliche
von Wolfgang Wahl
9.4 Auszubildende
von Katharina Heimrath und Jens Westhoff
9.5 Junge Menschen mit Behinderung
von Anke Hinrichs
9.6 Führungskräfte und Teams
von Jörg Friebe
9.7 Studierende
von Martin Scholz
9.8 Jugendliche und Erwachsene im Breiten- und Leistungssport
von Alexandra Albert
10 Erlebnispädagogik als Forschungsfeld
10.1 Ergebnis- und Prozessforschung in der Erlebnispädagogik
von Hans-Peter Heekerens
10.2 Förderung des Selbstkonzepts durch erlebnispädagogische Lernsettings
von Thomas Eberle und Janne Fengler
10.3 Förderung von Selbstwirksamkeitserwartungen durch Erlebnispädagogik
von Stefan Markus, Thomas Eberle und Janne Fengler
11 Sicherheit, Standards und Qualität in der Erlebnispädagogik
11.1 Zero Accident in der Erlebnispädagogik
von Walter Siebert
11.2 Risiko und Erlebnispädagogik
von Jürgen Einwanger
11.3 Sicherheit in der Erlebnispädagogik
von Michael Herrmann
11.4 Qualitätsentwicklung und Zertifizierung in der Erlebnispädagogik
von Katja Rothmeier
11.5 Natur- und Umweltschutz – rechtliche Grundlagen und Handlungskonsequenzen
von Alexandra Albert
12 Von der Berufung zum Beruf – erlebnispädagogische Aus- und Weiterbildung
12.1 Berufsbild Erlebnispädagoge /Erlebnispädagogin
von Holger Seidel
12.2 Erlebnispädagogische Ausbildung an Hochschulen
von Martin Scholz
12.3 Erlebnispädagogische Ausbildung in der Praxis
von Anja Helfrich
Autorinnen und Autoren
Sachregister
1 Einleitung
von Holger Seidel und Werner Michl
Wer die Praxis der Erlebnispädagogik seit den 1980er Jahren beobachtet hat, konnte sehen, dass es immer wieder Moden gab: Natursport, City Bound, Wildnistherapie und Naturerlebnispädagogik, Visionssuche, Spiritualität und Religion, große und kleine Seilgärten, Landart, konstruktive Lernprojekte und kooperative Abenteuerspiele, Labyrinthe, Geocaching, Zirkuspädagogik. Zudem sind fast alle Praxisfelder der Erlebnispädagogik in hervorragenden Publikationen dokumentiert (z. B.: Bach / Bach 2016, Bedacht 2004, Birzele / Hofmann 2003, Candolini 2008, Crowther 2005, Deubzer / Feige 2004, Güthler / Lacher 2005, Kappl / Bertle 2008, Koch-Weser, von Lüpke 2015, Kraus / Schwiersch 1996, Muff / Engelhardt 2013, Simek / Sirch 2014, Streicher et al. 2015). Damit sind aber die praktischen Potenziale der Erlebnispädagogik noch längst nicht ausgeschöpft.
Heute gibt es einen stets wachsenden Kreis von HochschullehrerInnen, SoziologInnen, PsychologInnen, PädagogInnen und SozialpädagogInnen, der durch qualitative und quantitative Untersuchungen, durch empirische Forschung und hermeneutische Analysen die Praxis begleitet, sie bestärkt, ihr ein Fundament verleiht.
Nach 22 Jahren, 1988 bis 2010, wurde die „Zeitschrift für Erlebnispädagogik“ (Lüneburg: edition erlebnispädagogik) in die Zeitschrift „e&l – erleben und lernen“ (Augsburg: ZIEL) aufgenommen, die nun seit 1993 besteht. Vor allem zwei Verlage sorgen dafür, dass Erfahrungen, Erkenntnisse und Ergebnisse in Praxis und Theorie festgehalten werden konnten und können: der Augsburger ZIEL Verlag mit der gelben Reihe „Praktische Erlebnispädagogik“ und der Münchner Ernst Reinhardt Verlag mit der Buchreihe „erleben und lernen“.
Es ist an der Zeit, das Wissen zu bündeln. Dies ist die Aufgabe dieses Handbuchs. Und trotzdem ist das vorliegende Buch begrenzt in der Auswahl der Themen und auch durch die Perspektiven, die es einnimmt. Primär geht es dabei nicht um tiefe oder prägende Erlebnisse, sondern schlicht um die Ziele jeder pädagogischen Praxis: Lernen, Erziehung, Bildung, Training, Therapie, Betreuung, Begleitung.
Blickt man auf die jüngere Geschichte der Erlebnispädagogik, so kann man einige treibende Kräfte ausmachen. Vor allem zwei Persönlichkeiten und ein Träger standen am Beginn der modernen Erlebnispädagogik: Michael Jagenlauf, Jörg Ziegenspeck und Outward Bound Deutschland. Michael Jagenlauf hat mit seiner „Wirkungsanalyse Outward Bound“ (Jagenlauf 1992) die erste, sehr umfangreiche empirische Studie zur Erlebnispädagogik vorgelegt. Seine Mitgliedschaft bei Outward Bound Deutschland, die Gründung von GFE | erlebnistage, der Zeitschrift „e&l – erleben und lernen“ und der Schriftenreihe „erleben und lernen“ waren wichtige Meilensteine. Jörg Ziegenspeck hat durch den Verlag Klaus Neubauer, später edition erlebnispädagogik, vielen ErlebnispädagogInnen eine Publikationsmöglichkeit eröffnet. Seine Schriftenreihe „Wegbereiter der Erlebnispädagogik“, das Institut für Erlebnispädagogik an der Universität Lüneburg und seine eigenen Publikationen haben einen wesentlichen Beitrag zur Erlebnispädagogik geleistet. Outward Bound Deutschland war mit vier Standorten lange Zeit unbestritten der führende Anbieter erlebnispädagogischer Programme in Deutschland. Gustav Harder, Bernd Heckmair, Hubert Kölsch, Walter Pretzl und Franz-Josef Wagner waren Führungspersönlichkeiten bei Outward Bound Deutschland und haben die erlebnispädagogische Szene durch zahlreiche Publikationen geprägt. Aus dem 1987 gegründeten „Bundesverband Segeln - Pädagogik - Therapie“ entwickelte sich 1992 der „Bundesverband Erlebnispädagogik e.V.“ (www.bundesverband-erlebnispädagogik.de). Etwa seit 1990 begann die Szene, sich auszudifferenzieren. Spannende und verrückte Projekte in der Heimerziehung ließen aufhorchen, mehrere Träger wurden von engagierten PädagogInnen gegründet und manche ExpertInnen trafen sich zum regelmäßigen Austausch wie z. B. im „Forum Erlebnispädagogik“ in Bayern (Bedacht / Michl 2014).
Mit dem Titel „Erlebnispädagogik: Mode, Methode oder mehr?“ (Bedacht et al. 1992) begann die Ära der Tagungen und Kongresse. Im Zeitraum von 1992 bis 2007 bot der bsj Marburg im Verbund mit der Universität Marburg in unregelmäßigen Abständen die Fachtagung „Abenteuer – ein Weg zur Jugend“ an unterschiedlichen Orten in Deutschland an. Vier Tagungsdokumentationen liegen vor, die über den Verein bsj Marburg zu beziehen sind. Seit 1997 findet in zweijährigem Abstand an der Universität Augsburg der Internationale Kongress „erleben und lernen“ statt. Etwa zehn Kongressbände liegen vor. Diese Tagungen und Kongresse haben die ExpertInnen aus Praxis und Theorie zusammengeschweißt, sie haben aktuelle Entwicklungen und Innovationen der Praxis dokumentiert und sie haben die Erlebnispädagogik als Disziplin etabliert. Neben Lüneburg und Marburg ist Augsburg durch den Kongress, den ZIEL Verlag, das Hochschulforum Erlebnispädagogik und die Universität Augsburg mit Helmut Altenberger, Hartmut F. Paffrath, Peter Schettgen und Martin Scholz zu einem weiteren Zentrum der Erlebnispädagogik in Deutschland geworden.
Zu guter Letzt noch ein Hinweis: In manchen Beiträgen werden männliche und weibliche Sprachformen verwendet, in anderen Beiträgen wird zu Gunsten der besseren Lesbarkeit nur im Plural das Binnen-I, sonst das generische Maskulinum verwendet. Natürlich sind aber in jedem Fall alle Personen mitgedacht und gemeint.
Wir haben bei der Konzeption dieses Handbuchs versucht, die wichtigsten Themengebiete der Erlebnispädagogik zu definieren und haben ausgewählte ExpertInnen darum gebeten, in ihren Beiträgen den aktuellen Wissensstand abzubilden. Ein herzlicher Dank geht an alle Autorinnen und Autoren! Zudem sind wir unserem kleinen, aber feinen Beraterstab sehr dankbar, der uns bei der Themenentwicklung zur Seite stand: Bernd Heckmair, Manfred Huber, Tony Jäger, Jens Schreyer, Wolfgang Wahl, Hartmut Winter und Reinhard Zwerger. Und schließlich darf Ulrike Hauswaldt nicht vergessen werden, die alle Texte mit kritischem Blick nach orthografischen Fehlern und stilistischen Schwächen durchgesehen hat. Vielen Dank dafür!
Berg und Braunschweig, im Januar 2018,
Werner Michl und Holger Seidel
Literatur
Bach, H., Bach, T. (2016): Erlebnispädagogik im Wald. Arbeitsbuch für die Praxis. 3., durchges. Aufl. Ernst Reinhardt, München / Basel
Bedacht, A. (Hrsg.) (2004): Fahrt in die Tiefe. Ein Handbuch für Höhlenbefahrungen. ZIEL, Augsburg
Bedacht, A., Dewald, W., Heckmair, B., Michl, W., Weis, K. (Hrsg.) (1992): Erlebnispädagogik: Mode, Methode oder mehr? FH München, FB Sozialwesen, München
Bedacht, A., Michl, W. (2014): Fans, Freaks, Fachhochschule – das Forum Erlebnispädagogik in der Retrospektive. In: e&l – erleben und lernen. 5, 20–21
Birzele, K., Hoffmann, O. I. (2003): Mit allen Wassern gewaschen. Praxishandbuch für erlebnispädagogisches Handeln im und am Wasser. ZIEL, Augsburg
Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e. V. (2017): www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de, 24.04. 2017
Candolini, G. (2008): Labyrinth. Mythos und Geschichte eines Menschheitssymbols. Pattloch, Augsburg
Crowther, C. (2005): City Bound. Erlebnispädagogische Aktivitäten in der Stadt. Ernst Reinhardt, München / Basel
Deubzer, B., Feige, K. (Hrsg.) (2004): Praxishandbuch City Bound. ZIEL, Augsburg
Güthler, A., Lacher, K. (2005): Naturwerkstatt Landart. Ideen für kleine und große Naturkünstler. AT Verlag, Baden / München
Jagenlauf, M. (1992): Wirkungsanalyse Outward Bound – ein empirischer Beitrag zur Wirklichkeit und Wirksamkeit der erlebnispädagogischen Kursangebote von Outward Bound Deutschland. In: Bedacht, A. et al. (Hrsg.), 72–95
Kappl, M., Bertle, L. (2008): Erlebnis Winter. Bausteine für alternative Winterfreizeiten. 2. überarb. Aufl. ZIEL, Augsburg
Koch-Weser, S., Lüpke, G. von (2015): Vision Quest. Visionssuche. Allein in der Wildnis auf dem Weg zu sich selbst. Drachen Verlag, Klein Jasedow
Kraus, L., Schwiersch, M. (1996): Die Sprache der Berge. Handbuch der alpinen Erlebnispädagogik. Sandmann, Alling
Muff, A., Engelhardt, H. (2013): Erlebnispädagogik und Spiritualität. 44 Anregungen für die Gruppenarbeit. 2., überarb. u. erw. Aufl. Ernst Reinhardt, München / Basel
Simek, J., Sirch, S. (2014): Das Mountainbike erlebnispädagogisch einsetzen – Grundlagen und Praxis. Ernst Reinhardt, München / Basel
Streicher, B., Harder, H., Netzer, H. (Hrsg.) (2015): Erlebnispädagogik in den Bergen: Grundlagen, Aktivitäten, Ausrüstung und Sicherheit. Ernst Reinhardt, München /Basel
2 Erlebnispädagogik – Grundlagen
2.1Hirnforschung und Konstruktivismus – zu den Grundlagen erlebnispädagogischen Lernens
von Bernd Heckmair
Häufig werden die Erkenntnisse der pädagogischen Psychologie, der Erziehungswissenschaft oder spezieller, der Bildungsforschung herangezogen, wenn es um Begründungen, Herleitungen und Prämissen erlebnispädagogischen Lernens geht. Aus gutem Grund wird hier aber der Blick in zwei andere Richtungen gelenkt: In den Neurowissenschaften wurde etwa seit Beginn der 1990er Jahre eine Fülle von Einzelstudien publiziert, welche für die Erlebnispädagogik mehr als für jede andere Einzeldisziplin und Methode im Bereich von Erziehung und Bildung Relevanz besitzen. Die handlungs- und erfahrungsorientierte Erlebnispädagogik ist außerdem geradezu prädestiniert für ein konstruktivistisches Lernverständnis (Heckmair / Michl 2013, 39 f.) – viel mehr als für das in Erziehung und Bildung üblicherweise vorherrschende instruktionistische Paradigma. Im Folgenden werden daher die für das erlebnispädagogische Lernen wichtigsten Erkenntnisse der neueren Hirnforschung vorgestellt und mit den Eckpunkten einer konstruktivistischen Bildungstheorie verknüpft.
Die Entdeckung der Emotionen
Ironischerweise war es ein Psychologe, der die Neurowissenschaften beim Thema Intelligenz und Lernen seiner eigenen Disziplin vorzog: Daniel Goleman (1996) berief sich in seinem Buch „Emotionale Intelligenz“ auf die Macht der Gefühle, argumentierte mit Erkenntnissen der Hirnforschung und sorgte damit für eine zweite „kognitive Wende“. Es waren dann die Studien von Antonio Damasio, die Golemans etwas populistischen Ansatz wissenschaftlich unterfütterten. Emotionen sind für Damasio „komplexe, größtenteils automatisch ablaufende, von der Evolution gestaltete Programme für Handlungen“, während Gefühle „Wahrnehmungen dessen [sind], was in unserem Körper und Geist abläuft, wenn wir Emotionen haben“ (Damasio 2011, 122). Für ihn ist „vernünftiges Denken ohne den Einfluß der Emotionen nicht möglich“ (Damasio 2000, 57). Sein Fachkollege Joseph LeDoux spricht gar von einer „feindlichen Übernahme des Bewusstseins durch die Emotion“ (LeDoux 2006, 299), während Gerhard Roth, einer der führenden deutschen Hirnforscher, die Dominanz der Gefühle über den Verstand so kommentiert: „Das ist auch gut so, denn unsere konditionierten Gefühle sind ja nichts anderes als ‚konzentrierte Lebenserfahrung‘“ (Roth 2001, 321).
Informationen werden emotional eingefärbt
Im tradierten Lernverständnis, etwa in der instruktionistisch dominierten Schulpädagogik, werden Emotionen entweder ignoriert oder als Störfaktoren identifiziert. Die Hirnforschung hat sie nun rehabilitiert und schreibt ihnen eine herausragende Bedeutung bei Lernprozessen zu. Der Ulmer Psychiater und Klinikleiter Manfred Spitzer bringt das folgendermaßen auf den Punkt: „Was uns Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen“ (Spitzer 2002, 160). Wenn sich die Erlebnispädagogik bewusst auf emotional aufgeladene Situationen stützt, begünstigt sie also nachhaltiges Lernen.
Damasio verknüpft in seinem Konzept die emotionalen und die vernunftgeleiteten Anteile bei der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung des Gehirns: Jedes sensorisch eingehende Wahrnehmungsbündel wird markiert, das heißt mit einer positiven oder negativen Bewertung versehen und entsprechend abgespeichert. Dergestalt entsteht ein „Tendenzapparat“ (Damasio 1999, 239), der Verhaltens- und Handlungsanleitungen vorbereitet. Dies geschieht unbewusst. Hier einen Zugang zu finden, ist langwierig und mühselig. Chancen dafür bieten vor allem die Selbstreflexion und das Feedback durch andere Menschen – sowohl in Alltagssituationen von Schule, Beruf und Freizeit als auch im Besonderen in der Nachbearbeitung erlebnispädagogischer Aktionen.
Emotionen fokussieren die Aufmerksamkeit, steigern Motivation und Gedächtnisleistung und aktivieren unser Belohnungssystem. Wenn etwas für uns neu ist, wenn etwas besser gelingt als erwartet, wenn wir eine Herausforderung erfolgreich bewältigen, werden körpereigene Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter ausgeschüttet und in dessen Folge Opioide freigesetzt. Sie motivieren uns, münden bestenfalls in einen „Flow“ (Csikszentmihalyi 2008).
Körper und Bewegung
Dass durch Bewegung neue Nervenzellen im Gehirn generiert werden, wurde durch Zufall entdeckt. Der kanadische Psychologe Donald Hebb nahm 1945 ein paar Laborratten mit nach Hause. Nach ihrer Rückkehr ins Labor schnitten diese bei Lerntests besser ab als ihre in den Käfigen verbliebenen Artgenossen (Hebb 1947, 306). Hebb folgerte, dass die anregende Umgebung und das Spiel die Ursache dafür waren. Ein paar Jahrzehnte später konnte man nachweisen, dass sich durch Bewegung die Gehirne von Tieren vergrößern, dass zusätzliche Synapsen, also Verbindungen zwischen den Nervenzellen entstehen und dass sich die Leistungsfähigkeit der Tiere erhöht. Im Spiel werden bei Rudeltieren die sozialen Bindungen stabilisiert. Am Massachusetts Institute of Technology setzte man zwei Katzen in ein Karussell. Die eine konnte das Karussell in Bewegung bringen und damit steuern; die andere verblieb nur passiv im Karussell. Ein anschließender Test ergab, dass nur das aktive Tier gelernt hatte. Wolf Singer folgert daraus: „Nur-Zuschauen genügt also nicht. Selbermachen ist entscheidend“ (Singer 2002, 50).
Ausdauertraining fürs Gehirn
John Ratey untersuchte als einer der ersten Forscher, inwieweit körperliche Bewegung auf das Gehirn von Menschen positive Wirkungen erzielt. Er berichtet von einem Schulprojekt in Illinois. Dort startete man jeden Schultag mit einer Stunde Ausdauersport. Die SchülerInnen trugen beim Fußball, Basketball und beim Laufen Pulsuhren und konnten damit ihre Herzfrequenz kontrollieren. Dass die SchülerInnen dadurch fitter wurden und sich der Anteil an übergewichtigen SchülerInnen reduzierte, konnte man erwarten. Erstaunen rief indessen ein internationaler Leistungstest hervor, in dem die SchülerInnen aus Illinois hervorragend abschnitten. Für Ratey und sein Forscherteam war der Zusammenhang von Fitness und mentalem Leistungsvermögen eindeutig (Ratey 2009, 23 f.). Das Ulmer „Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen“ konnte ebenfalls nachweisen, dass „körperliche Fitness in einem positiven Zusammenhang mit exekutiven Funktionen steht“ (Beck 2014, 29 f.), wobei bedenklich stimmen müsste, dass sich SchülerInnen in einer konventionellen Sportstunde höchstens acht bis zwölf Minuten bewegen (Korte 2010, 298).
Man weiß inzwischen, dass bei körperlicher Aktivität die Botenstoffe Dopamin und Serotonin ausgeschüttet werden. Damit erzielt man eine „sehr stark antidepressive Wirkung“ und dämpft psychischen und emotionalen Stress (Linden 2012, 181). Außerdem werden Opioide sowie Endocannabinoide freigesetzt, was das körpereigene Belohnungssystem stimuliert (Linden 2012, 184) und zur Beschleunigung von Lernprozessen führt.
Angesichts dieser Ergebnisse fragt man sich, warum die meisten traditionellen Erziehungs- und Bildungskonzepte das Thema Körper und Bewegung weitgehend ausklammern. In der Schule werden vorwiegend die „MINT-Fächer“ Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ausgebaut, während man den Sportunterricht als sekundär erachtet. Dabei geht es um viel mehr als körperliches Wohlbefinden, es geht auch und vor allem um die Entwicklung des Gehirns.
Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen
Wie unmittelbar sich soziale Isolation auf die Entwicklung von Primaten auswirkt, zeigen frühe Studien an Affen. An der Universität in Wisconsin wurden Rhesusaffen in Einzelkäfigen aufgezogen, um Infektionen zu minimieren. Die Folge war, dass die jungen Affen, die nicht im Familienverbund aufwuchsen, wie wild an ihren Daumen saugten und manisch hin und her wippten. Als man sie später miteinander in Kontakt brachte, schlugen und verletzten sie sich gegenseitig (Harlow 1961). Als um 1900 in Pariser Krankenhäusern Röteln ausbrachen, wurden die Schwestern angewiesen, Körperkontakt zu Säuglingen auf das Nötigste zu beschränken. In der Folge schoss die Sterberate in die Höhe. Die Ursache war nicht etwa die Kinderkrankheit, sondern der Mangel an Zuwendung (Spitz 1945).
In den Waisenhäusern des rumänischen Ceaușescu-Regimes erhielten die Kinder weder Zuwendung noch erfuhren sie Körperkontakt. Als sie 1989 befreit wurden, fand man sie als antriebslose Wesen, die apathisch an den Gitterstäben der Bettgestelle hin und her wippten (Lehrer 2009, 247 f.). Fazit: (Nicht nur) Kinder brauchen Nähe!
Darwins „Theorie der natürlichen Auslese“ wird landläufig als untereinander geführter Vernichtungskampf missverstanden; dabei hat Darwin die Prinzipien Kooperation und Altruismus immer schon mitgedacht (Bauer 2008, 15 f.). Der Mensch ist zu allererst ein Gemeinschaftswesen. Kooperation ist der Normalfall und nicht die Ausnahme. Das Belohnungssystem springt bereits an, wenn sich die Blicke lächelnder Gesichter begegnen oder „nette Worte“ ausgetauscht werden. Mit Hilfe von bildgebenden Verfahren konnte das nachgewiesen werden (Spitzer 2006, 190 f.). Kooperation ist für den Menschen nicht nur bedeutsam, sie ist vielmehr notwendig. Insofern müsste kooperatives Handeln auch das Herzstück des Lernens bilden.
„Menschliches Lernen vollzieht sich immer schon in der Gemeinschaft, und gemeinschaftliche Aktivitäten bzw. gemeinschaftliches Handeln ist wahrscheinlich der bedeutsamste ‚Verstärker’ [des Lernens]“ (Spitzer 2003, 209).
Emotion, Bewegung und Gemeinschaft bilden also die Eckpfeiler einer handlungs- und erfahrungsbezogenen Pädagogik. Entsprechend bietet sich ein Lernverständnis an, dessen Schlüsselbegriffe Instruktion und Konstruktion sind.
Was sind die Grundaussagen des Konstruktivismus?
Das zentrale Theorem des Konstruktivismus lautet: Das, was wir Realität nennen, ist uns weder sensorisch noch kognitiv zugänglich. Was wir wahrnehmen, konstruieren wir mit unserem Gehirn. Wir werden nicht etwa von unserer Umwelt determiniert, sondern allenfalls „gestört“ und angeregt.
Als Klassiker der Denkschule gelten die Werke der Neurowissenschaftler Huberto Maturana und Francisco Varela. Unter dem Schlüsselbegriff „Autopoiesis“ beschreiben sie lebende Systeme, zum Beispiel Zellverbunde, die sich autonom organisieren und damit überleben können. Pflanzen und Tiere erzeugen sich selbst, agieren autonom und sind streng genommen nicht direkt von außen beeinflussbar. Unser Gehirn ist aus dieser Perspektive betrachtet ein autopoietisches System, das unsere Wirklichkeit konstruiert. Dabei ist der Prozess der Erkenntnis mit dem Handeln verknüpft. Im Erkennen und Handeln schafft sich der Mensch seine Welt: individuell, vorläufig, vielleicht fehlerhaft und immer radikal subjektiv (Maturana / Varela 2009).
Ernst von Glasersfeld entwickelte im Anschluss an Maturana und Varela eine Wissenstheorie, die mit überkommenen Vorstellungen von „Wissensvermittlung“ bricht: „Wissen wird nicht passiv aufgenommen“, sondern „aktiv aufgebaut“ (Glasersfeld 1997, 96). „Kognition dient der Organisation der Erfahrungswelt des Subjekts und nicht der ‚Erkenntnis’ einer objektiven ontologischen Realität“ (Glasersfeld 1997, 96).
Heinz von Foerster, neben von Glasersfeld der wohl wichtigste Protagonist dieser neueren Strömung innerhalb der Philosophie, kritisiert die Vorstellung, dass das erkennende Bewusstsein die Welt adäquat erfassen und abbilden kann. Das kann man heute als das Postulat einer modernen handlungs- und erfahrungsorientierten Pädagogik lesen. Was allerdings gänzlich fehlt, ist die emotionale und soziale Komponente (Arnold / Siebert 1997, 105).
Seit den 1980er Jahren geistern konstruktivistische Positionen durch Randbereiche der Theoriebildung um Erziehung und Bildung. Sie stehen bis heute als scharfe Gegenposition zum allgemein verbreiteten instruktionistischen Paradigma, das da lautet: „Gelernt wird, was gelehrt wird“ (Arnold / Siebert 1997, 5). Im Bildungsdiskurs besetzt der Konstruktivismus eine Außenseiterposition. Denn die institutionelle Pädagogik in Schule, Erwachsenenbildung und Sozialer Arbeit wurde durch ihn nie ernsthaft gestört oder gar überformt. In Bereichen abseits des pädagogischen Mainstreams wie beispielsweise in der Erlebnispädagogik konnten sich dagegen konstruktivistische Positionen nachhaltig etablieren und – wenn auch nicht breitflächig und durchgängig – Praxisrelevanz erreichen.
Vom Konstruktivismus zur Kommunikationspsychologie
Die von Arnold und Siebert vermisste emotionale und soziale Komponente findet man beim US-amerikanischen Psychologen Kenneth Gergen. Er postuliert die „soziale Eingebundenheit allen Wissens und aller Erfahrung“ (Gergen 2010, zit. nach Siebert 2008, 54), wobei die Sprache als ein Werkzeug zur Konstruktion von Wirklichkeit dient. Über die Beziehung zu anderen Menschen, den Austausch im Einvernehmen, aber auch in der Differenz entstehen Wirklichkeitskonstruktionen. Dieser „soziale Konstruktivismus“ korrespondiert mit dem systemischen Kommunikationsmodell Paul Watzlawicks, das später insbesondere von Ruth Cohn und Friedemann Schulz von Thun verfeinert und weiterentwickelt wurde. Die Interaktion zwischen Personen und Gruppen ist konstitutiv für die Gestaltung von Welt. Kommunikation changiert zwischen Fremd- und Selbstbeobachtung, konstruiert und destruiert Beziehungen. Statt Kausalität regieren wechselseitige Einflussnahmen. Schulz von Thuns Modell „Vier Seiten einer Nachricht“ erklärt pragmatisch-konkret die Genese von Konflikten zwischen Menschen und wird in den Feldern Erziehung und Bildung als Analyseinstrument genutzt (Schulz von Thun 2014). Die rationale „Sachebene“ wird mit der „Selbstkundgabe“, der „Beziehungsebene“ und dem „Appell“ in ihrer Bedeutung relativiert. Lernen ist also demzufolge keine individuelle Informationsaufnahme, sondern eine biologisch angepasste, soziokulturell eingebundene sowie emotional und auf Handeln geprägte „Wissenskonstruktion“ (Arnold 2007, 65).
Prinzipien einer konstruktivistischen Bildung
Wenn man den Sozialen Konstruktivismus mit der Kommunikationspsychologie von Watzlawick, Cohn und Schulz von Thun verknüpft, kann man – abstrakt gesprochen – Lernen als systemische Selbstregulation bezeichnen. Was das für die Entwicklung einer konstruktivistischen Bildungstheorie bedeutet, hat Horst Siebert (2008) in seinem Buch „Konstruktivistisch lehren und lernen“ in sieben Prinzipien vorgeführt (nach Siebert 2008, 197 f.):
1. Individualität: In eine individualisierte und pluralisierte Gesellschaft würde ein einheitlicher Bildungskanon nicht passen.
2. Biografieorientierung: „Normalbiografien“ lösen sich auf. Insofern ist die Konstruktion der eigenen Biografie eine permanente Bildungsaufgabe.
3. Konstruktivität: Unser Weltverständnis ist beobachtungsabhängig. Insofern sind andere Beobachtungsperspektiven ebenso berechtigt wie die eigene.
4. Offenheit: Bildung ist ein offener Prozess, der durch Neugier und Interesse befördert wird und Fehlversuche beinhaltet.
5. Kontingenz: Mehrdeutigkeit kennzeichnet menschliche Beziehungen: Es sind immer mehrere Standpunkte, Deutungen und Unterscheidungen möglich.
6. Prozesshaftigkeit: Wirklichkeiten werden ständig neu konstruiert. Sie entstehen und vergehen in einem dynamischen Verlauf.
7. Ironie: Alles könnte auch anders gemeint sein. Eine heitere Doppeldeutigkeit lässt Gesagtes so oder anders erscheinen und schließt Ungesagtes mit ein.
Nimmt man die Prinzipien einer konstruktivistischen Bildungstheorie als Leitplanken einer handlungs- und erfahrungsbezogenen Pädagogik und füllt sie inhaltlich-substantiell mit den Kategorien Emotion, Körper und Gemeinschaft, dann lässt sich gut nachvollziehen, dass systemisch-konstruktivistische Erziehungswissenschaftler fast zwangsläufig auf die Erlebnispädagogik stoßen (etwa Herrmann 2006, 121, Arnold 2007, 95).
Literatur
Arnold, R. (2007): Ich lerne, also bin ich. Eine systemisch-konstruktivistische Didaktik. Carl Auer, Heidelberg
Arnold, R., Siebert, H. (1997): Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Von der Deutung zur Konstruktion von Wirklichkeit. 2. Aufl. Schneider, Baltmannsweiler
Bauer, J. (2008): Das kooperative Gen. Abschied vom Darwinismus. Hoffmann und Campe, Hamburg
Beck, F. (2014): Sport macht schlau. Mit Hirnforschung zu geistiger Höchstleistung. Goldegg, Berlin
Csikszentmihalyi, M. (2008): Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen. 5. Aufl. Klett-Cotta, Stuttgart
Damasio, A. D. (2011): Selbst ist der Mensch. Körper, Geist und die Entstehung des menschlichen Bewusstseins. Siedler, München
Damasio, A. D. (2000): Ich fühle also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. Ullstein, München
Damasio, A. D. (1999): Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. 4. Aufl. List, München
Glasersfeld, E. von (1997): Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Suhrkamp, Frankfurt / M.
Goleman, D. (1996): Emotionale Intelligenz. dtv, München
Harlow, H. (1961): The Development of Affectional Patterns in Infant Monkeys. In: Foss, B. M. (Ed.): Determinants of Infant Behaviour. Methuen, London
Hebb, D. O. (1947): The Effects of Early Experience on Problem-Solving at Maturity. American Psychologist 2
Heckmair, B., Michl, W. (2013): Von der Hand zum Hirn und zurück. Bewegtes Lernen im Fokus der Hirnforschung. ZIEL, Augsburg
Herrmann, U. (Hrsg.) (2006): Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. Beltz, Weinheim
Korte, M. (2010): Wie Kinder heute lernen. Was die Wissenschaft über das kindliche Gehirn weiß. 2. Aufl. DVA, München
Lehrer, J. (2009): Wie wir entscheiden. Das erfolgreiche Zusammenspiel von Kopf und Bauch. Piper, München
LeDoux, J. (2006): Das Netz der Persönlichkeit. Wie unser Selbst entsteht. dtv, München
Linden, D. J. (2012): High. Woher die guten Gefühle kommen. Beck, München
Maturana, H., Vaela, F. J. (2009): Der Baum der Erkenntnis: die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt / M.
Ratey, J. J. (2009): Superfaktor Bewegung. VAK, Kirchzarten
Roth, G. (2001): Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Suhrkamp, Frankfurt / M.
Schulz von Thun, F. (2014): Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation. rororo, Reinbek
Siebert, H. (2008): Konstruktivistisch lehren und lernen. ZIEL, Augsburg
Singer, W. (2002): Der Beobachter im Gehirn. Suhrkamp, Frankfurt a. M.
Spitz, R. (1945): Hospitalism: An Inquiry into the Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood. Psychoanalytic Study of the Child 1
Spitzer, M. (2006): Medizin für die Schule. In: Caspary, R. (Hrsg.): Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik. Herder, Freiburg
Spitzer, M. (2003): Nervensachen. Geschichten vom Gehirn. Schattauer, Stuttgart
Spitzer, M. (2002): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Springer Spektrum, Heidelberg
2.2Erlebnis und Pädagogik
von Werner Michl und Holger Seidel
Franz Kafka schreibt in seinem „Brief an den Vater“ (Kafka 1995, 48):
„[…] was mich packt, muss dich noch kaum berühren und umgekehrt, was bei dir Unschuld ist, kann bei mir Schuld sein, und umgekehrt, was bei dir folgenlos bleibt, kann mein Sargdeckel sein.“
Die Aussage zeigt, dass Erleben eine sehr subjektive Kategorie ist. Erleben ist etwas ganz Persönliches und es lässt sich nur genauer beschreiben, indem man in sich geht, also reflektiert, und sich darüber mit anderen Menschen austauscht. Erleben und Erziehen ist entsprechend eine schwierige Verbindung, der wir uns im Folgenden annähern wollen.
Erlebnis und Pädagogik – eine Annäherung
Dazu dient die erlebnispädagogische Spirale aus den drei Tätigkeiten Erleben, Erinnern, Erzählen. Reines Erleben ist Aktionismus, reines Erinnern ist ein Gefängnis, in dem viele alte Menschen sind, reines Erzählen wird zum leeren Geschwätz. Erst wenn ein Erlebnis erinnert und erzählt und damit wiedererlebt wird, kann sich die Spirale zu einer neuen Schleife aufschwingen. Somit ist die Spirale sozusagen der Weg vom Ist zum Soll und beschreibt damit Möglichkeiten der Persönlichkeitsbildung und Kräfteentwicklung.
Die erlebnispädagogische Waage (siehe Abb. 1) soll das Verhältnis zwischen Ereignis, Erlebnis und Transfer verdeutlichen (Michl 2020, 10). Auf der linken Seite befinden sich die Ereignisse in der Waagschale. Diese äußeren Ereignisse bieten (Erlebnis-)PädagogInnen an. Sie werden vom Individuum zu einem Erlebnis verarbeitet. Jedes äußere Ereignis wird von den Individuen unterschiedlich interpretiert und eingeordnet, je nach Biografie, Stimmung, Einstellung, Lebensalter usw. Erst das Individuum macht das Ereignis zu einem Erlebnis. Dann wieder sind die PädagogInnen am Zuge – das symbolisiert die rechte Waagschale –, um aus diesem Erleben einen Lerneffekt zu machen. Was erlebt wurde, was sich auf der inneren Leinwand abgebildet hat, muss wieder zum Ausdruck gebracht werden. Daher sind die Reflexionsmethoden in der Erlebnispädagogik so wichtig. Und da wirklich beeindruckende Erlebnisse vermittelt werden, braucht es auch kreative Methoden zum Ausdruck des Erlebten, da hier oft die Sprache versagt. Nach der Reflexion muss die Prüfung des Transfers erfolgen: Was habe ich gelernt, was kann ich in meinem Lebensalltag gebrauchen, was nehme ich mit in mein alltägliches Leben? Auch hier gilt: Werden nur Ereignisse angeboten, dann neigt sich die linke Waagschale und wir haben es mit Freizeitpädagogik zu tun. Befassen wir uns hauptsächlich mit der Auswertung von Erlebnissen, neigt sich also die Waagschale auf der rechten Seite, so haben wir es eher mit dem Bereich der Selbsterfahrung zu tun.
Abb. 1: Waage der Erlebnispädagogik
Noch in den 1990er Jahren wäre es ein Leichtes gewesen, Erlebnispädagogik zu definieren. Man hätte damals ohne Weiteres sagen können, dass Erlebnispädagogik durch Natursport etwas zur Persönlichkeitsbildung beitragen will. Nachdem sich die erlebnispädagogische Bewegung mächtig ausgebreitet hat, kann diese Definition die Bandbreite mittlerweile nicht mehr abdecken. Was Jörg Ziegenspeck als Definition anbietet, ist eher eine Beschreibung:
„Die Erlebnispädagogik versteht sich als Alternative und Ergänzung tradierter und etablierter Erziehungs- und Bildungseinrichtungen. Sie ist in der Reformpädagogik verwurzelt, geriet nach dem II. Weltkrieg fast völlig in Vergessenheit und gewinnt in dem Maße neuerlich an Bedeutung, je mehr sich Schul- und Sozialpädagogik kreativen Problemlösungsstrategien verschließen. Als Alternative sucht die Erlebnispädagogik neue Wege außerhalb bestehender Institutionen, als Ergänzung wird das Bemühen erkennbar, neue Ansätze innerhalb alter Strukturzusammenhänge zu finden“ (Ziegenspeck 1992, 141).
Bernd Heckmair und Werner Michl haben in ihrer „Einführung in die Erlebnispädagogik“ folgende Definition von Erlebnispädagogik formuliert:
„Das Konzept der Erlebnispädagogik will als Teildisziplin der Pädagogik junge Menschen durch exemplarische Lernprozesse und durch bewegtes Lernen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen – vornehmlich in der Natur – stellen, um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie zu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten.“ (Heckmair/Michl 2018, 108)
Niko Schad beschreibt Erlebnispädagogik in sieben Punkten:
■ „Sie findet in der Regel unter freiem Himmel statt.
■ Sie verwendet häufig die Natur als Lernfeld.
■ Sie hat eine hohe physische Handlungskomponente.
■ Sie setzt auf direkte Handlungskonsequenzen der verwendeten Aktivitäten.
■ Sie arbeitet mit Herausforderungen und Grenzerfahrungen.
■ Sie benutzt als Medien eine Mixtur von klassischen Natursportarten, speziellen künstlichen Anlagen sowie eine Palette von Vertrauensübungen und Problemlösungsaufgaben.
■ Die Gruppe ist ein wichtiger Katalysator der Veränderung.
Wenn die meisten dieser Kriterien erfüllt sind, wird von einem Outdoor-Training gesprochen“ (Schad / Michl 2004, 23)
Man darf anmerken, dass diese Kriterien auch für die Erlebnispädagogik gelten. Jochen Simek und Simon Sirch bereichern die Diskussion durch folgende Begriffsbestimmung:
„Erlebnispädagogik bezeichnet sowohl ein theoretisches Konzept als auch eine erzieherische Praxis. Im Zentrum des Theoriekonzepts steht die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen. Der Kern der daran ausgerichteten Praxis ist gekennzeichnet durch außeralltägliche Aufgabenstellungen an eine Gruppe von Personen, die sich in einem Naturraum unter Beteiligung ihrer bewegten Körper und begleitet von Reflexionseinheiten damit auseinandersetzen, wobei dies typischerweise im Rahmen natursportlicher Aktivitäten stattfindet“ (Simek / Sirch 2014, 33).
F. Hartmut Paffrath verweist in seiner „Einführung in die Erlebnispädagogik“ darauf, wie schwierig es ist, den Begriff Erlebnispädagogik zu fassen. Er entscheidet sich für folgende Definition:
„Erlebnispädagogik ist ein handlungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept. Physisch, psychisch und sozial herausfordernde, nicht alltägliche, erlebnisintensive Aktivitäten dienen als Medium zur Förderung ganzheitlicher Lern- und Entwicklungsprozesse. Ziel ist es, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen und zur verantwortlichen Mitwirkung in der Gesellschaft zu ermutigen“ (Paffrath 2017, 21).
Thomas Eisinger bietet folgende Begriffsbestimmung an:
„Erlebnispädagogik ist ein handlungs- und erfahrungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept. Physisch, psychisch und / oder sozial herausfordernde, nicht alltägliche, erlebnisintensive und von einem Pädagogen moderierte und mit den Teilnehmern reflektierte Aktivitäten dienen als Medium zur Förderung ganzheitlicher Lern-, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse. Ziel ist es, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen und zu einer verantwortlichen Gestaltung ihrer Lebenswelt zu befähigen“ (Eisinger 2016, 14 f.).
Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik (2017) definiert Erlebnispädagogik auf seiner Website so:
„Wir arbeiten mit einem pädagogischen Konzept zielorientiert und bevorzugt in der Natur oder dem naturnahen Raum vorrangig an der Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen.“
Trotz der Vielzahl der Definitionsversuche gibt es letztlich viele Überschneidungen. Paffrath definiert Erlebnispädagogik als handlungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept, und Simek und Sirch verstehen Erlebnispädagogik als theoretisches Konzept und pädagogische Praxis. Diese Ansätze sind umfassender als eine Methode und sollten daher in die Definition von Heckmair und Michl (2012, 115) eingebaut werden. Dies wird in der nächsten Auflage der „Einführung in die Erlebnispädagogik“ geschehen.
Literatur
Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik (2017): www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/index.php, 08.01.2018
Eisinger, T. (2016): Erlebnispädagogik kompakt. 2. Aufl. ZIEL, Augsburg
Heckmair, B., Michl, W.(2018): Erleben und Lernen. Einstieg in die Erlebnispädagogik. 8., aktual. Aufl. Ernst Reinhardt, München / Basel
Kafka, F. (1995): Brief an den Vater. Reclam, Stuttgart
Michl, W. (2020): Erlebnispädagogik. 4., aktual. Aufl. Ernst Reinhardt, München / Basel
Paffrath, F. (2017): Einführung in die Erlebnispädagogik. 2., überarbeitete Aufl. ZIEL. Augsburg
Schad, N., Michl, W. (Hrsg.) (2004): Outdoor-Training. Personal- und Organisationsentwicklung zwischen Flipchart und Bergseil. 2. Aufl. Ernst Reinhardt, München / Basel
Simek, J., Sirch, S. (2014): Das Mountainbike erlebnispädagogisch einsetzen. Grundlagen und Praxis. Ernst Reinhardt, München / Basel
Ziegenspeck, J. (1992): Erlebnispädagogik. Rückblick – Bestandsaufnahme – Ausblick. 4. Aufl. edition erlebnispädagogik, Lüneburg
2.3 Zu theoretischer Konzeption und interdisziplinärem Kontext der Erlebnispädagogik
von F. Hartmut Paffrath
Ansatz und Grundidee
Der allgemeine Paradigmenwechsel der modernen Pädagogik vom Leitbild der Belehrung zum Verständnis des Lernens als aktivem eigenständigem Prozess ist auch für die Erlebnispädagogik charakteristisch. Statt direkter Vermittlung von Inhalten, Instruktion oder Unterweisung sollen erlebnisintensive Anlässe und Situationen handlungsorientiertes Erfahrungslernen ermöglichen. Damit wählt die Erlebnispädagogik bewusst einen produktiven Umweg und stellt ein indirektes pädagogisches Modell dar.
Sie setzt auf Neugier, Experimentierfreude und Entwicklungskräfte des Menschen, vertraut auf seine Selbstregulationsfähigkeit und berücksichtigt das Prinzip der Freiwilligkeit. Zwar scheint es, als ob dadurch jede Verbindlichkeit verloren ginge, doch selbstbestimmtes, interessengeleitetes Lernen lässt sich nicht durch Zwang verordnen. Dies betrifft insbesondere persönliche Werteorientierungen, emotionale Tiefenschichten und individuelles Erleben. Mit ihren herausfordernden Lernszenarien stellt die Erlebnispädagogik durchaus konkrete Anforderungen. Sie ist keine „Bewahr-Pädagogik“ sondern eine „Bewährungs-Pädagogik“.
Die angebotenen Lernsettings unterscheiden sich – und darin liegt ein spezifisches Merkmal der Erlebnispädagogik – von traditionellen Formen und Inhalten. Neue, ungewohnte Handlungsfelder in und mit der Natur, aber auch in anderen erlebnisreichen Feldern (City Bound, Interaktions- und Problemlöseaufgaben) sollen bildungswirksame Eindrücke und Prozesse unterstützen.
Charakteristische Strukturmerkmale der Lernszenarien
Trotz verschiedener Schwerpunkte und Angebote vom Freizeitbereich bis hin zu Therapie und Rehabilitation weisen erlebnispädagogische Aktivitäten eine gemeinsame innere Struktur auf. Charakteristische Elemente und Prinzipien sind:
■ Handlungsorientierung
■ Ganzheitlichkeit („Kopf, Herz und Hand“)
■ Selbststeuerung
■ Ressourcenorientierung
■ Ernstcharakter (Grenzerfahrung)
■ soziale Interaktion / Gruppe
■ Reflexion
■ Transfer
Stellenwert und Intensität der einzelnen Merkmale können variieren. Sie hängen von der jeweiligen Zielsetzung, der Adressatengruppe und von dem ausgewählten Medium ab. Bei Outdoor-Unternehmungen spielen körperliche Grenzerfahrungen oder die Naturgewalten eine andere Rolle als bei Indoor-Interaktionsübungen. Eine Übernachtung im Freien konfrontiert mit Dunkelheit, Kälte, ungewohnten Geräuschen, einem drohenden Gewitter, mit anderen Menschen im Zelt oder Biwak. Aus solchen Situationen kann sich keiner einfach ausklinken (vgl. Paffrath 2017, 83 ff.).
Die Bedeutung der Emotionen – Erleben als zentraler Bezugspunkt
Erlebnispädagogische Programme berücksichtigen in besonderer Weise die grundlegende Relevanz der Emotionen für das Lernen und Handeln, um dadurch die vorherrschende Dominanz der Wissensvermittlung und ihre einseitige kognitive Ausrichtung zu überwinden. Emotionen entscheiden zu einem großen Anteil über die Bedeutsamkeit von Situationen oder Inhalten. Nur solche Informationen prägen sich tief und lange ein, die als (lebens-)wichtig empfunden werden, mit den Zielen des Individuums übereinstimmen und anschlussfähig sind (Roth 2011, Singer 2016, Spitzer 2007).
Flankiert wird die Erkenntnis über die Bedeutung der Emotionen für das Lernen durch Grundannahmen des Konstruktivismus. Als sich selbst organisierendes „autopoietisches“ System (Siebert 2004, 97) empfindet und reagiert jeder Einzelne ganz unterschiedlich auf Ereignisse. So können weder allgemein verbindlich wirkende Erlebnisse noch ein einzelnes Erlebnis selbst gesteuert oder gar erzeugt werden. Doch lassen sich Rahmenbedingungen schaffen, die den Prozess des Erlebens begünstigen. „Fruchtbare Momente“ hat sie Friedrich Copei (1930 / 1960) genannt: Es sind Auslöser für Stutzen, Staunen, Ergriffensein – Impulse für tiefes Erleben. Erleben ist nicht nur als unmittelbares, passives Geschehen zu verstehen. Im Inne-werden, Bewusst-werden vollzieht sich ein aktiver Prozess der Auseinandersetzung: handelndes Erleben.
Bleiben einzelne Erlebnisse nicht nur punktuelle impressionistische Eindrücke, sondern werden „verarbeitet“, entstehen aus Erlebnissen Erfahrungen. Ihre Integration, Bewältigung oder Verdrängung sind Teil eines umfassenderen Wahrnehmungs-, Deutungs- und Anpassungsprozesses des Menschen mit seiner Umwelt und ergeben „leitende Koordinaten für die Orientierung in der Welt“ (Ritter 2007, 56).
Rolle der ErlebnispädagogInnen
Entsprechend dem Grundsatz, dass alles Lernen eine eigenständige Leistung des Lernenden darstellt, ergibt sich die spezifische Rolle der ErlebnispädagogInnen. Sie sind keine Instruktoren oder Lehrenden, vielmehr begleiten sie Lern- und Entwicklungsprozesse.
Ihre Aufgabe besteht darin, attraktive und anregende Handlungsräume zu arrangieren und zu moderieren. Die teilnehmenden Akteure sollen jedoch die gestellten Herausforderungen selber lösen: eine Kletterwand oder einen Fluss überwinden, Problemlöseaufgaben oder Interaktionsübungen eigenständig in und mit der Gruppe bewältigen. Dabei ist trotz des erwünschten subjektiv empfundenen Risikos auf Seiten der Teilnehmenden ein hohes Maß an objektiver physischer und psychischer Sicherheit zu gewährleisten.
Der Interaktion und Kommunikation von Teilnehmenden und ProzessbegleiterInnen liegt grundsätzlich ein dialogisches Modell (Buber 1923, Ruf et al. 2008) zugrunde. Dies betrifft nicht nur den Weg über Aktion, Reflexion und Transfer, sondern insbesondere die damit verbundenen Zielsetzungen.
Zielsetzung
Ziele können von einzelnen Menschen für sich selbst entworfen, interaktiv in einer Gruppe ausgehandelt werden oder von Auftraggebern, Gesellschaft oder Staat vorgegeben sein. Ihre Aushandlung ist oftmals eine Gratwanderung, ein offener Dialog. Im Konflikt zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und Einpassungen einerseits sowie der individuellen Entfaltung des Einzelnen andererseits ist die Erlebnispädagogik auf der Grundlage eines humanistischen Menschenbilds und in der Tradition der Aufklärung der Autonomie und Mündigkeit des Einzelnen verpflichtet. Zu berücksichtigen hat sie aber auch die soziale Dimension (Strukturelement „Gruppe“) und die gesellschaftliche Verantwortung, wie sie etwa in Kurt Hahns Entwurf einer „Erziehung zur Verantwortung“ angelegt ist (Hahn 1958).
Interdisziplinärer Kontext
Wie eng die Erlebnispädagogik mit Forschungen und Erkenntnissen anderer Fachgebiete verbunden ist, zeigt sich sowohl in der Begründung ihrer theoretischen Basis als auch im Hinblick auf die Praxis, so etwa bei der Auswahl und Gestaltung der Lernsettings. Ohne die Einbeziehung der Erkenntnisse psychologischer und soziologischer Forschung, philosophischer Überlegungen oder den Beitrag der Neurowissenschaften wie auch neuerer didaktischer Ansätze, den Veränderungen in der Sportwissenschaft u. a., bliebe ihr Konzept ohne ausreichende Legitimation.
Erkenntnisse des Konstruktivismus unterstützen zum Beispiel die Prinzipien der Selbststeuerung und Ressourcenorientierung. Bereits Säuglinge steuern von Anfang an ihre Entwicklung in Interaktion mit der Umwelt aktiv mit. Sie sind keine „tabula rasa“, kein „weißes Papier“ (John Locke 1693/1962, 169), keine „leeren Gefäße“, in die man Wissen eintrichtern muss.
Das Prinzip der Handlungsorientierung wird untermauert durch Hinweise der Lern- und Kognitionspsychologie. Im Anschluss an Jean Piaget geht sie davon aus, dass sich Denkstrukturen aus verinnerlichten Handlungsstrukturen entwickeln. Werden Einsichten und Wissen handelnd angeeignet, lassen sich die so erworbenen Erkenntnisse ebenfalls leichter in komplexe Netze einordnen und damit besser behalten, wie die Gehirnforschung aufzeigt. Emotion und Kognition ergänzen und bestärken sich nach Erkenntnissen der Motivationspsychologie wechselseitig, wenn Handlungen selbst gewählt oder wenigstens mitbestimmt werden können (Prinzip „Challenge by Choice“).
Wie vielfältig und komplex die interdisziplinären Zusammenhänge erlebnispädagogischer Arrangements sind, verdeutlicht exemplarisch der von Michael Birnthaler reflektierte Bezugsrahmen für den Bereich abenteuerorientierter erlebnispädagogischer Programme. Relevant sind hier neben den Ergebnissen der Emotionsforschung psychoanalytische Erklärungsmodelle, Angstlust-Theorien, Bewusstseins- und motivationspsychologische Ansätze ebenso wie Thesen zu Ur- und Grenzerfahrungen (Birnthaler 2010).
Kindheitsstudien (Raith / Lude 2014) sowie kulturanthropologische Analysen stützen weiterhin das Konzept der abenteuerorientierten Erlebnispädagogik. Als Erprobungsfeld hat diese für Becker eine besondere „kompensatorische wie auch emanzipatorische Funktion“ (Becker 2002, 36). Sie konfrontiert mit Unsicherheit, Wagnis, Krisen, zwingt dazu, Entscheidungen zu treffen und Konsequenzen auszuhalten und unterstützt so das Selbstständigwerden, den Weg zu Autonomie, die Mündigkeit des jungen Menschen in der modernen Welt – geprägt durch eine offene Zukunft, die Zunahme des Unbestimmten, den Verlust an Eindeutigkeit (Becker 2002).
Literatur
Becker, P. (2002): Nec Plus Ultra. Die Neugier des Ulysses und ihre Folgen – Zum Mythos der Abenteuerpädagogik. In: Paffrath, F. H., Altenberger, H. (Hrsg.): Perspektiven zur Weiterentwicklung der Erlebnispädagogik. Schwerpunkte: Ethik und Evaluierung. Hochschulforum Erlebnispädagogik Augsburg 2000 und 2001. ZIEL, Augsburg, 25–43
Birnthaler, M. (2010): Wurzeln und Ausläufer der Erlebnispädagogik. Zur Problematik körperzentrierter und naturbezogener Leitbilder in der Erlebnispädagogik. Diss. Universität zu Köln. I: kups.ub.uni-koeln.de/3141/1/Diss._Birnthaler._Birnthaler.pdf, 1.1.2018
Buber, M. (1923): Ich und Du. Insel, Leipzig
Copei, F. (1930 / 1960): Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess. 5. unveränderte Aufl. Quelle & Meyer, Heidelberg
Hahn, K. (1958): Erziehung zur Verantwortung. Reden und Aufsätze. Klett-Cotta, Stuttgart
Locke, J. (1693/1962): Gedanken über Erziehung. Übersetzt und herausgegeben von H. Wohlers. Klinkhardt, Bad Heilbrunn/Obb.
Paffrath, F. H. (2017): Einführung in die Erlebnispädagogik. 2. überarb. Aufl. ZIEL, Augsburg
Raith, A., Lude, A. (2014): Startkapital Natur. Wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert. oekom, München
Ritter, H. W. (2007): Erfahrung. In: Gräb, W., Weyel, B.(Hrsg.): Handbuch Praktische Theologie. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 52–63
Roth, G (2011): Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt. Klett-Cotta, Stuttgart
Ruf, U., Keller, S., Winter, F. (2008): Besser lernen im Dialog: Dialogisches Lernen in der Unterrichtspraxis. Klett-Cotta, Stuttgart
Singer, P. (2016): Effektiver Altruismus. Eine Anleitung zum ethischen Leben. Suhrkamp, Berlin
Siebert, H. (2004): Theorien für die Praxis. Bertelsmann, Bielefeld
Spitzer, M. (2007): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Springer, Berlin
2.4 Erlebnispädagogische Interventionen
von Manfred Huber
Eine Person, eine Gruppe, eine Organisation bilden im Prozess des Lernens zunächst ein autonomes System: Motivation, Zielsetzungen (auch vorgegebene), Ressourcen sind zum großen Teil selbstgesteuert, zumal in handlungs- und erlebnisorientierten Settings. Ein anderes autonomes System bildet das TrainerInnenteam, der bzw. die Lehrer. Auch sie haben eigene selbstgesteuerte Ziele, Motivationen und angenommene Aufträge.
Beide Systeme stehen in einem bestimmten, vorher definierten Verhältnis zueinander. Dies kann ein hierarchisches sein (Überordnung / Unterordnung), wie es etwa in Sozialen Trainingskursen oder in bestimmten Formen des schulischen Lernens (allein durch die Möglichkeit der Beurteilung) vorkommt. Es kann aber auch vorher vereinbart werden, in welcher Wechselbeziehung die Systeme zueinander stehen.
Nicht jede Handlung des Trainers stellt eine Intervention dar, selbst wenn Gruppen in bestimmten Situationen geneigt sind, Handlungen häufig als bewusste Interventionen zu interpretieren und beispielsweise die Frage aufwerfen, welche Botschaft durch das Ausziehen eines roten Pullovers signalisiert werden könnte (Königswieser / Exner 1999, 18).
Eigentlich aber sprechen wir von einer Intervention seitens des Trainers, Beraters, Lehrers, wenn diese in das autonome System der Lerngruppe absichtlich mit dem Ziel eingreifen, eine bestimmte Wirkung für den sich vollziehenden Lernprozess zu erzielen. Dies ist möglich, indem sie ihn stoppen, beschleunigen oder ihm eine andere Richtung geben.
Notwendige Interventionen
Die Beantwortung der Frage, ob eine Intervention zwingend notwendig ist, kann in erlebnispädagogischen Settings nur in einem Fall eindeutig mit „ja“ beantwortet werden. Dann nämlich, wenn die physische oder psychische Sicherheit der Teilnehmenden gefährdet ist. Denn der Trainer hat hier durch seine Fachkenntnis eine sogenannte „Garantenstellung“ (BJR 2015, 35 ff.).
Beispielsweise hat eine Gruppe die Aufgabe bekommen, selbstständig einen in der Karte eingezeichneten Biwakplatz zu erreichen. Während die Gruppe sich in Selbstorganisation und mit viel erkenntnisträchtiger Interaktion dem Biwakplatz nähert, zieht ein vom Wetterbericht nicht vorhergesagtes Gewitter auf. Die LeiterInnen können dies aufgrund ihrer alpinen Fachkenntnisse an den Wolkenformationen erkennen. Des Weiteren können sie einschätzen, dass die Gruppe bei einem Gewitter im Gebirge extrem gefährdet ist. Hier ist eine Intervention zwingend notwendig. Sie besteht darin, den kompletten Gruppen- und Lernprozess zu stoppen, auf die Gefahr hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass die Gruppe sofort umkehrt und sich in Sicherheit bringt.
Gerade in freier Natur gibt es viele solcher Situationen, etwa Hochwasser, Steinschlag oder Erdrutsch bei absturzgefährdetem Gelände. Während aber etwa Regen nur unangenehm ist, ist Gewitter möglicherweise lebensgefährlich. In vielen solcher Fälle kann das autonome, lernende System die erforderlichen Entscheidungen nicht aus sich selbst heraus fällen. Ihm fehlt die Expertise. Es kann die Gefährdungen und das Risiko nicht erkennen und einschätzen.
Ebenso ist eine Intervention des Trainers gefordert, wenn die psychische Verfasstheit eines Teilnehmenden in hohem Maße gefährdet ist. Diesen Punkt zu erkennen erfordert neben einer präzisen Beobachtung des Gruppenprozesses ein umfangreiches Wissen über Traumatisierungen und Retraumatisierungen. Denn was für den einen Teilnehmenden eine Herausforderung mit der Chance ist, die eigene Persönlichkeit in den Blick zu nehmen und Kompetenzen zu erweitern, bedeutet für den anderen Teilnehmenden womöglich eine (Re-)Traumatisierung mit schwerwiegenden psychischen Folgen. Sei es die Enge einer Höhle, aufkommende Höhenangst während des Abseilens oder zu viel (erzwungene) körperliche Nähe während einer Kooperationsübung: Gerade in der Erlebnispädagogik können sehr intensive, Angst auslösende und somit existentielle Emotionen aufkommen.
Dies zu erkennen bzw. zu antizipieren und entsprechend zu intervenieren ist in der pädagogischen Praxis schwierig. Es erfordert neben fundiertem psychologischem Wissen den Mut und die Intuition, zum richtigen Zeitpunkt zu intervenieren.
In der erlebnispädagogischen Praxis muss der Leiter je nach den örtlichen Gegebenheiten zudem dafür sorgen, dass die Intervention für Gruppe und Teilnehmende durchführbar ist. So muss auch während des Abseilens gewährleistet sein, dass der Trainer intervenieren kann (nachlassbares System oder Parallelabseilen) oder es müssen in der Enge eines Höhlengangs bereits im Vorfeld Plätze für eine Einzel- oder Gruppenintervention besprochen werden.
Drittens sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass der Trainer auch dann intervenieren muss, wenn durch das Verhalten der Gruppe oder Einzelner in freier Natur empfindliche und nicht vertretbare ökologische Schäden drohen. Dies sollte im Unterrichtsraum Natur eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellen.
Mögliche Interventionen
In allen anderen Fällen wird seitens der TrainerInnen eine Abwägung erfolgen, ob sie den Lernprozess der Gruppe laufen lassen oder ob sie intervenieren.
Eine Intervention im eigentlichen Sinn, also das besagte Eingreifen in den autonomen Lernprozess, erfolgt erst dann, wenn sich die Gruppe in ihrem Lernprozess befindet. Also erst, nachdem die TrainerInnen der Gruppe eine Aufgabe gestellt haben und die Gruppe sich im Prozess des Handelns und Lernens befindet. Wenn beispielsweise einzelne Teilnehmende während der Übungen „Spinnennetz“ oder „der heiße Draht“ auf die Idee kommen, die Übung durch riskante Flugrollen oder große Sprünge meistern zu wollen und sich dadurch das Risiko einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung ergibt, dann sollen die TrainerInnen genau hier eingreifen und diesen Plan stoppen bzw. die Gefährdung benennen. Dies wäre dann eine klassische Intervention zur Wahrung der Sicherheit. Den Aspekt der Optimierung eines Lernprozesses könnte folgendes Beispiel beleuchten: Der Trainer hat eine Aufgabe gestellt, für die die Gruppe keine Lösung findet. Stattdessen dreht sich der Lösungsprozess und die Diskussion ständig im Kreis. So kommt es mit zunehmender Zeit zu ersten Frustrationserscheinungen im Lernprozess; Einzelne oder Teile der Gruppe sind demotiviert und verlassen innerlich das Geschehen. Das sind ungünstige Voraussetzungen für Lernprozesse. Eine Intervention kann hier das Geschehen wenden, der Trainer könnte seine beobachtende Position verlassen und zusammen mit der Gruppe eine neue Perspektive eröffnen oder der Gruppe den frustrierenden Lernprozess zumuten, um womöglich genau daraus wichtige Lernerfahrungen zu gewinnen. Eine Abwägungssache.
Zwei Aspekte haben hier eine große Bedeutung: der Zeitpunkt und die Art der Intervention. Soll die Intervention wirksam sein, darf sie nicht zu früh, aber auch nicht zu spät erfolgen. Da objektive Kriterien nicht vorliegen und die Entscheidung innerhalb weniger Augenblicke getroffen werden muss, gilt es hier für den Trainer, ein gutes Gespür für den richtigen Zeitpunkt zu entwickeln. Wie beschrieben kann sich natürlich für eine Gruppe auch nachträglich, in der Reflexion, ein Lernerfolg einstellen. Es wäre interessant zu untersuchen, welche Mechanismen in der Gruppe oder bei den Persönlichkeiten dazu geführt haben, den kreativen und lösungsorientierten Prozess zu verlassen und stattdessen an sich selbst, der Gruppe oder der Aufgabe zu zweifeln. Diese könnten umso eindrücklicher sein, je mehr sie am Ende eines Leidensprozesses erkennbar werden. Es kann aber wie gesagt auch sein, dass dieser Leidensweg zu Widerständen und Frustration führt, welche einen Lernprozess verhindern. Auch hier muss sich der Leiter aktiv entscheiden, ob er interveniert. Da es hierfür außer der Erfahrung und der Intuition der LeiterInnen kaum Kriterien gibt, könnte eine handlungsleitende Frage sein, ob der Erkenntnisgewinn für das lernende System den Eingriff in den autonomen Lernprozess rechtfertigt. Kann diese Frage bejaht werden, wäre das eine hinreichende Begründung, um den Lernprozess der Gruppe durch eine Intervention zu stoppen und ihm somit eine neue Richtung zu geben.
Arten der Intervention
Prinzipiell gilt, dass eine Intervention des Leiters in den laufenden Lernprozess einen nicht zu unterschätzenden Eingriff in die Autonomie des Lernprozesses der Gruppe darstellt. Dies kann nur auf der Grundlage einer akzeptierten, wertschätzenden und gefestigten Beziehung erfolgen, wenn es erfolgreich sein soll. Denn andernfalls wird die Gruppe geneigt sein, die Verantwortung für ein mögliches Scheitern auf den Trainer zu übertragen und somit die Verantwortung für den eigenen Lernprozess abzugeben. Wenn jedoch die Beziehung zwischen Trainer und Gruppe tragfähig ist, gibt es mehrere Arten einer hilfreichen Intervention.
Relativ niedrigschwellig wird interveniert, wenn zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe entweder mehr oder auch weniger Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Damit sind Hilfsmittel, Informationen oder einfach die Zeit gemeint, die zur Bewältigung der Aufgabe vorgesehen ist. In diesen Fällen werden die Stellschrauben für die Aufgabe nachjustiert, weil sie mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln entweder zu schwer oder zu leicht war. Nur dann nämlich, wenn die Schwierigkeit der Aufgabe mit den Fähigkeiten der Gruppe korrespondiert, sind günstigste Voraussetzungen für einen Lernprozess gegeben (Csikszentmihalyi 2010). Ein nachträgliches Erschweren der Aufgabe kann, je nach Situation, durchaus elegant erfolgen, etwa wenn ein Hauptakteur durch eine neue Vorgabe des Trainers plötzlich „erblindet“ oder bewegungseingeschränkt wird.
Eine weitere Möglichkeit ist es, durch die Intervention Einzelne oder die Gruppe motivational zu stärken, etwa durch das Initiieren einer kleinen Pause, in der jeder Teilnehmende für sich die Möglichkeit hat, den aktuellen Prozess zu überdenken und Lösungsvorschläge zu finden – ähnlich wie das im Sport beim Timeout bei kritischen Spielphasen möglich ist.
Die nächste Stufe einer Intervention könnte dann eine Art Zwischenreflexion sein.
Diese kann in Form eines Gespräches stattfinden, mit kreativen Methoden oder mit anderen Reflexionsmethoden wie etwa dem Standogramm. Diese Zwischenreflexion führt die Gruppe auf eine andere Ebene. Sie bietet ihr Gelegenheit, über das bisherige Handeln strukturiert nachzudenken und es neu auszurichten. Der Trainer moderiert diesen Prozess. Dabei ist es wichtig, den Ebenenwechsel deutlich zu machen und ihn zeitlich zu begrenzen. Es muss klar sein, ab welchem Zeitpunkt die Gruppe wieder ihren Lernprozess aufnimmt und die Bewältigung der Aufgabe fortsetzt.
Eine Variante dieser Zwischenreflexion kann darin bestehen, der Gruppe bereits im Vorfeld ein bestimmtes Kontingent an „Beratungszeit“ anzubieten, das sie nach eigenem Ermessen in Anspruch nehmen kann. Die Beratungszeit kann möglicherweise auch etwas „kosten“ (Zeitverknappung, als Bezahlung müssen Hilfsmittel eingesetzt werden, etc.). So kann der Zeitpunkt der Zwischenreflexion und somit des Ebenenwechsels in die Verantwortung der Gruppe gelegt werden.
Interventionsmethoden
Zur Ausgestaltung einer Intervention gibt es gruppendynamisch einige wirkungsvolle Methoden. Meistens wird die erwähnte Zwischenreflexion in einem moderierten Gespräch die Möglichkeiten der bisherigen bzw. zu verändernden Kommunikations- und Organisationsformen innerhalb der Gruppe erörtern und klären. Dabei wird der Fokus auf den Chancen liegen, die es zu nutzen gilt, und auf den Schwierigkeiten, die aus dem Weg zu räumen sind. Der Blick wird also nicht, wie bei einer Abschlussreflexion, auf die persönlichen Lernerfolge gerichtet sein. Insofern ist die Zwischenreflexion ein guter Weg, durch das Stellen vieler Fragen den Lösungsprozess innerhalb der Gruppe anzuregen. Aus der systemischen Pädagogik kennen wir die sogenannten zirkulären Fragen, bei denen auch die Haltungen und Beziehungen der Akteure untereinander erkennbar werden. Beispiel: „Was würde wohl euer Chef sagen, wenn er euch bei der Bewältigung der Aufgabe sähe?“ „Wann wärst du zufrieden mit dem Ergebnis?“ „Wer, meinst du, muss am weitesten aus seiner Komfortzone herausgehen, um diese Aufgabe zu bewältigen?“ Ebenfalls aus dem Repertoire der systemischen Interventionen kommen alle Arten von paradoxen Interventionen. Darunter versteht man „alle Interventionsrichtungen, die nicht eine auf Veränderung drängende Position einnehmen und die es dem Klientensystem überlassen, die Gegenposition selbst einzunehmen“ (Königswieser / Exner 1999, 37). Dazu werden Interventionsformen wie positive Konnotation, Umdeutung, Reframing, positive Symptombewertungen, paradoxe Intervention u. a. gezählt. Beispiele: „Eure lebhafte Gruppendiskussion bringt euch ja auch menschlich näher und ist sicherlich wichtiger, als einen vom Trainer vorgegeben Gipfel zu erreichen“. Oder folgende – paradoxe – Aufgabenstellung der LeiterInnen: „An jedem Tag der Maßnahme muss eine Sache mit absoluter Perfektion / nonverbal / intuitiv erledigt werden“. Paradoxe Interventionen drängen Gruppen dazu, die eingeschlagenen Denkmuster zu verlassen und womöglich in einen – erhofften – Widerstand zu gehen. Vorsicht ist geboten, damit man als Trainer nicht in den Zynismus abgleitet.
Wirkung der Interventionen
Die Wirkung von Interventionen ist in jedem Fall das „Stören“ des „Lernsystems“ der Gruppe. Interventionen helfen der Gruppe, den aktuellen Gruppenprozess zu unterbrechen, ihn zu verlassen und neue Richtungen und Optionen zu erkennen. Dies kann den Lernprozess des Einzelnen oder der Gruppe beschleunigen oder vertiefen. Außerdem werden durch eine rechtzeitige und gut geführte Intervention oftmals frustrierende Misserfolgserlebnisse vermieden.
Literatur
BJR (2015): Qualitätsstandards in der Erlebnispädagogik. Eigenverlag , München
Csikszentmihalyi, M. (2010): Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen. 5. Aufl. Klett-Cotta, Stuttgart
Königswieser, R., Exner, A. (1999): Systemische Interventionen. 3. Aufl. Klett-Cotta, Stuttgart
2.5Bildung und Kompetenzerwerb
von Wolfgang Wahl
In der humanistischen Tradition der Erziehungswissenschaft wird Bildung als ein umfassender Prozess der Entwicklung einer Persönlichkeit in der Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt verstanden. Das Subjekt eignet sich „die Welt“ aktiv an und ist dabei auf bildende Gelegenheiten angewiesen. Während unter Erziehung vor allem die an Erziehungszielen orientierte Einwirkung von Eltern oder LehrerInnen auf die Heranwachsenden verstanden wird, zielt der Begriff der Bildung auf die Selbsttätigkeit der Person ab.
Immanuel Kant hat Bildung als eine zweiseitige Angelegenheit verstanden. Einerseits geht es um den Erwerb von Qualifikationen, um kulturelle, soziale und instrumentelle Kompetenzen, also um den Bereich der „Nützlichkeit“. Kant nannte dies die „physische Erziehung“. Anderseits geht es um das „Sittlich-Moralische“, die „praktische Erziehung“, also die bewusste und kritische Selbstbestimmung des Menschen in Freiheit (Kant, 1803). Dieser Doppelaspekt von Bildung, der Erwerb von nützlichen Fähigkeiten (Kompetenzen) einerseits und die Persönlichkeitsbildung mit dem Ziel der freiheitlichen Selbstbestimmung auf der Basis von Wertvorstellungen anderseits, ist seit der Aufklärung dem Bildungsbegriff inhärent.
Die Erlebnispädagogik als pädagogische Praxis will Bildungsgelegenheiten schaffen und das Erlernen vor allem von personalen und sozialen Kompetenzen ermöglichen. Die Legitimität dieses Anspruchs leitet sich aus der erlebnispädagogischen Grundannahme ab, dass sich die im Eigenhandeln und durch Selbst-, Gruppen- und Naturerleben gewonnenen Erfahrungen und deren Reflexion positiv auf die Fähigkeiten der Akteure auswirken können. Durch Selbstüberwindung, Selbstentdeckung und den Dienst am Nächsten solle, so sah es bereits der „Vater der Erlebnispädagogik“, Kurt Hahn, Persönlichkeitsentwicklung – Hahn nannte es „Charakterbildung“ – gefördert und Eigenverantwortung eingeübt werden.
Lernen durch handelndes Tun
Damit knüpft die Erlebnispädagogik an eine Idee von Lernen an, die, historisch gesehen, keinesfalls neu ist. Schon Aristoteles formuliert in der Nikomachischen Ethik [Buch II, Kap. 1] die Einsicht, dass sittliche Werte und moralisches Verhalten genauso wie fachliches Können weniger durch theoretische Belehrung als mehr durch praktische Nachahmung und Übung erlernt werden. „Denn was wir tun müssen, nachdem wir es gelernt haben“, so der griechische Philosoph, „das lernen wir, indem wir es tun: So wird man durch Bauen ein Baumeister und durch Zitherspielen ein Zitherspieler“.
Johann Amos Comenius knüpfte an das aristotelische Modell des Selbstlernens durch handelndes Tun an und formulierte diesen Kerngedanken (erlebnis-)pädagogischer Bildungsvorstellungen in seiner „Großen Didaktik“ (1657; Comenius 2008). Deren spätere Übersetzung ins Englische sorgte dafür, dass sich die Idee auch im anglo-amerikanischen Sprachraum verbreitete und schließlich bei Francis W. Parker (1883) zum schlagkräftigen Slogan – „we learn to do by doing“ – der amerikanischen „new education“-Bewegung entwickelte (Knoll o. J., 5). Die oftmals fälschlicherweise der Urheberschaft John Deweys zugeschriebene Maxime „learning by doing“ stellt demgegenüber nur eine verkürzte und unzureichend wiedergegebene Formulierung dar (Knoll o. J., 11). Gleichwohl sind
„die für ‚praktisches Lernen‘ zentralen Kategorien des Erlebens und der Erfahrung in keinem reformpädagogischen Ansatz so durchreflektiert im Mittelpunkt wie in John Deweys Philosophie und Pädagogik“ (Bohnsack 1987, 194).
Lern- und Bildungsprozesse sind gemäß dieser Perspektive gar nicht möglich ohne den Bezug auf eigene Erfahrung. Menschen sind aber nicht nur
eigenhandelnde, „sondern auch eigenleistende Wesen, die sich selber, also persönlich und engagiert, mit ihren eigenen Handlungen identifizieren“ (Lenk 2015, 228). Beispielsweise gelingt es einem Kletterer, eine anspruchsvolle Wandpassage zu bewältigen. Oder eine Jugendliche stellt ein Land-Art-Kunstwerk aus Steinen her. Handelndes Tun hat zur Folge, dass spezifische Leistungen von Einzelnen oder Gruppen sichtbar werden, auch wenn es sich „nur“ um symbolische oder immaterielle Ergebnisse handelt. Erlebnispädagogik rückt diese Leistungen und die damit einhergehenden Erfahrungen in den Mittelpunkt und macht sie zum Ausgangspunkt von Bildungs- und Lernprozessen.
Persönlichkeitsbildung durch ernsthafte Herausforderungen