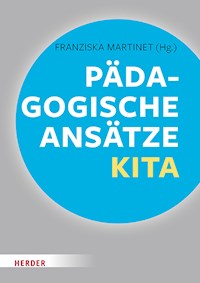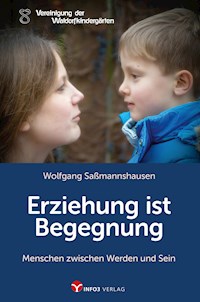
9,99 €
Mehr erfahren.
Wie werden pädagogische Leitbilder im Alltag mit kleinen Kindern handlungswirksam? Wie kann das Zusammenleben gelingen? Wolfgang Saßmannshausen blickt auf Erziehung als Lebenskunst und entfaltet ihr Potenzial aus der Perspektive der wechselseitigen zwischenmenschlichen Begegnung – denn beide, Kinder wie Erwachsene, sind vor allem eines: Menschen im Prozess, die sich weiterbilden und -entwickeln. In einem Tanz von Sehnsucht und Vertrauen umspielen sie einander in ihrer auf Freiheit angelegten unverwechselbaren Individualität und erkunden das Mögliche zwischen vergangenheitsgesättigter Erfahrung und den Impulsen aus der Zukunft. Damit Erziehung und Bildung Gegenwartserfüllung werden, braucht es die Bereitschaft, dem Strom der Zeit zu lauschen und mit Kopf, Herz und Verstand das Tor für die Zukunft zu suchen und zu öffnen. Wie die Suche gelingen kann, zeigt der Autor aus seiner langjährigen Erfahrung in diesem Buch. „Kinder begegnen uns, wie wir sind, und sprechen uns gleichzeitig zu, der werden zu können, der wir sein wollen.“ Wolfgang Saßmannshausen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 81
Ähnliche
Gewidmet meinem Kollegen, Lehrer und FreundJohannes W. Schneider
Impressum
ISBN epub: ISBN 978-3-95779-114-6
ISBN print: ISBN 978-3-95779-099-6
Diesem eBook liegt die erste Auflage 2019 der Printausgabe zugrunde.
Alle Rechte vorbehalten, © 2019 by Info3 Verlag, Frankfurt am Main und Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V., Neustadt/Weinstraße
www.info3.de
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
Cover: Frank Schubert, Frankfurt am Main
Über dieses Buch
Wie werden pädagogische Leitbilder im Alltag mit kleinen Kindern handlungswirksam? Wie kann das Zusammenleben gelingen? Wolfgang Saßmannshausen blickt auf Erziehung als Lebenskunst und entfaltet ihr Potenzial aus der Perspektive der wechselseitigen zwischenmenschlichen Begegnung – denn beide, Kinder wie Erwachsene, sind vor allem eines: Menschen im Prozess, die sich weiterbilden und -entwickeln. In einem Tanz von Sehnsucht und Vertrauen umspielen sie einander in ihrer auf Freiheit angelegten unverwechselbaren Individualität und erkunden das Mögliche zwischen vergangenheitsgesättigter Erfahrung und den Impulsen aus der Zukunft. Damit Erziehung und Bildung Gegenwartserfüllung werden, braucht es die Bereitschaft, dem Strom der Zeit zu lauschen und mit Kopf, Herz und Verstand das Tor für die Zukunft zu suchen und zu öffnen. Wie die Suche gelingen kann, zeigt der Autor aus seiner langjährigen Erfahrung in diesem Buch.
„Kinder begegnen uns, wie wir sind, und sprechen uns gleichzeitig zu, der werden zu können, der wir sein wollen.“
„Vorbild heißt schlicht: Der Mensch bildet sein Leben vor, zum Beispiel vor den Kindern. Die Kinder erleben, wie der Erwachsene sich lebt, und im positiven Fall sich bildet als Mensch aus seinen eigenen Zukunftsmotiven. Auf ihre Art tun es die Kinder dann auch.“
Wolfgang Saßmannshausen
Über den Autor
Dr. Wolfgang Saßmannshausen ist Diplom-Pädagoge und Lehrer. Er hat viele Jahre in verschiedenen Einrichtungen der Waldorfpädagogik gearbeitet. Heute ist er als Aus- und Fortbilder für die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten tätig und berät Kindergärten und Ausbildungsstätten weltweit.
INHALT
1. BILDUNG
2. ERZIEHUNG IST BEGEGNUNG
Identität
Freiheit
Moral und Verbindlichkeit
Nachhaltigkeit: Die Bedeutung für das weitere Leben
3. WER IST „ICH“ IN DER ERZIEHERISCHEN BEGEGNUNG?
Die sichere Seite unseres Lebens
Die spannende offene Seite unseres Lebens
4. DAS INNERE DRAMA DER MODERNEN SEELE
5. WERDEN WIE DIE KINDER: LEBENSKÜNSTLER WERDEN
6. DER WEG FÜHRT ÜBER DEN HIMMEL
Vom Höchsten schrittweise zum Konkreten
7. DIE GEMEINSCHAFTS-BILDENDE SEITE
8. EPILOG
Hinweis zu den Bildern
Quellen- und Literatur verzeichnis
Im Grundesind es immerdie Verbindungenmit Menschen,die dem Lebenseinen Wertgeben.
Wilhelm von Humboldt
1. BILDUNG
Vor jedem steht ein Bild des,was er werden soll.Solang er dies nicht ist,ist nicht sein Friede voll.
Friedrich Rückert
Man stelle sich folgendes Szenarium vor:
… auch wenn er sich sichtlich wohl und befreit fühlte, war ihm die Welt, in die und in der er aufwachte, nicht gänzlich vertraut. Neben dem Gefühl, zu Hause angekommen zu sein, den alten Ballast endgültig abgeworfen zu haben, blieb eine gewisse Unsicherheit über seine neue Umgebung. Dass er jetzt hier sein wollte, stand außerhalb jeder Diskussion; das Erlebnis der vorher nicht erlebten angenehmen Wärme und des wie Liebe ihn umhüllenden Lichtes vermittelte ihm die Empfindung der selbstverständlich richtigen Umgebung. Das, was er sonst beim Eintritt in ungewohnte Momente getan hätte, kam überhaupt nicht als Bedürfnis auf, weder der wie automatisch ablaufende Griff zu der Zigarette noch das Überprüfen, ob das Jackett und die Krawatte richtig saßen. Ja, die Tatsache, dass er zuvor Raucher gewesen war und schon aufgrund seiner Position immer wieder auf die exakt sitzende Passform seiner Kleidung achtete, war wie ausgelöscht. Das Gefühl, eine wichtige Position im Leben eingenommen zu haben, in seiner Firma unentbehrlich zu sein, wegen seiner großartigen Leistungen von allen verehrt zu sein, war verschwunden. Stattdessen kam eine völlig andere Empfindung auf. Alles, was er in den vergangenen Jahren gedacht, erlebt, getan hatte, reduzierte sich auf ein Minimum, das wie ein Aschehaufen den sichtbaren Rest eines großen Holzstoßes bildete.
Und immer stand dieser kleine Haufen in enger Beziehung zu einem Bild, das sich jetzt deutlicher herausbildete. Es schien ihm, als kenne er dieses Bild sehr lange. Bald war es ihm Gewissheit, dass er dieses Bild beim Eintritt in sein Leben gesehen, ja sogar geschaffen hatte. Manchmal war es ihm im Leben so ergangen, dass er ein leises Gefühl dieses Bildes in sich trug. Wenn er ihm näherkam, hatte es sich so ausgedrückt, dass er in innerer Harmonie und Freude auf die anstehenden Lebensschritte und Aufgaben seine Zeit gestalten konnte; wenn er ihm weit entfernt gewesen war, hatte er es in einer leicht depressiven Stimmung dem Leben gegenüber erlebt. Nun stand es wieder wie ein unerbittliches Mal vor ihm, nur diesmal in enger Beziehung zu dem reduzierten Haufen.
Das also war die Frucht all der vielen Jahre und der harten Bemühungen. Dem jetzigen Blick bot sich ein völlig anderes Bild als das, das er gewohnt zu schauen war.
Nehmen wir das Leben als ein Ganzes und betreiben wir Evaluation aus der lebensrückblickenden Perspektive, fallen die Bewertungen anders aus, als wenn wir sie im laufenden Leben kurzschlüssig vornehmen. Nur das, was wirklich menschliche Entwicklung ausmacht, hat Bestand. Alles andere erweist sich als unwirklich, als unbedeutende Spielart eines kurzfristigen Blickes. Das Leben ist ausgerichtet auf Erfüllung. Erfüllung aber ist ohne Erwartung nicht zu denken. Erwartung steht am Anfang, sie ist jederzeit präsent und bildet den ständigen Untergrund all unseres Tun und Lassens. Sie ist der unbestechliche Wächter und Maßstab eines jeden Menschen. Der modern gebildete Mensch sieht sein Leben im Lichte seiner Erwartung: „Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt, der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechselungen übereinzustimmen die große Aufgabe seines Daseins ist.“ Dieser fundamentale Satz Friedrich Schillers aus seiner Schrift Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1879) ist der vielleicht prägnanteste Grundbegriff moderner Bildung. Bildung in diesem Sinne ist der nachhaltigste Prozess des irdisch-menschlichen Daseins. Seine Zielperspektive ist ewig, zumindest zunächst lebenslang. Nur der, der im persönlichen Zwischenresümee Übereinstimmung mit seinem idealischen Menschen erlebt, kann sich gebildet nennen. Sie gilt es immer wieder neu zu erringen. Bildung ist somit ein lebenslanger Prozess, der in jedem Moment scheitern kann, der aber auch in jedem Moment neu ergriffen werden kann. Der Antrieb zu dieser Bildung ist die Conditio sine qua non des Menschseins. Erziehung ist die Begleitung des Kindes für eine begrenzte Zeit, die diese Bildungsmöglichkeit schützt und pflegt.
2. ERZIEHUNG IST BEGEGNUNG
Der Mensch lerntdas Menschseinnur am Menschen.
Novalis
Stellen wir uns folgende Situation vor: Ständig stößt ein Vater sein kleines Kind zurück. Täglich erlebt das Kind viele Verletzungen. Schroffe Weisungen wie „Störe nicht!“, „Lass mich in Ruhe“, „Gehe sofort aus dem Zimmer“, „Du kannst ja dieses und jenes nicht“, „Du bist nervend!“ und andere mehr erfährt das Kind täglich. Man möge sich vorstellen, der hier beschriebene fiktive Vater würde auch nur eine kurze Zeit so mit seinem Arbeitskollegen kommunizieren. Wie selbstverständlich würde dieser sich von dem Mann abwenden und den Kontakt vermeiden oder aber ihm entsprechend aggressiv antworten. Freudig erwartungsvoll jedenfalls würde er ihm in zukünftigen Situationen nicht begegnen.
Ganz anders das kleine Kind. Auch wenn es noch so oft diese verletzende Ablehnung und Zurückweisung erfahren hat, ist es im nächsten Augenblick wieder völlig offen für die neue Begegnung, in selbstverständlicher Erwartung eines gänzlich anderen Verhaltens des Vaters. Ob der Vater eine andere Haltung dem Kind gegenüber und damit auch sich selbst gegenüber entwickelt, entscheidet er allein – nicht intellektuell theoretisch, sondern willentlich praktisch. Dass er grundsätzlich die Möglichkeit dazu hat, realisiert das Kind – wiederum nicht intellektuell theoretisch, sondern willentlich praktisch.
Hier spricht sich die Art und Weise aus, wie das kleine Kind grundsätzlich der Welt, insbesondere den ihm verbundenen Menschen begegnet. Es schaut nicht auf seine Erfahrungen und leitet daraus Handlungsmotive für die Zukunft ab – so wie es ältere Kinder oder Erwachsene tun. Selbstverständlich spielen die Erfahrungen kleiner Kinder eine bedeutende Rolle für ihr Leben. Darauf soll später ausführlich eingegangen werden. Für den aktuellen Handlungsansatz ist im Wesentlichen etwas anderes wichtig. Das Kind hat von dem Erwachsenen, mit dem es zu tun hat, letztendlich immer ein idealtypisches Bild. Der oben genannte Schiller’sche „idealische Mensch“ ist das Bild des Menschen, dem das Kind in der erzieherischen Beziehung begegnet. So wie der Mensch sein könnte, wenn er es denn sein wollte, so sieht das Kind den Erwachsenen. Es spricht also immer einen noch nicht sinnlich präsenten Teil unserer Persönlichkeit an. Diese Qualität des Menschen ist aber vorhanden – als Möglichkeit oder als Keim. Wenn sie noch nicht sinnlich präsent ist, ist sie über-sinnlicher Natur; sie ist Ausdruck unseres geistigen Wesens. Sie ist stets in statu nascendi, also so, dass sie als Möglichkeit vorhanden ist und in Erscheinung treten kann – oder aber auch nicht. Anders formuliert heißt das, dass kleine Kinder nicht den Blick auf die in der Erfahrung sich abbildende Vergangenheit richten, sondern auf die potenzielle Zukunft.
Man möge sich für einen Moment die menschliche Dimension dieser Haltung vergegenwärtigen. Wenn es dem Erwachsenen gelänge – zum Beispiel in Konfliktsituationen – nicht an dem zu hängen, was der andere in der Vergangenheit falsch gemacht oder ihm an Verletzungen zugefügt hat, sondern stattdessen im Mittelpunkt seines Bewusstseins die Möglichkeit sähe, dass der andere sich positiv entwickeln kann, wären die meisten unserer alltäglichen Konfliktsituationen unbedeutend für das praktische Zusammenleben und andererseits vielmehr Schauplätze unserer hohen menschlichen Beziehungsfähigkeit und -qualität. Wenn wir eine solche Fähigkeit soziale Kompetenz nennen, wird deutlich, dass das kleine Kind sozial hochkompetent ist. Erzieherische Ansätze, die im Mittelpunkt des pädagogischen Wirkens „Kompetenzvermittlung“ sehen, berücksichtigen diese im Kind vorhandene Kompetenz viel zu wenig.
Eine wesentliche Frage zum Verständnis des Kindes ist nun, wo diese Kompetenz herrührt. Unzweifelhaft ist sie nicht genetisch veranlagt. Denn wenn sie es wäre, wäre es völlig unverständlich, dass der Mensch sie im Laufe der Kindheit verliert.