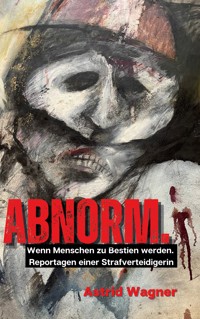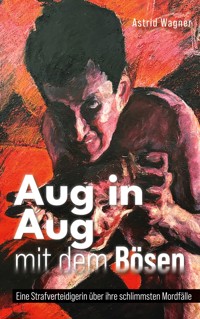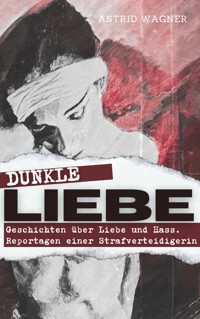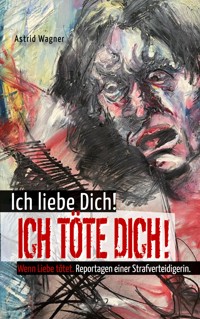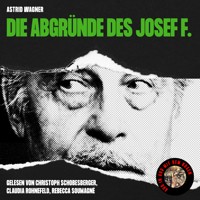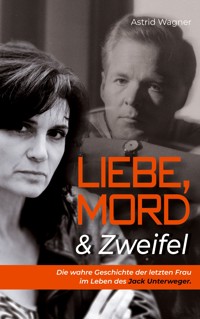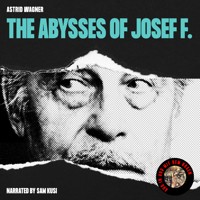Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Astrid Wagner ist Strafverteidigerin und weiß, welch grausame Gewaltspiralen Unfreiheit, Unrecht und Unterdrückung auslösen können. Anhand der Lebenswege von Menschen aus dem Nahen Osten und Österreich zeigt sie auf, wie ein jahrzehntelang schwelender, eng mit der europäischen Geschichte verwobener und immer wieder blutig ausbrechender Konflikt die Schicksale einzelner beeinflusst. Wir erfahren interessante, tragische und manchmal unfassbare Details, über die man in den etablierten Medien nichts lesen kann. Eine Kluft tut sich auf: zwischen der Lebensrealität von Menschen, die unmittelbar von Krieg, Gewalt und Tod betroffen sind, und der verzerrten Art und Weise, wie hierzulande darüber berichtet - oder vielmehr: geschwiegen - wird. Dieses Buch vermag mitzureißen, man wird es kaum aus der Hand legen können, bevor man es fertiggelesen hat. Zugleich fördern die zahlreichen Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen neue Sichtweisen zutage, die zum Nachdenken anregen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Legende der Wüste, die zum Blühen gebracht wurde
Frédéric
Der 7. Oktober
Ein Entschluss
Etwas, das Geist und Seele vergiftet
Der Wind der Geschichte hat sich gedreht
„Sollte es einen Gott geben, hat er es gut mit mir gemeint!“
„Das Gefühl, angekommen zu sein“
Palästina in der Josefstadt
Sehnsüchte, Hoffnungen, Zweifel. Die Palästinensische Gemeinde Österreich
Mechanismen von Apartheid
„Einhundert Tage Massaker“
„In Gaza schläft man nie durch“
„Der Glaube gibt uns Kraft“
„Die Entwurzelung verbindet uns“
Lebendig begraben
Poesie des Widerstands
„Verhetzung“
Das andere Israel
„Ich fühle mich wie in Israel“
Der Krieg trifft den Nerv des palästinensischen Volkes
Du hast leicht reden!
Von „Verrätern“ und Ausgestoßenen
„Bruno Kreisky hat mich geprägt“
„9/11 hat mich wachgerüttelt“
„Ich habe alle meine jüdischen Freunde verloren“
Ein Antifaschist
Terror-Sympathisanten?
Frauentag in Gaza
„Manchmal wünsche ich mir, dass uns jemand den Gnadenschuss gibt“
„Bedenken Sie, die Geschichte wird auch über Sie urteilen!“
„Blutbad“ mitten in Wien
Wo bleibt die Würde des Menschen, Herr Minister?
Topoke
„Und wir werden keine Antwort haben“
„Niemals wieder“?
„Willkommen in der Hölle“
Mit Schirmkappe, Fahne und einem Lächeln im Gesicht
Palästinafahnen am Küchenbalkon und vorm Justizpalast
„Ich fühle mich überall auf der Welt daheim“
„Pro Mensch“ – Ein Ausblick
Gegen das Vergessen
Einmal wird man fragen
Vorwort
Wie kommt eine Anwältin und Strafverteidigerin dazu, ein Buch über den „Nahostkonflikt“ zu schreiben? Sie werden sich vielleicht wundern, wenn ich Ihnen jetzt sage: Da gibt es gleich mehrere Gründe.
Wir Österreicher haben zunächst unbestreitbar einen besonderen Bezug zum Nahen Osten und dem dort seit Jahrzehnten schwelenden Kriegs- und Konfliktherd. Das liegt einerseits in unserer besonderen historischen Verantwortung im Zusammenhang mit einem der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, dem Holocaust, begründet, der letztlich die Idee einer „Heimstätte“ in Palästina für die aus Europa vertriebenen Juden befeuert hat. Und: Österreich hat einen Staatsmann wie Bruno Kreisky hervorgebracht. Er hat als einer der Ersten nicht nur erkannt, wie wichtig Palästina für den Weltfrieden ist, sondern auch: Frieden in Palästina kann es nicht ohne Gerechtigkeit für die Palästinenser geben.
Ein zweiter Grund für dieses Buch liegt darin, dass ich in meinem Beruf mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun habe. Menschen aus allen Schichten, sie kommen nicht nur aus Österreich, sondern aus balkanischen, arabischen oder afrikanischen Ländern und den verschiedensten Weltregionen. Ich rede mit diesen Menschen. Gewinne Einblicke in ihre Lebenswelten, in ihre Ängste, Sorgen, Hoffnungen und Träume. Vieles von dem, was meine Gesprächspartner mir berichten, wird man nie in den offiziellen Medien lesen. „Das habe ich ja gar nicht gewusst!“, heißt es dann oft. Deshalb habe ich beschlossen, Interviews mit Menschen aus dem Nahen Osten, aber auch aus Österreich zu führen und diese mit anderen interessierten Menschen zu teilen. Denn auch das, was außerhalb unserer Landesgrenzen geschieht, bleibt nicht ohne Auswirkungen auf uns selbst. Wir leben in einer globalisierten Welt – wenn anderswo ein Konflikt ausbricht, dann ist das ein bisschen so wie bei einem Stein, den man in ruhendes Gewässer wirft: Es entsteht Bewegung, Wellen breiten sich kreisförmig aus, werden am Ufer zurückgeworfen und überlagern sich…
Drittens: In der Jurisprudenz ist analytisches Denken gefragt. Es ist unerlässlich, um ein Problem zu erkennen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Als Strafverteidigerin suche ich immer nach den Kausalitäten: Wie konnte es so weit kommen? Was sind die Ursachen von Gewalt? Diese analytische Herangehensweise ist es, die ich in der Politik vermisse. Gerade, wenn es um den sogenannten Nahostkonflikt geht. In Deutschland und Österreich hat das politische und gesellschaftliche Establishment reflexartig Partei für Israel ergriffen. Im Irrglauben, dass diese Parteinahme einer „historischen Verantwortung“ geschuldet wäre. Welch eindimensionale, engstirnige und leider auch rassistische Denkweise – als ob Menschenrechte und Menschenwürde nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen gelten würden! Tatsächlich lautet die Lektion, die wir aus dem Holocaust zu ziehen haben: Derartiges darf sich unter keinen Umständen wiederholen. „Niemals wieder“ gilt für alle Menschen dieser Erde! Bereits dieses Postulat kann in Deutschland und Österreich zur Folge haben, als „Antisemit“ abgestempelt zu werden. Wer es dann noch wagt, nach den Ursachen jener Gewalt zu fragen, die sich am 7. Oktober 2023 mit entsetzlicher Wucht entladen hat, dem droht hierzulande zumindest gesellschaftliche Ächtung, wenn nicht gar Zerstörung der beruflichen Existenz. Dabei ist gerade bei diesem schon Jahrzehnte andauernden Konflikt eine analytische Betrachtungsweise unerlässlich, um vielleicht doch eines Tages eine Lösung zu finden. Meine Erfahrungen als Strafverteidigerin haben mich gelehrt: Die Ursache von Gewalt liegt oft in Verzweiflung. Darauf mit Gewalt zu antworten, ist keine Lösung – wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten. Man muss einen Ausweg finden aus der eskalierenden Spirale.
Ein vierter Grund liegt darin, dass es mir nach dem 7. Oktober und dem israelischen Krieg gegen Gaza so ergangen ist wie Millionen anderer Menschen weltweit: Es hat mich nicht kalt gelassen. Ich bin erschüttert darüber, dass Tausende, Zehntausende und womöglich noch Hunderttausende Unschuldige sterben müssen, während unsere westlichen Politiker jegliche Kritik an diesem Rachefeldzug als „antisemitisch“ im Keim zu ersticken versuchen und mutige junge Menschen, die dagegen protestieren, als Kriminelle abstempeln und verhaften lassen. Also habe ich begonnen, die Geschehnisse, die zweifellos von historischer Dimension sind, zu recherchieren und aufzuschreiben. Damit später einmal niemand wird sagen können: „Das habe ich ja gar nicht gewusst!“
Und schlussendlich will ich mit diesem Buch den Menschen ihre Angst nehmen. Ihre Angst davor, ihr natürliches Gerechtigkeitsempfinden zum Ausdruck bringen zu können. Immer wieder höre und lese ich von Menschen, die Angst davor haben, ihre Meinung öffentlich zu sagen, weil sie als „antisemitisch“ abgestempelt werden könnten, soziale Ächtung und Konsequenzen im Alltag fürchten. Diesen Menschen möchte ich Mut vermitteln: Habt keine Angst, wenn ihr für Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenrechte einsteht. Um es mit einem modernen Ausdruck wiederzugeben: Euer moralischer Kompass funktioniert bestens, wenn ihr Krieg und das Töten Unschuldiger verabscheut...
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch eines wissenschaftlichen Werks. Wer sich über die Geschichte und die politischen Hintergründe dieses Konflikts informieren will, dem stehen unzählige, exzellent geschriebene Fachbücher, Artikel und Dokumentationen zur Verfügung. Es ist vielmehr eine Art Tagebuch geworden, bereichert mit den Gesprächen, die ich mit palästinensischen, israelischen und österreichischen Menschen geführt habe. Ich wollte die Ereignisse im gesellschaftlichen Kontext dokumentieren, wie sie insbesondere nach Oktober 2023 weltweit und speziell im deutschsprachigen Raum stattgefunden und sich entwickelt haben. Wie in meinen vorherigen Büchern will ich meinen Lesern spannendes Leben präsentieren, zugleich aber auch Botschaften vermitteln: Dass Gewalt niemals eine Lösung ist. Dass man niemals aufgeben darf. Dass Veränderung möglich ist. Dass Mut beweist, wer verzeihen kann. Dieses Buch soll beitragen, Vorurteile zu überdenken. Wenn es nur einen einzigen Menschen dazu bringt, sein Herz zu öffnen und festgefahrene Standpunkte zu revidieren, dann hat es schon sehr viel bewirkt.
Die im Folgenden veröffentlichten Gespräche habe ich nach den Geschehnissen des 7. Oktober 2023 geführt. Jene Interviewpartnerinnen und -partner, die nicht im öffentlichen Interesse stehen, habe ich nur beim Vornamen genannt beziehungsweise diesen zudem verändert. Die Meinungen der interviewten Personen müssen nicht mit meiner eigenen Sichtweise übereinstimmen. Ich habe mich bei Wertungen bewusst zurückgehalten.
Drei Klarstellungen vorweg:
Am 7. Oktober 2023 sind unschuldige Menschen zu Tode gekommen. Jegliche Form von Gewalt ist zu verurteilen, wenn sie sich gegen Unschuldige richtet. Und doch müssen die Ereignisse dieses Tages im historischen Kontext der jahrzehntelangen Unterdrückung des palästinensischen Volkes gesehen werden. Wie auch der Titel dieses Buches zum Ausdruck bringen soll, begann die Geschichte der Gewalt in Palästina nicht erst an jenem 7. Oktober und waren die Toten jenes Tages nicht die ersten, welche dieser Konflikt gefordert hat. Der Blutzoll, den die unschuldige palästinensische Zivilbevölkerung in den Jahren und Jahrzehnten zuvor hat erbringen müssen, darf nicht länger totgeschwiegen und verdrängt werden.
Ich bekenne mich zu jenen Werten, in deren Geiste ich erzogen wurde: Demokratie, Freiheit und Gleichberechtigung. Ich bekenne mich zu einem Land, in dem alle Bürger ungeachtet ihrer Herkunft, Ethnie und Religion gleichberechtigt leben dürfen.
Eine dritte, nicht minder wichtige Klarstellung lautet: Berechtigte Kritik am israelischen Staat ist kein Antisemitismus. Meine Gespräche mit Jüdinnen und Juden haben vielmehr zutage gebracht, dass viele von ihnen sich nicht mit diesem israelischen Staat und dessen Politik identifizieren.
Astrid Wagner, im September 2024
Die Legende der Wüste, die zum Blühen gebracht wurde
Ich glaube, die Natur hat mich mit einem Quäntchen zu viel von dem ausgestattet, was man früher „Mitgefühl“ nannte. Heute bezeichnet man solche Menschen als empathisch: Als Kind konnte ich tagelang wegen des Todes eines Vogels betrübt sein. Ich litt mit den Straßenkatzen, die es an unserem damaligen Wohnort bei Paris zuhauf gab. Ich denke heute noch an den geistig behinderten Buben, den die anderen gemieden hatten. Ich wollte ihn zum Mitspielen einladen, doch ein Erwachsener erklärte mir: Lass den, der ist nicht normal.
Ich habe wohl auch ein Quäntchen zu viel von dem mitbekommen, was manche „Gerechtigkeitssinn“ nennen. Mein bester Freund aus der ersten Klasse Volksschule war ein Bub aus einer armen Familie, der von den anderen wegen seiner zerschlissenen Schultasche gehänselt wurde. Ich habe ihn verteidigt. Und natürlich war ich beim Spielen immer auf Seiten der „Indianer“, obwohl in den Filmen – mit der Ausnahme von Winnetou1 – die „Weißen“ als die Helden dargestellt wurden, im Gegensatz zu den „bösen Rothäuten“.
Und dann ist da dieses Revoluzzer-Gen, mit dem ich mir heute noch mitunter Probleme einhandle. Ich war vierzehn und mitten in der Pubertät, als es so richtig ausgebrochen ist. Es fiel mit der Zeit meines politischen Erwachens zusammen: Ich begann mich für das zu interessieren, was in der großen weiten Welt vor sich ging. Eine Welt, die damals für mich ziemlich weit weg schien, denn nach Aufenthalten in Wien und Paris lebte meine Familie inzwischen im beschaulichen Kleinstädtchen Fürstenfeld in der Oststeiermark, wo mein Vater zum Direktor eines neu gegründeten Thermalbades berufen worden war. Mein Vater war ein kaufmännisch talentierter, studierter Ökonom, darüber hinaus durch sein Studium in den USA und viele Auslandsaufenthalte von Russland bis Nordafrika sehr polyglott. Sein offenkundiges Interesse an Fragen der Weltpolitik zeigte sich an unserer Hausbibliothek, die auch mit politischen und gesellschaftskritischen Büchern verschiedener Sprachen bestückt war. Eines der Bücher hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt: Am auffälligen Cover prangte ein Hakenkreuz neben einem Davidstern, der Titel lautete I cannot forgive. Das Buch schilderte die dramatische Flucht eines deutschen Juden aus dem Vernichtungslager Auschwitz. Ich habe es regelrecht verschlungen, auch weil ich die klare Schönheit der englischen Sprache schon immer liebte.
Dann kam der „heiße Herbst“ des Jahres 1977. Deutschland wurde von der Terrorwelle der linksradikalen Rote Armee Fraktion (RAF) überrollt. Der Höhepunkt war die Entführung des Lufthansa-Urlaubsfliegers Landshut durch vier palästinensische Terroristen, die damit deutsche Gesinnungsgenossen aus dem Gefängnis freipressen wollten. Die spektakuläre Entführung beherrschte tagelang die Schlagzeilen, war Gesprächsthema Nummer eins unter den Menschen, und natürlich verurteilten alle den Terror aufs Schärfste. „Die Israelis wissen, wie man kurzen Prozess mit diesen Terroristen macht“ – diese Bemerkung meines Vaters ist mir in Erinnerung geblieben.
Die „Terroristen“, das waren die Palästinenser. In diesem „heißen Herbst“ hatte ich zum ersten Mal von ihnen gehört. Glaubte man den Medien, so agierten diese Palästinenser in mannigfaltigen „terroristischen“ Gruppierungen. Der blumige Name Schwarzer September ist mir im Gedächtnis geblieben: Eine Terrororganisation, die als Drahtzieher zahlreicher Attentate in den siebziger Jahren gilt.
Anführer der Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), die in den Medien stets als „linksextreme Terrororganisation“ tituliert wurde, sollen darin involviert gewesen sein. Ich las über Leila Khaled, die junge Palästinenserin, die als Angehörige eines Kommandos ein Flugzeug gekapert und in die Luft gesprengt hatte – freilich erst, nachdem die Passagiere ausgestiegen waren.
Eine zentrale Figur war der stets im olivgrünen Drillichanzug und Kufiya-Tuch auftretende und spätere Vorsitzende der Palestine Liberation Organization (PLO) Yassir Arafat, der einst die palästinensische Fatah2 gegründet hatte. Eine Organisation, die für zahlreiche terroristische Anschläge und Bombenattentate auf israelische und jordanische Ziele verantwortlich gemacht wurde.
Ich begann, mir Fragen zu stellen: Kann es sein, dass Menschen als „Terroristen“ geboren werden? Dass ein ganzes Volk mit einer Art „Terror-Gen“ ausgestattet ist?
Ich begann nachzuforschen und alles zu lesen, was ich zum Thema Palästina finden konnte. Es war nicht leicht, die Quellen waren spärlich. Damals gab es noch kein Internet. Man war auf das angewiesen, was im „Mainstream“ veröffentlicht wurde.
Bei einem Ausflug in Graz entdeckte ich eine alternative Buchhandlung, den Namen habe ich vergessen, und wurde fündig. Mein im Geschichtsunterricht vermitteltes Bild geriet ins Wanken: Wir hatten gelernt, dass der Staat Israel nach dem Zweiten Weltkrieg als Heimstatt für die in Europa verfolgten Juden gegründet worden war. In einer Wüste, die dank der Tüchtigkeit der jüdischen Siedler wie durch ein Wunder fruchtbar gemacht worden wäre: „Sie haben die Wüste zum Blühen gebracht“, lautete einer der Standardsätze. Ökologische Aspekte spielten damals freilich noch keine Rolle: Das 1953 begonnene Großprojekt des „National Water Carrier“, der ganz Israel mit Wasser aus dem See Genezareth versorgt, ist die Hauptursache für die Austrocknung des Jordanflusses und des von diesem gespeisten Toten Meeres. Ein anderer Stehsatz, der uns eingebläut wurde, lautete: „Palästina war ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land.“
Und nun, mit knapp vierzehn Jahren, erfuhr ich aus Büchern und Zeitschriften, die ich in der alternativen Buchhandlung erworben hatte, erstmals von der „Nakba“, was auf Arabisch „Katastrophe“ bedeutet.
Die Geschichte war offenbar doch nicht so schön und rund, wie man uns in der Schule weismachen hatte wollen. Palästina war schon vor der Ausrufung des Staates Israel bewohnt gewesen – von den Palästinensern! Ein arabischsprachiges Volk von sesshaften Kleinbauern, Händlern und einigen Beduinenstämmen.3 Die meisten waren moslemischen Glaubens, viele aber auch orthodoxe Christen, einige wenige bekannten sich zum Judentum. Als aber der Nazi-Terror in Europa ausbrach, flohen von dort zusehends Juden nach Palästina. Sie wurden von den Einheimischen wie Brüder und Schwestern empfangen und bereicherten die multireligiöse und multikulturelle Vielfalt dieses vom Geist der britischen Kolonialmacht geprägten Landes.
Ich las erstmals über die Zionisten, wie sich jene Juden aus Europa nannten, die in diesem Palästina ihr „gelobtes Land“ erblickten. Ein Land, welches ihrer Ideologie zufolge nicht den einheimischen Palästinensern gehören sollte, sondern für alle Zeiten untrennbar und ausschließlich mit der „jüdischen Nation“ verwoben wäre. Ich las über die blutigen Terrorakte, mit der diese aus Europa gekommenen Zionisten die einheimische Bevölkerung zusehends in Angst und Schrecken versetzten. Denn Menschen nichtjüdischer Herkunft sollten der Ideologie des Zionismus zufolge freilich keinen Platz mehr in diesem Land haben.
Ein Höhepunkt war der Terroranschlag auf das King-David-Hotel in Jerusalem durch die zionistische Untergrundorganisation Irgun, dem einundneunzig Menschen zum Opfer fielen. Der Irgun-Kommandeur Menachem Begin wurde später israelischer Regierungschef und erhielt den Friedensnobelpreis.4 Ich las über die „Balfour-Deklaration“, betrachtete die von der britischen Kolonialmacht ausgearbeiteten Teilungspläne, und für mich war klar, dass sie die arabische Urbevölkerung benachteiligten.
Die Ausrufung des Staates Israel im Mai 1948 war kein Heldenepos gewesen, wie man uns in der Schule hatte weismachen wollen. Sie war mit viel Leid und Blutvergießen einhergegangen. Namen wie Deir Yassin oder Tantura kamen mir unter. Arabische Dörfer, in denen paramilitärische zionistische Einheiten blutige Massaker unter der Bevölkerung angerichtet hatten. Mehr als siebenhunderttausend arabische Palästinenser waren geflohen oder vertrieben worden, ihre Dörfer mit den Olivenhainen dem Erdboden gleichgemacht, um darauf moderne israelische Städte zu bauen.5 Seitdem, so erfuhr ich, leben die Palästinenser in der Diaspora und, vor allem in den arabischen Nachbarstaaten, unter erbärmlichen Bedingungen in Lagern. Bürgerrechte wurden und werden ihnen dort weitgehend verweigert, was mit einem „Rückkehrrecht nach Palästina“ begründet wird. Ich las über heute längst vergessene Menschen, wie den Offizier und Philanthropen Graf Folke Bernadotte. Er hatte im Zweiten Weltkrieg Zehntausende KZ-Häftlinge gerettet, darunter Tausende Juden. 1948 hatte er sich als Vermittler der Vereinten Nationen für ein Rückkehrrecht der Palästinenser in ihre Heimat eingesetzt. Daraufhin war er von Zionisten ermordet worden. Die Drahtzieher des Mordanschlags erhielten von der jungen israelischen Regierung eine Generalamnestie. Was das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge betrifft, so wird ihnen dieses von Israel bis heute verweigert.
Jene kleine Minderheit von Palästinensern, welche im neu gegründeten Israel verblieben war, fühlt sich gegenüber der neuen Mehrheitsbevölkerung diskriminiert. Die „arabischen Israelis“ sehen sich in ihrer kulturellen und ethnischen Identität in diesem prononciert jüdischen Staat unter der Flagge des Davidsterns nicht repräsentiert und sind vom Wehrdienst ausgeschlossen. Im Zuge des „Sechs-Tage-Kriegs“ 1967 hatte Israel jedoch weitere Gebiete erobert, den Gazastreifen und das Westjordanland. Die dort ansässigen Palästinenser leben seitdem unter dem Militärregime einer Besatzungsmacht.6 Mir kam ein Buch von einem jungen israelischen Journalisten unter, das ich geradezu verschlungen habe. Er hatte sich – ähnlich wie Günter Walraff in Ganz unten – als Palästinenser aus den besetzten Gebieten ausgegeben und so am eigenen Leib erfahren, wie diese Menschen in Israel behandelt werden: Ohne Arbeitsbewilligung angewiesen auf den illegalen „Arbeitsstrich“, ausgebeutet für Drecksarbeiten, um den Lohn geprellt, rechtlos. Denn die Palästinenser in den besetzten Gebieten unterliegen nicht der zivilen Gerichtsbarkeit, sondern der Militärgerichtsbarkeit der Besatzungsmacht. Der Journalist hatte sogar den Mumm, als vermeintlicher Palästinenser mit dem typischen Kufiya-Tuch bei einem „Kibbuz“ anzuheuern – ihm schlug, so schrieb er, eine Mischung aus Unglauben und Verachtung entgegen. Aus dem Buch habe ich auch erfahren, dass jüdisch-arabische „Mischehen“ in Israel unerwünscht sind, weil gemäß der zionistischen Ideologie die jüdische Nation „rein“ bleiben müsste. Wenn sich jüdische Frauen in palästinensische Männer verlieben, werden sie oft von ihrer Herkunftsfamilie geächtet. Leider habe ich den Titel dieses wirklich packend geschriebenen, wohl längst vergriffenen Buches vergessen. So wie viele der anderen, die ich damals zum Thema gelesen hatte.
Und dann war da noch der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky (1911–1990), dessen Äußerungen mich in meiner Haltung bestärkten: Als Jude war ihm das Schicksal des palästinensischen Volkes stets ein Herzensanliegen gewesen. Kreisky sprach sich dafür aus, dass Europa eine Vermittlerrolle im Nahen Osten spielen sollte und befürwortete als einer der ersten westlichen Politiker die Schaffung eines eigenen Staates Palästina.
Meine Augen waren geöffnet und meine Sinne sensibilisiert für das, was in Palästina und Israel geschehen war, geschah und noch geschehen sollte.
1 Heute distanziere ich mich von der Romantisierung des Schicksals der durch Vertreibung, Kriege und Krankheiten ausgerotteten amerikanischen Ureinwohner.
2 Fatah ist ein Akronym für Bewegung zur nationalen Befreiung Palästinas („Ḥarakat at-Taḥrīr al-waṭanī al-Filasṭīnī“).
3 Die 1948 von der israelischen Armee vertriebene beduinische Bevölkerung Palästinas lebte damals nur noch halbnomadisch (Wikipedia).
4 Ein ausführlicher Bericht von Dieter Reinisch über die damalige zionistische Terrorwelle ist in der Wiener Zeitung vom 18.7.2021 nachzulesen.
5 Insgesamt sind im „Palästina-Krieg“ zwischen 400 bis 600 palästinensische Dörfer von israelischen Paramilitärs wie Haganah, Irgun und Lechi zerstört worden. Dorfbrunnen wurden vergiftet, palästinensisches Eigentum geplündert. Die Orte erhielten neue, hebräische Namen und wurden von jüdischen Bewohnern übernommen; Quelle unter anderem Wikipedia. Erst kürzlich wurde publik, dass zum Beispiel der israelische Badeort Dor Beach auf einem Massengrab errichtet worden war, in das 40 bis 200 ermordete Bewohner des Fischerdorfes Tantura geworfen worden waren (The Guardian, 25.5.2023).
6 2005 erfolgte zwar der offizielle Abzug Israels aus dem Gazastreifen, dennoch ist das Land wirtschaftlich bis heute vollkommen von Israel abhängig. Die Gründe dafür werden in diesem Buch aufgezeigt werden.
Frédéric
Mein bester Jugendfreund war der Sohn eines jüdischen Vaters. Ich hatte Frédéric durch Vermittlung eines gemeinsamen Lehrers nach der Übersiedlung unserer Familie aus Frankreich nach Österreich kennengelernt. Jeden Sommer verbrachte ich zumindest einen Monat bei ihm in Le Vésinet bei Paris, wo auch wir gelebt hatten, um mein Französisch zu bewahren. Zu Weihnachten kam er dann zu uns nach Österreich, um Deutsch zu lernen. Er war ein ungewöhnlich intelligenter, belesener junger Mann, doch in keiner Weise eingebildet. Unser österreichischer Dialekt gefiel ihm, und bald nahm er ihn an. Ob sein Deutsch-Professor in Frankreich damit eine Freude hatte?
Frédérics jüdischer Vater war ein warmherziger Mensch mit viel Humor. Er hatte ein rundes, fröhliches Gesicht, wellige rötliche Haare und trug den in den achtziger Jahren modernen Schnauzer. Wie oft ist er vor dem Fernseher in Gelächter ausgebrochen, weil gerade ein lustiger Film lief! Frédéric verdrehte dann oft die Augen, als ob ihm sein kindischer Vater ein wenig peinlich wäre. Die katholische Mutter war gleichsam der Gegenpol. Eine zarte, zurückhaltende, fast schon spröde Frau, die nur selten lächelte. Und dann gab es noch die beiden Omas. Die mütterliche hatte einen etwas mürrischen Zug um den Mund und wurde mit der Zeit immer wunderlicher, bis sie an Demenz erkrankte. Frédérics Lieblingsoma war aber die jüdische, sie lebte in einem kleinen, privaten Altersheim. Trotz ihrer Gebrechlichkeit und vieler Beschwerden strahlte sie eine gelassene Heiterkeit aus, wenn wir sie besuchten. An einem warmen Abend trug sie kurze Ärmel und ich sah die eintätowierte Nummer an ihrem Unterarm7…
Die Familie war nicht reich, sie lebte von den bescheidenen Einkünften des kleinen Foto-Ladens, den der Vater in Paris führte, und von den wunderschönen Strickarbeiten, die seine Mutter anzufertigen wusste. In der kleinen Hausbibliothek fand sich allerlei Literatur über Israel. Viele dicke, reich bebilderte Wälzer, welche die Geschehnisse aus einer die Staatsgründung verherrlichenden „Heldenepos“-Perspektive wiedergaben. Es war aber auch ein Buch darunter, welches mir ein komplexeres Bild von diesem Israel aufzeigte. Es machte mir klar, dass der „Judenstaat“ gar nicht so homogen ist, sondern in Wirklichkeit aus sehr unterschiedlichen „Völkern“ besteht: Da sind die aus Europa gekommenen „Gründerväter“, die das Land nach ihren Vorstellungen aufgebaut hatten. Dann die „Mizrahim“, die erst in den fünfziger und sechziger Jahren aus arabischen Ländern eingewandert waren und von dort ihre orientalischen Gebräuche mitgebracht hatten. Sie fühlten sich diskriminiert gegenüber den „weißen“ Juden aus Europa. All diese Menschen hatten ursprünglich natürlich auch verschiedenste Sprachen gesprochen, vom Arabischen bis zum osteuropäischen Jiddisch. Im Sinne der Vision eines einheitlichen „jüdischen Volkes“ hatte der Zionismus die Sprache der Thora, das Hebräische, wieder zum Leben erweckt: Freilich fehlen dieser uralten Sprache viele Wörter für Begriffe, die in biblischen Zeiten noch nicht vorhanden waren. Die Lücken wurden im nunmehrigen „Neu-Hebräisch“ mit arabischen Lehnwörtern ausgefüllt. Und doch sind auch die Zionisten keine homogene Gruppe: Neben den säkularen gibt es die religiösen Zionisten mit ihrer radikalen Forderung nach einem „Eretz Israel“, das vom Nil bis zum Euphrat reichen soll, mit Jerusalem als Hauptstadt. Dass auch Moslems und Christen dort ihre heiligen Stätten haben, spielt für diese fundamentalistischen Zionisten keine Rolle. Die Juden sind nach ihrer Vorstellung das von Gott „auserwählte Volk“, und der habe ihnen dieses Land versprochen…
Je länger ich mich mit der Thematik befasste, desto klarer wurde es mir: All dieses Chaos und das damit einhergehende Leid sind die Hinterlassenschaften der europäischen Kolonialpolitik, mit ihrer zutiefst arroganten Sichtweise von der Überlegenheit ihrer Werte. Den Palästinensern war es nicht anders ergangen als den Völkern Afrikas, den Aborigines Australiens oder der weitgehend ausgerotteten indigenen Urbevölkerung Amerikas…
***
Im September 1982 weilte ich gerade wieder bei meiner französischen Gastfamilie. Wenige Monate zuvor hatte ich die Matura hinter mich gebracht, und das Semester an der Uni begann erst im Oktober. Ich werde es nie vergessen, wie Frédérics Vater ins Wohnzimmer stürmte mit den Worten: „On a découvert une hécatombe a Beyrouth!“ Was auf Deutsch bedeutet, dass es in der libanesischen Hauptstadt Beirut ein Massaker gegeben habe. Frédéric reagierte verwirrt, fragte nervös nach: „Les paléstiniens ont commis un massacre?“ Er dachte wohl im allerersten Augenblick, dass es wieder einmal darum ging, den Palästinensern irgendwelche Gräueltaten in die Schuhe zu schieben, oder dass vielleicht einer von ihnen Amok gelaufen war und einen terroristischen Anschlag verübt hatte, was weiß ich. Die Stimmung in meiner Gastfamilie war jedenfalls sehr aufgeregt.
Die Namen haben sich wohl im kollektiven Gedächtnis der Palästinenser eingebrannt, hierzulande sind sie längst vergessen:
Sabra und Shatila. Zwei große palästinensische Flüchtlingslager in Beirut, die im Zuge der israelischen Invasion des Libanons eingenommen und besetzt worden waren. Nachdem sie die Männer im wehrfähigen Alter verhaftet hatte, ließ die israelische Armee eine vom europäischen Faschismus inspirierte Gruppe von „christlichen Falangisten“ ungehindert in die Lager eindringen. Die Falangisten hassten die palästinensischen Flüchtlinge, die so viel Unruhe in die einstige „Schweiz des Nahen Ostens“, wie der Libanon früher genannt wurde, gebracht hatten. Sie sahen in ihnen den Auslöser des Bürgerkriegs und waren überzeugt, dass das kürzlich mit einer Autobombe verübte Attentat auf ihren Anführer auf das Konto der verhassten PLO gegangen wäre. Innerhalb von nur achtunddreißig Stunden wurden mehr als 3.000 Palästinenser in Sabra und Shatila ermordet, vergewaltigt, verstümmelt. Frauen, Kinder, alte Männer, schutzlos ihren Feinden ausgeliefert nach der Verhaftung ihrer Wehrfähigen. Während des Mordens hielt die israelische Armee rund um die Lager Wache. Augenzeugen berichteten sogar davon, dass die Israelis Bulldozer in die Lager gelassen hätten, um Erde auf die Körper der Ermordeten zu schütten…
Frédéric empfand angesichts dieser Geschehnisse so wie ich: Abscheu, Entsetzen, Zorn.
Wenig später kehrte ich nach Österreich zurück. Hier waren die Schlagzeilen vor allem vom Tod der monegassischen Fürstin Gracia beherrscht, die nur einen Tag vor dem Massaker bei einem Autounfall verstorben war.
7 Im Konzentrationslager Auschwitz wurden den Häftlingen Nummern in die Unterarme tätowiert, um sie identifizieren zu können.
Der 7. Oktober
Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Heute bin ich erfolgreiche Anwältin in Wien. Das habe ich übrigens Frédéric zu verdanken. Er war immer eine Art Vorbild für mich gewesen, und als er sich in Frankreich für das Jus-Studium entschieden hatte, beschloss ich ein Jahr später, es ihm in Österreich gleichzutun. Wir blieben in Kontakt, bis mich im Herbst 1990, wenige Wochen nach Abschluss meines Studiums, die traurige Nachricht von seinem Ableben erreichte. Er wurde nur achtundzwanzig Jahre alt.
***
In Palästina herrschte Anfang der 90er Jahre Aufbruchsstimmung. Mit der Unterzeichnung des ersten Oslo-Abkommens zwischen der PLO und Israel im September 1993 war ein Friedensprozess in Gang gesetzt worden, der in der Gründung eines eigenen Palästinenserstaates neben Israel münden sollte. Federführend auf israelischer Seite war der 1992 ins Amt berufene Ministerpräsident Jitzchak Rabin. Mit seiner Vision machte er sich freilich nicht nur Freunde. Die rechtsgerichteten, religiösen Zionisten und die „Siedler“, die auf den Hügeln der besetzten Gebiete ihre festungsähnlichen Städte errichtet hatten, machten Rabin zu ihrer Hassfigur. Der 4. November 1995 markiert ein jähes Ende der Aufbruchsstimmung: An diesem Tag wurde Rabin von einem fanatischen Zionisten erschossen. Mit ihm starb wohl für lange Zeit die letzte Hoffnung auf Frieden in der Region. Die radikalen Kräfte gewannen Oberhand. Auf beiden Seiten: Die Palästinenser wandten sich zusehends von der politisch erfolglosen, säkulären PLO ab. Zu sehr hatten sich einige Funktionäre in Korruption verstrickt, hatten sich bereichert, das Volk fühlte sich verraten. Die Enttäuschung trieb die Palästinenser in die Arme islamistischer Kräfte wie der Hamas.8
Der extrem rechtsgerichtete Benjamin „Bibi“ Netanjahu hatte sich von Anfang an als erbitterter Widersacher von Jitzchak Rabin positioniert. Netanjahu hatte in der israelischen Politik seit Jahrzehnten eine gewichtige Rolle gespielt, 2009 wurde er mit Unterstützung der religiösen Zionisten zum zweiten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt.
Seitdem ist er mit einer kurzen Unterbrechung im Amt. Er hat das Land Israel geprägt wie kaum einer zuvor. Leider nicht auf eine Weise, die zu dauerhaftem Frieden führen würde. Vor allem in den besetzten Gebieten wird die Situation immer unerträglicher: Jüdische Siedler beanspruchen immer mehr palästinensisches Land. Enteignung, willkürliche Kontrollen, Mauern und Sperranlagen prägen den Alltag der einheimischen Bevölkerung. Ein Familienvater braucht oft stundenlang zu seiner nur wenige Kilometer entfernten Arbeitsstelle, weil er zahllose militärische Checkpoints passieren muss. Es sind die Steine werfenden Kinder und Jugendlichen, die als erste gegen die Besatzung aufbegehren.
Sie werden dafür ins Gefängnis gesteckt, oft für Jahre. Die erste Intifada entsteht, Jahre später die zweite. Die Aufstände werden mit aller Brutalität von der israelischen Armee niedergeschlagen. 2018 wird das von Netanyahu als „historisch bedeutend“ bezeichnete Nationalstaatsgesetz verabschiedet, das Israel ausdrücklich als jüdischen Staat definiert, dessen offizielle Amtssprache ausschließlich Hebräisch ist. Die Förderung der jüdischen Besiedlung wird zum nationalen Ziel erklärt.9
***
Die Auswirkungen der Geschehnisse in Palästina reichen bis zu uns nach Europa. Als Anwältin vertrete ich einige staatenlose Palästinenser, verhelfe ihnen zu legalen Aufenthaltstiteln in Österreich. Mit Interesse vernehme ich die Familiengeschichte einer jüdischen Klientin: Ihre Eltern waren 1948 aus dem Jemen nach Israel eingeflogen worden – voller freudiger Erwartung auf das Land, in dem der Überlieferung nach Milch und Honig fließen würden. Es waren Menschen, die bis dahin weitgehend unberührt von der Zivilisation gelebt hatten. Zum Schrecken des Piloten machten sie Anstalten, ein kleines Lagerfeuer im Flieger zu bereiten – das Vorhaben konnte im letzten Moment gestoppt werden…
Eine amüsante Anekdote, mehr nicht. Ich verfolge den sogenannten Nahostkonflikt nur am Rande. Im Gedächtnis haften bleibt der 2008 veröffentlichte Dokumentarfilm Das Herz von Dschenin. Er handelt von einem Vater, der das Herz seines von israelischen Soldaten durch einen Kopfschuss getöteten, zwölfjährigen Sohnes einem kranken jüdischen Kind spendet. Berührende Kino-Momente, doch tags darauf hat mich der Anwaltsalltag wieder. Das, was im Nahen Osten geschieht, scheint ganz weit weg zu sein.
***
Bis zum 7. Oktober 2023. Ausgangspunkt ist Gaza, jener kleine Landstrich am Mittelmeer, wo rund 2,3 Millionen Menschen auf einem Gebiet von nur dreihundertfünfundsechzig Quadratkilometern leben. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge, die im Zuge der „Nakba“ aus ihren Dörfern vertrieben worden waren. 1967 hatte Israel den damals von Ägypten kontrollierten Küstenstreifen im Zuge des Sechs-Tage-Kriegs erobert und jahrzehntelang besetzt. Nach der ersten Intifada hatte Israel Anfang der 1990er Jahre mit der Abgrenzung des Gazastreifens begonnen, indem etwa die Fischereigrenzen reduziert, die Ein- und Ausfuhren von Waren und der Personenverkehr eingeschränkt wurden. 2005 zog sich Israel im Zuge des Oslo-Friedensprozesses militärisch aus Gaza zurück, auch die israelischen Siedlungen wurden unter heftigen, zum Teil gewaltsamen Protesten der Siedler aufgelöst. Gaza wurde unter die Verwaltung der palästinensischen Autonomiebehörde gestellt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen und weiterhin bestehenden wirtschaftliche Beschränkungen durch Israel trugen freilich dazu bei, dass Armut und soziale Spannungen weiterhin anstiegen. Bei den Wahlen im Januar 2007 setzte sich die als islamistisch eingestufte Hamas gegen ihre Rivalin, die gemäßigte und säkulare, aber von vielen als korrupt betrachtete Fatah durch. Es entflammte ein mehrtägiger Bürgerkrieg, den Hamas für sich entschied. Israel hatte das Erstarken der Hamas anfangs als durchaus begrüßenswerte Entwicklung beobachtet, war sie doch mit der Schwächung der Fatah einhergegangen. Damit war jetzt Schluss, bekannte sich Hamas doch öffentlich zur Vernichtung des Zionismus. Israel reagierte auf die Machtübernahme der Hamas mit der Errichtung einer totalen Blockade des Gazastreifens nach dem Prinzip „kein Wohlstand, keine wirtschaftliche Entwicklung, aber auch keine humanitäre Krise“.10 Gaza wurde zu einem einzigen Freiluftgefängnis, dessen Bewohner in ihren elementaren Bedürfnissen wie Wasser, Strom oder Treibstoff auf Israel angewiesen sind und ohne Sondergenehmigungen weder ein- noch ausreisen dürfen.
In diesem Klima der Hoffnungslosigkeit war nun in Gaza eine junge Generation herangewachsen, die für sich offenbar keine andere Perspektive mehr sieht als: Revolte. „In Gaza muss das Gras gemäht werden“ – mit solchen Worten rechtfertigen israelische Politiker ihre regelmäßig stattfindenden, als Strafsanktionen deklarierten Militäroperationen in Gaza, denen inzwischen schon tausende palästinensische Zivilisten zum Opfer gefallen sind. Die Hamas, die Gaza seit 2007 ununterbrochen regiert, wird von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft, weil sie sich in ihrer Charta die Zerstörung des Staates Israel auf die Fahnen geheftet hätte. Allerdings: In einem von der Hamas im Jahr 2017 veröffentlichten Strategiepapier wird ein Staat Palästina „in den Grenzen von 1967“11 als „nationaler Konsens“ genannt.12
An diesem 7. Oktober 2023, der in die Weltgeschichte eingehen sollte, durchbrechen Hamas-Kämpfer an zahlreichen Stellen die mit Überwachungskameras und modernster Sicherheitstechnik hochgerüstete, insgesamt fünfundsechzig Kilometer lange und bis zu acht Meter hohe „eiserne Mauer“,13 die Gaza von Israel trennt. Sie dringen tief in israelisches Staatsgebiet ein und verursachen ein unfassbares Blutbad unter unbeteiligten Zivilisten, darunter auch zahlreiche Minderjährige. Die Lage ist chaotisch und unübersichtlich, in den ersten Tagen spricht Israel von 1.500 Todesopfern. Eine Zahl, die später nach unten korrigiert wird, was an der barbarischen Grausamkeit freilich nichts ändert.
Israel reagiert, wie es immer schon reagiert hat: Gnadenlos. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant lässt verlautbaren: „Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Treibstoff, kein Wasser, alles ist abgeriegelt. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln demensprechend.“14 Wochenlang fallen unzählige israelische Bomben auf den schmalen Landstrich am Mittelmeer. Spitäler werden ebenso getroffen wie Schulen, Moscheen und Kirchen, laut Human Rights Watch und Amnesty International sollen dabei auch Phosphorbomben zum Einsatz gekommen sein.15 Eine humanitäre Katastrophe unfassbaren Ausmaßes nimmt ihren Lauf. Die Spitäler haben längst keinen Strom mehr, die schwerkranken Menschen gehen ebenso elend zugrunde wie die Babys in ihren Brutkästen. Wie Vieh werden die Flüchtenden durchs Land getrieben, doch nirgendwo sind sie sicher vor dem gnadenlosen Bombardement. „Wir werfen hundert Tonnen Bomben auf Gaza. Der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht Genauigkeit“, verkündet der Sprecher der israelischen Armee.16
Zur gleichen Zeit werden auch in dem von Israel besetzten, von Betonmauern, Sperranlagen und israelischen Siedlungen durchzogenen Westjordanland mehr als einhundert Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen. Weil sie es gewagt hatten, gegen die Schikanen, denen sie täglich an den Checkpoints ausgesetzt sind, zu protestieren oder sich gegen den Landraub der zionistischen „Siedler“ gewehrt hatten. Kinder und Jugendliche, die Steine gegen das israelische Militär werfen, werden verhaftet, misshandelt, manchmal erschossen.
„Erst wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben als sie uns hassen, wird der Krieg ein Ende haben“, hatte die israelische Premierministerin Golda Meir einst gesagt. Ein unverhohlen rassistisches Narrativ, das in den westlichen Medien jetzt wieder tausendfach zitiert wird. Terroristen würden sich demnach „hinter der Zivilbevölkerung verschanzen“, weshalb man die „unverhältnismäßige Zahl an zivilen Opfern bedauerlicherweise als Kollateralschaden in Kauf nehmen“ müsste. Immer wieder wird betont, dass „Hamas und nicht Israel den Krieg begonnen“ habe, die jahrzehntelange Vorgeschichte wird außer Acht gelassen. Das Mitleid gilt ausschließlich den verschleppten israelischen Geiseln, den Ereignissen des 7. Oktober wird breiter Raum gewidmet. Die Tausenden Opfer in Gaza hingegen, sie bleiben anonym. Keine Bilder, keine Geschichten, keine Schicksale. Fast scheint es, als dass diese Toten selbst schuld an ihrem grausamen Tod wären…
In den jungen sozialen Medien wie Instagram jedoch wird man mit Bildern von schwer verletzten, toten und verstümmelten Menschen aus Gaza überflutet. Die Stadt Gaza besteht bald nur mehr aus einem Haufen von Trümmern, zwischen denen verzweifelte Menschen und halbverhungerte Katzen kriechen.
Unsere westlichen Politiker sehen diese Bilder offenbar nicht. Sie schwören der israelischen Regierung ihre unverbrüchliche Treue. Auf allen offiziellen Gebäuden Europas flattern israelische Flaggen. Reden werden gehalten: „Wir sind alle Israelis!“, tönt die deutsche Außenministerin, und der deutsche Bundeskanzler erklärt entschlossen: „Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson.“ Gerade in Deutschland und Österreich wird der bedingungslose Schulterschluss mit Israel mit einer „besonderen historischen Verantwortung“ begründet. „Nie wieder!“ lautet das mahnende Schlagwort – als ob Menschenrechte nicht für alle Menschen dieser Welt gelten würden… Nur sehr wenige europäische Politiker erheben ihre Stimme gegen das Massaker. Es sind vor allem irische Politiker, die das Morden in Gaza aufs Schärfste verurteilen, wie etwa der irische Abgeordnete Richard Boyd Barrett. Die israelkritische Haltung in Irland hat insofern Tradition, als die lange Zeit verfolgten und diskriminierten Katholiken im britischen Nordirland sich mit den verfolgten Palästinensern identifizierten. Deutliche Worte unter den westlichen Politikern findet auch der ehemalige griechische Minister Yanis Varoufakis. Er spricht offen von einem sich abzeichnenden „Völkermord“ und fragt: „Wo war der Aufschrei jener, die nun die Gräueltaten der Hamas in den Fokus ihrer Empörung und Betroffenheit stellen, bei den Toten auf palästinensischer Seite vor dem 7. Oktober?“ In der Tat zählt das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten für die Zeit von Januar 2008 bis August 2023 insgesamt 6.399 palästinensische und 308 israelische Todesopfer sowie 152.142 palästinensische und 6.299 israelische Verletzte. Jeder Tote und jeder Verletzte ist einer zu viel, aber diese Zahlen mögen die Ereignisse vom 7. Oktober doch in ein etwas anderes Licht rücken…
Das, was gerade in Palästina passiert, ist, so scheint es, längst zu einer globalen Allegorie geworden: Es geht um koloniales Denken, den arroganten Anspruch einer vermeintlichen kulturellen Überlegenheit, der offenbar immer noch in den Köpfen westlicher Politiker spukt. Die Geschehnisse lassen den schwelenden Nord-Süd-Konflikt aufleben, die Welt scheint in zwei Lager gespalten. Und so solidarisieren sich die Völker in Afrika, Südamerika und Asien, deren eigene Ausbeutung in der Kolonialzeit noch nicht allzu lange zurückliegt, ganz selbstverständlich mit den Palästinensern. Auch die Klima-Aktivistin Greta Thunberg wächst über sich hinaus und beweist Mut, indem sie Israel des Völkermords in Gaza bezichtigt.17 Viele aus der Klimabewegung, welche die Einbettung von Gretas Idealen in eine größere Dimension ablehnen, ziehen sich daraufhin zurück. Bei einer Rede wird Thunberg gar das Mikrofon aus der Hand gerissen.
Im deutschsprachigen Raum hingegen vermeidet man alles, was auch nur ansatzweise als „Antisemitismus“ ausgelegt werden könnte. Hier, wo man sich vor einigen Jahrzehnten des furchtbarsten Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht hat, sind die politischen und kulturellen Eliten inzwischen mindestens so zionistisch wie die rechtsextrem ausgerichtete israelische Regierung. Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck hält eine Rede an die Nation, in der er von einer „historischen Verantwortung Deutschlands für das Existenzrecht Israels“ spricht.18 Während er „die bestialischen Gräueltaten der Hamas“ vom 7. Oktober schärfstens verurteilt, bedauert er das „Leid, das über die Menschen in Gaza hereingebrochen“ sei, als ob es sich um eine unvermeidbare Naturkatastrophe handeln würde… Palästinademonstrationen werden in Deutschland und Österreich regelmäßig behördlich untersagt. Parolen, welche die unverhältnismäßig hohe Zahl an zivilen Opfern in Gaza anprangern, werden als „antisemitisch“ gebrandmarkt, der Ruf nach einem „freien Palästina“ wird als „Aufruf zur Zerstörung Israels“ umgedeutet. In Graz wird eine Palästinademonstration wegen des Hissens palästinensischer Flaggen untersagt. Israelische Vortragende werden ausgeladen, wenn sie zu jenen gehören, die die aktuelle Politik ihres Landes kritisieren. Angeblich aus „Sicherheitsgründen“, wie etwa die amerikanische Journalistin Deborah Feldman, die nach Wien zu einem Vortrag hätte kommen sollen. Als Jüdin hatte sie es gewagt, die Haltung Deutschlands in Bezug auf die israelische Politik zu kritisieren: „Seit Konrad Adenauer führt Deutschlands Weg zur Wiedergutmachung an die Seite Israels. Deutschland investiert in den Erfolg Israels und befreit sich dadurch aus seiner Verantwortung aus seiner Geschichte. (…) Deutschland brauchte Israel für die Konstruktion einer neuen Identität (…) Dieses Land hat sich sehr früh darauf festgelegt, dass in der bedingungslosen Solidarität zu Israel die Erlösung liegt. (…) Es ist ein Trugschluss, dass man dem Antisemitismus entgegentritt, indem man Israel beisteht.“19
Der österreichische Bundeskanzler reist zur Solidaritätsbekundung nach Israel, empfängt wenig später in Wien Angehörige israelischer Geiseln. Während in Gaza tausende Menschen abgeschlachtet werden, darunter – laut UNICEF – im Schnitt hundertvierunddreißig Kinder täglich, veranstaltet die österreichische Bundesregierung am Wiener Heldenplatz unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ ein Lichtermeer. Rund 20.000 Menschen finden sich ein, um der von Hamas verschleppten israelischen Geiseln zu gedenken. Die meisten von ihnen werden wenig später wohlbehalten im Zuge eines Waffenstillstandes den israelischen Behörden übergeben. Israel entlässt im Gegenzug hundertfünfzig Palästinenser aus der Haft. Fast alle von ihnen sind Frauen oder Minderjährige, die wegen Steinewerfens in israelischen Gefängnissen saßen…
Danach erklärt die israelische Regierung den Waffenstillstand einseitig für beendet und setzt ihren blutigen Feldzug gegen Gaza fort.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, startet verzweifelte Appelle, um dem humanitären Supergau Einhalt zu gebieten. Vergeblich, jede Resolution, die Israel zu einem Waffenstillstand rufen soll, scheitert am Veto der Westmächte. Das internationale Kriegsrecht scheint für Israel aufgehoben zu sein. Sie dürfen die „menschlichen Tiere“ offenbar wahllos abschlachten. Für den „Kampf gegen den Terror“ muss man scheinbar in Kauf nehmen, dass Gaza sich in ein Massengrab für Kinder verwandelt…
***
Meine Freundin Maria ist seit vielen Jahren bei den „Frauen in Schwarz“ aktiv. Jene weltweit aktive Anti-Kriegsbewegung, die jüdische Frauen 1988 in Jerusalem gegründet hatten, nachdem sie Zeuginnen schwerer Menschenrechtsverletzungen der israelischen Soldaten in den besetzten Gebieten geworden waren. Aus früheren Gesprächen mit Maria habe ich eine Ahnung davon bekommen, welchen Repressalien Palästinenser in ihrer Heimat ausgesetzt sind, denn ihre Schwester ist im Westjordanland mit einem verheiratet. Maria erhält regelmäßig Nachrichten von ihr, doch zum Schutz ihrer Familien müssen diese Menschen anonym bleiben.
„Wann veranstaltet ihr wieder eine Mahnwache?“, frage ich Maria. Ich erfahre, dass sie schon am kommenden Samstag am Wiener Kohlmarkt stattfinden soll. Diesmal möchte ich dabei sein.
Wir sind ein kleines Grüppchen von Frauen, aber auch Männern, viele davon schon etwas älter. Einige von uns halten kleine Plakate, meines macht auf die Situation der palästinensischen Kinder aufmerksam, von denen viele in israelischen Gefängnissen sitzen. Ein kleiner Infotisch, der Flugblätter mit Informationen anbietet. Keine Rufe, nur Schweigen, die Botschaften auf unseren Plakaten sprechen für sich. Unzählige Passanten laufen im Einkaufsfieber rasch vorbei, einige bleiben interessiert stehen, stellen Fragen, manche bekunden offen ihre Sympathie für unser Anliegen. Aber es sind auch welche dabei, die ablehnend mit dem Kopf schütteln oder heftig dagegen argumentieren. Ich komme ins Gespräch mit dem aus ololtammenden, inzwischen pensionierten Arzt Dr. Sami Ayad. Er stammt aus Jaffa, wie er mir erzählt, seine Familie wurde von dort vertrieben. Aufgewachsen im kuwaitischen Exil kam er dann über Umwege nach Österreich, wo er sein Medizinstudium absolvierte. „Sie sollten ein Buch über ihr Leben schreiben“, schlage ich ihm vor, doch er winkt ab: „Schreiben ist nicht so meins…“
8 Das Akronym Hamas („Harakat al-Muqawama al-Islamiya“) bezeichnet die sogenannte Bewegung des Islamischen Widerstands, die im Zuge der Intifada von 1987 als Ableger der Muslimbruderschaft gegründet wurde.
9www.vox.com.
10 Michael Borgstede in Die Welt vom 3.6.2010.
11 Ein Palästina, das somit Gaza und das seit 1967 besetzte Westjordanland umfasst, jedoch ohne das heutige Kernland Israels.
12 Wikipedia, 13.2.2024.
13 Es handelt sich um eine über- und unterirdisch verbaute Wehranlage, die unter anderem mit unterirdischen Sensoren zum Aufspüren von Tunnelbauten, Radaranlagen, Unterwassergeräten, Kameras, Beobachtungsstationen und Wachräumen ausgestattet ist.
14 Unter anderem Puls 24, 9.10.2023.
15 Homepage Human Rights Watch, 16.10.2023; Homepage Amnesty International, 31.10.2023; tagesschau.de, 11.12.2023.
16 weltexpress.info, 19.11.2023.
17 An dieser Stelle sei in juristischer Hinsicht Folgendes klargestellt: Der Begriff des Völkermordes wurde in der UN-Völkermordkonvention von 1948 definiert. Artikel II. der Konvention definiert Völkermord als jede Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Solche Hand-lungen umfassen das Töten von Menschen, das Zufügen körperlicher oder seelischer Schäden, eine lebensgefährliche Verschlechterung der Lebens-bedingungen, das Verhindern von Geburten oder die gewaltsame Abnahme von Kindern. Ob der Staat Israel sich seit Oktober 2023 in Gaza des Ver-brechens des Völkermords oder anderer Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht hat, ist juristisch noch nicht geklärt. Die am 29.12.2023 von der Republik Südafrika beim Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen den Staat Israel eingereichte Klage ist noch anhängig. Aufgrund des über-wältigenden Beweismaterials sehen weltweit zahlreiche Juristen das Delikt des Völkermords als verwirklicht an, der Gerichtshof hat wegen der Plau-sibilität der Anklage bereits einstweilige Verfügungen gegen Israel erlassen. Ende März 2024 veröffentlicht die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese einen Bericht über Israels Vorgehen in Gaza. Aufgrund der ge-sammelten Beweise sei demnach „begründet“ anzunehmen, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begehe. Albanese sieht sich nach diesem Bericht mit massiven Anfeindungen bis hin zu Bedrohungen ausgesetzt, lässt sich dadurch jedoch nicht beirren. Die Entscheidung des IGH über die Klage Südafrikas wird noch auf sich warten lassen – wahrscheinlich sogar Jahre.
18 Rede vom 2.11.2023.
19 Süddeutsche Zeitung, 21.11.2023.
Ein Entschluss
Wenige Tage später. Ich gehe gerade von meiner Kanzlei zur U-Bahn, als ich am Stephansplatz auf eine „Palästinademo“ treffe. Viele palästinensische Fahnen, die Menschen rufen in Sprechchören „Free, free Palestine!“ und – zorniger: „Kindermörder Israel!“ Reden werden gehalten, dann stimmen die Teilnehmer Leve Palestina an, jenes antizionistische Lied, das ein Exil-Palästinenser in den 70er Jahren in Schweden geschrieben hatte. Sie beginnen zu tanzen, umarmen sich, manche lächeln sogar. Die meisten von ihnen sind jung, viele Kinder, ihnen gehört die Zukunft.
Doch ich muss nach Hause und will mich gerade auf den Weg machen, als ich auf eine langjährige Bekannte treffe. Sofort fragt sie mich: „Du bist aber nicht wegen denen da?“ Ich weiß, dass sie Jüdin ist. „Nein, ich bin zufällig auf die Demo gestoßen“, antworte ich, und füge dann hinzu: „Aber ich finde das Anliegen dieser Menschen verständlich…“ Ich schätze meine Bekannte als aufgeschlossene, gerecht denkende Frau, in diesem Punkt wird sie mir wohl zustimmen, nehme ich mal an. Doch ich hätte den Satz besser nicht sagen sollen. Meine Bekannte wechselt plötzlich ihren Gesichtsausdruck. „Die sind doch alles Hamas“, bekomme ich zu hören. Ich versuche zu widersprechen, doch ein wahrer Redeschwall ergießt sich über mich: Dass sie Verwandte in Israel habe, dass diese nicht wüssten, wohin, und immer wieder: „Diese Leute sind von der Hamas!“
Es gelingt mir, das Thema zu wechseln und mich höflich zu verabschieden. Meiner Bekannten zu widersprechen wäre nur in einen sinnlosen Streit ausgeartet. Doch es bleibt ein negatives Gefühl zurück. Das Unversöhnliche an ihr hat wehgetan, und es hat mich nachdenklich gemacht. Es sind offenbar nicht nur die Vorurteile. Diese Frau hat Angst.
***
All diese Erlebnisse, die Demo und die Gespräche, sie haben etwas in mir ausgelöst. Ich will nicht länger nur Zuschauerin sein. Ich will auch etwas unternehmen. Und sei es nur, um meine Sympathie zu bekunden, indem ich meine Stimme erhebe. Ich möchte andere Menschen kennenlernen, die so denken und fühlen wie ich. Menschen, welche die Heuchelei nicht mehr aushalten: Wenn Hamas 1.000 Unschuldige ermordet, ist es Terror. Wenn Israels Armee ein Vielfaches davon hinmetzelt, dann soll das „Selbstverteidigung“ sein?
Die Palästina Solidarität Österreich hatte ich bei einer Jahre zurückliegenden Veranstaltung kennengelernt, seitdem habe ich ihren Newsletter abonniert und erfahre so von geplanten Treffen. Ich beschließe, eines davon zu besuchen. Was ich in dem kleinen Veranstaltungslokal im Souterrain vorfinde, ist ein sympathischer, bunter Haufen von Menschen aller Altersstufen, die offenbar die Nase voll haben von den vorgesetzten Meinungen.
Frauen mit Kopftuch sind ebenso vertreten wie junge, modisch gekleidete Mädchen, ältere Herren sitzen neben Jungen im Punk-Look. Es sind wohl fünfzig Leute da, jede und jeder hat etwas zu sagen und am liebsten sofort. Der Organisator Willi Langthaler versteht es, die Diskussion in geordneten Bahnen zu halten, jeder kommt zu Wort. Abgesehen von der Politik werden auch handfeste juristische Probleme besprochen, allen voran mit der Behörde, die immer wieder Demonstrationen verbietet oder auflöst, weil einer den Satz „From the River to the Sea“ gerufen hat.
Es hagelt Strafen und Vorladungen auf Polizeiinspektionen, weil einige ihrer Wut im Internet Luft verschafft und dort Sätze gepostet hatten, die über das rechtlich Erlaubte hinausgehen. Als ich mich zu Wort melde und Hilfe anbiete, ernte ich spontanen Applaus.
Wenig später wirke ich in einem Kurzfilm eines engagierten jungen Filmemachers mit, der auf das Unrecht in Gaza aufmerksam machen will. Werte wie Gerechtigkeit und Menschlichkeit seien für mich immer wichtig gewesen, erkläre ich in die Kamera. An einem der darauffolgenden Samstage spreche ich bei Eiseskälte und dichtem Schneetreiben auf einer Demo, wo ich vor dem Ballhausplatz das Gedicht Höre Israel von Erich Fried vortrage.
Die Reaktionen der „anderen“ – sie bezeichnen sich in ihren Plattformen und Foren als „Zionisten“ oder besonders dreist gar als „Antifaschisten“ – fallen unglaublich heftig aus.
Einer von ihnen, er hat auf der Plattform X immerhin eine Reichweite von rund 8.000 Followern, wirft mir vor, mich für die „Hamas-nahe“ Palästina Solidarität Österreich zu engagieren, obwohl diese mit Hamas in keiner Verbindung steht.
Er warnt – an mich gerichtet – in seinem Posting: „Hoffentlich kennt sie den § 282a StGB“. Gemeint ist der sogenannte „Terror-Paragraf“, der die Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat unter Strafe stellt.
Die Diktion der Kommentare lässt keinen Zweifel daran übrig, was man von einer wie mir hält: „Hoffentlich heißt es bald: Ich war eine Anwältin“, „Ist die Rechtsanwaltskammer schon informiert?“, „Die ist sowieso komplett durchgeknallt“ und so weiter. Die Angriffe werden immer persönlicher, einer veröffentlicht einen neuen Beitrag über mich auf seinem X-Account: „Die hat aber auch eine Karriere hinter sich. Verliebt sich in den Mörder Jack Unterweger. Verteidigt Josef Fritzl20 und hält ihn für harmlos. Bezeichnet den Massenmord vom 7.10. als kräftigen Akt des palästinensischen Widerstands.“
Etwas, das Geist und Seele vergiftet
Die eisige Kälte bei der Samstagsdemo hat mir zugesetzt, ich fange mir eine heftige Grippe ein und muss das Bett hüten. Bei Tee und Halswickel betrachte ich die Bilder aus Gaza, die vor allem auf Instagram von mutigen Menschen gepostet werden. Viele von ihnen sind junge Kriegsreporter vor Ort und riskieren dabei ihr Leben. Die Bilder, sie lassen mich nicht mehr los. Ein Großvater küsst den Leichnam seiner kleinen Enkeltochter, ein unglaublich schönes Kind, es wird nie wieder die Augen öffnen. Einen schwer geschockten kleinen Buben schüttelt es regelrecht vor Angst, sein Entsetzen ist ihm deutlich anzusehen, seine dunklen Augen sind weit aufgerissen, er bringt kein Wort mehr heraus. Ein Arzt versucht ihn zu trösten, streichelt seinen Kopf. Kinder ziehen Leichentücher ab, erkennen darunter ihre toten Eltern, brechen in Tränen aus. Mütter klammern sich weinend an ihre toten Babys. Ich weiß, dass die Eltern in Gaza inzwischen die Körper ihrer Kinder mit deren Namen versehen, damit sie diese später identifizieren können. Menschen sammeln die Leichenteile ihrer Liebsten ein, verpacken sie weinend in Säcke. Ein geschundener Esel liegt schwer verletzt zwischen Trümmern, sein Körper ist in einer Stahlverstrebung eingeklemmt. Seine dunklen, schmerzerfüllten Augen sind kaum zu ertragen. Ein Mensch, der fast nur mehr aus nacktem Fleisch zu bestehen scheint, windet sich in höllischen Schmerzen. Es gibt niemanden, der ihm helfen kann. Die Krankenhäuser wurden zerbombt, medizinisches Personal getötet, es gibt längst keine Medikamente mehr. Und immer wieder die Bilder der toten Kinder…
Aber auch ein anderes Bild aus Gaza, das hängenbleibt: Kinder rutschen ausgelassen und lachend über die breiten Betonblöcke einer zerbombten Moschee. „We teach you life, Sir“, hat der Kriegsreporter daruntergeschrieben. Dann die Bilder der anderen, der israelischen Seite. Attraktive Fernsehmoderatorinnen posieren zwischen Soldaten und signieren die für Gaza bestimmten Granaten mit Sätzen wie: „Finish them!“ Soldaten feiern ihre Verlobung in Trümmern, andere halten mit breitem Lachen die Unterwäsche der vertriebenen oder ermordeten Bewohner in die Kamera. Die israelische Armee veröffentlicht zum ersten Mal Bilder von verhafteten, bis auf die Unterhose entkleideten Männern: Sie stammen aus dem Norden des Gazastreifens, liest man, und sollen verhört werden. Auf der Jagd nach Hamas-Terroristen hat die Armee alle männlichen Bewohner über fünfzehn zusammengetrieben. Halbnackt hocken sie mit gesenkten Köpfen auf dem Boden, die Hände am Rücken gefesselt, manchen wurden die Augen verbunden. Auf anderen Bildern sieht man, wie sie wie Vieh in LKWs verladen und abtransportiert werden. In einem von israelischen Soldaten angefertigten Kurzfilm sieht man eine Gruppe von Männern, die bis auf die Unterhose entkleidet auf einer von Trümmern übersäten Straße stehen. Es plärrt aus einem Lautsprecher, ein israelischer Soldat gibt offenbar Kommandos durch. Ein älterer, ebenfalls fast nackter Mann tritt aus der Gruppe hervor, legt eine Langwaffe ab, geht mit erhobenen Händen wieder zurück. Eine Inszenierung, mit der das israelische Militär uns offenbar weismachen will, dass es sich bei diesen Männern um Hamas-Kämpfer handeln soll. Ein deklarierter Zionist schreibt auf der Plattform X: „Die Gefangenen sollten lebendig begraben werden. Das sind keine Menschen und keine menschlichen Tiere, sondern Untermenschen, und so sollten sie behandelt werden.“ Die Plattform löscht das Posting wegen Verstoßes gegen die Richtlinien. Tage später stellt sich die Identität jenes Mannes heraus, der offenbar gezwungen wurde, eine Langwaffe niederzulegen: Er ist der Inhaber eines kleinen Geschäftsladens in einem Dorf in Gaza. Wieder andere Bilder zeigen auf die Ladefläche eines LKW verladene, fast unbekleidete palästinensische Männer, die um ihr Leben flehend sich von Hamas distanzieren…