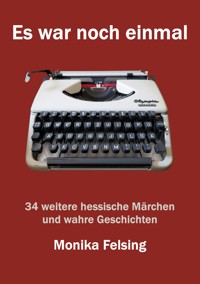
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Märchen enden, wie wir wollen: On wann sè nid geschdorwe sai, heißt es kurz vor Schluss, dann läwe sè noch haut. Und streiten sich wie die Kannefligger: In der WG der Bremer Stadtmusikanten kriselt es gewaltig. Ständig gibt es Zores eam Roiwerhaus, und niemand da, der Frieden stiften könnte. Als die vicher Viecher unversöhnt schlafen gehen, ahnen sie nicht, dass ihnen keine gute Nacht bevorsteht. Für Kinder der Siebziger konnte eine Kur zum Albtraum werden. Das Märchen vom Sonnelaand erzählt davon. Wahrheit und Fantasie sind Schwestern in dieser Übersetzung moderner oberhessischer Mundartmärchen. Und die meisten nehmen ein glückliches Ende. Wenn auch nicht für alle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dè Woahrhääd on dè Fandasie! Hossde nur äi, dann wäsde nie, woas merr uhne die anner deed. Zem Dengge eas’ nonnid sè schbeed, meend Moadder Geede, meend dè Kant.
Dichdung on Woahrhääd brouchd es Laand! On Märche, Bosse, gurre Wärge on fier die Giies Kaddoffeischdärge. *
* Der Wahrheit und der Fantasie! Hast du nur eine, weißt du nie, was man ohne die andre tät’.
Zum Denken ist’s noch nicht zu spät. Meint’ Mutter Goethe, meinte Kant.
Dichtung und Wahrheit braucht das Land!
Und Märchen, Scherze, gute Werke – und für die Klöß’ Kartoffelstärke.
Inhaltsverzeichnis
Streit im Räuberhaus
Bruder Jakob
Der Nälbar
Der Eber ist los
Das blitzgescheite Haus
Der Weberknecht
Die Kaffeemühle
Die zwölf Elfen und die Schwarzwurzel
Im Sonnenland
Das Prinzesschen Widdèwidd
Die Aprilsnase
Der Heinzemann
Der Hektiker
Das Salzfässchen
Die Schneckenwirtschaft
Was die Puppe sagte
Die Blumenfee
Der Dummschwätzer
Der Hämel
Grummet
Der Unflat
Das Schadchen und der Schaude
Das Musikhannschen
Als die Lebensfreude weg war
Das Grappagespenst
Was die Toni so sah und die Hildegard finden konnte
Das letzte Wort
Die goldenen Popel
Das Wurstmännchen und die Liebe
Was gute Werke wiegen
Die Milchwächterin
Von einer, die anderen auf die Nerven ging
Es lag an der Lockenschere
Die Bücherfrau und der Leserattenfänger
Anhang
Hintergründe der einzelnen Märchen
Nachwort
Geschichtsverein Lastoria
Literatur
Bilderverzeichnis
Moderne Mundart
Dank
Vorwort
Es war einmal ein Vorwort, das bestand aus nur drei Sätzen, denen fast drei Dutzend nachträglich ins Hochdeutsche übertragene Märchen folgen sollten, eins wie das andere ursprünglich im Dialekt eines kleinen oberhessischen Dorfes gehalten, in dem die Autorin im 20. Jahrhundert ihre Kindheit und Jugend verbracht hat und dessen Geschichte und Geschichten sie als Historikerin und Journalistin gemeinsam mit anderen Freiwilligen seit mehr als einem Jahrzehnt ehrenamtlich erforscht und in Sachbüchern, Dialektliedern und Mundartmärchen veröffentlicht.
Auch in diesem hochdeutschen Band wird, was passiert ist, was heute passiert und was passiert sein könnte, was bekannt war und nicht vergessen werden soll, in der Art moderner Märchen erzählt, auf der Grundlage von Fakten, Lebenserfahrungen und Fantasie, inspiriert von den Geschichten der Brüder Grimm oder Hans Christian Andersen, von Volksliedern, Blues, Klezmer oder Hits wie „Die Hesse komme" von den Rodgau Monotones, in den Fußnoten und im Anhang ergänzt um einige Mundartworte und Redewendungen, die für sich sprechen und deren oberhessischer Humor heutige mit früheren Generationen verbinden kann, tief Verwurzelte mit Menschen, die in der Region heimisch geworden oder dahin zurückgekehrt sind und Hessen mitprägen.
Es ist also wieder, als möglichst wortgetreue Übersetzung des Originals, ein Märchenband geworden, dessen Geschichten in meinem Blog zu hören sind, Lust machen sollen auf Mundart, ob nun diese oder andere, aufs Zuhören, genau Hinhören, Mitfühlen und Selbsterzählen, auf die Beschäftigung mit Menschheitsproblemen, die uns unmittelbar angehen und uns vor größere Herausforderungen stellen, als es ein Drache im Märchen sein kann oder das Krokodil im Kasperletheater unserer Kindheit, und zugleich eine Einladung zum Träumen und Aufwachen sind.
Streit im Räuberhaus
Es waren noch einmal vier Tiere, ein Esel, eine Katze, ein Hahn und ein Hund aus Oberhessen, die haben in einer Räuberhütte im Wald gewohnt, fragt mich nicht, wo und wann. Wieso sie da gelandet waren, weiß man. Sie waren von daheim fort, weil man ihnen an den Kragen wollte, und hatten nach Bremen ziehen wollen, um Stadtmusikanten zu werden.
Aber dann hatten sie das Räuberhäuschen gefunden, mitten im Wald, und die Räuber fortgejagt, dass sie die Schuhe verloren haben. Die Räuber, versteht sich, nicht unser Esel, unser Hund, unsere Katze und unser Hahn. Die hatten ja keine Schuhe an, der Esel nicht einmal Eisen.
Als sie schon eine ganze Zeit in dem Räuberhäuschen im Wald wohnten, gab es manchmal Streit. Wie das so ist, wenn ein paar zusammenleben. Da geht es den Tieren wie den Menschen. „Hier sieht es aus wie im Saustall“, beschwerte sich die Katze, die es gerne schön ordentlich hatte. „Räumt doch mal auf!“ Der Hund aber hat nur geknurrt. „Ich bin nicht von daheim fort, damit ich mich hier rumkommandieren lasse“, sagte er. „Du hast mir gar nichts zu sagen!” Der Esel war sowieso stur wie drei Oberhessen, und der Hahn hat den Kopf unter einen Flügel genommen und die Katze nicht beachtet.
Die war beleidigt, das könnt Ihr Euch ja denken, und hat die Krallen ausgefahren und gefaucht wie eine Lokomotive. Aufgeräumt hat trotzdem keiner. Bei Hembels unterm Sofa war’s ordentlich dagegen. Und das war nicht das einzige Problem. Manchmal zankten sie sich wie die Kannenflicker, wo der beste Platz im Haus war, wer da schlafen durfte und wer zuletzt Wache gehalten hatte, ob die Räuber zurückkommen oder ob andere verdächtige Gestalten im Wald waren.
Einmal kamen zwei Gelehrte, die aus Hanau waren und in Kassel wohnten, auf ihrem Weg nach Bremen am Räuberhaus vorbei. Die vier Tiere aber haben keinen Mucks gemacht und sie nicht reingelassen. „Was für ein Knusperhäuschen“, sagte einer der beiden Gelehrten. „Nur ohne Lebkuchen“, sagte der andere. „Und der Wald sieht aus, als ob sich Einhörner und Bären, die reden können, hier gute Nacht sagten. Sehen wir zu, dass wir fortkommen.“
Und weg waren sie. Der Hund aber hätte sie zu gerne gebissen. Der Esel hatte ihn davon abgehalten. Schon ging die Streiterei von vorne los. „Andauernd willst du sagen, wo es lang gehen soll“, regte sich der Hund auf. „Nur weil du der Größte bist, willst du Chef sein!” „Ich?“, rief der Esel. „Ich habe die größte Last zu tragen, wenn ihr auf mir steht. Da kann ich auch mal sagen, wo es lang geht!“ „Ich habe gehört, dass die, die ganz oben sitzen, die größte Verantwortung tragen“, sagte der Hahn. „Du sei bloß still“, zischte ihn die Katze an. „Deine Krallen verkratzen mir den ganzen Katzenbuckel! Es kann mir schon keiner mehr aufs Fell gucken, weil ich da eine kahle Stelle habe!“ „Tut mir leid“, sagte der Hahn, „dass ich geschlüpft bin und lebe. Ohne mich wärt ihr die drei Musiktiere!“ „Hör auf, sagte der Hund, „du bildest dir wer weiß was ein auf deine Stimme.“ „Ich habe zum Glück eine Stimme“, sagte der Hahn. „Das kann man nicht von allen hier behaupten.“ „Was soll das denn jetzt bedeuten?“, fragte der Esel. „Habe ich etwa keine?“
„Du schreist“, sagte die Katze. „Und der Hund bellt und heult. Die Einzigen, die einen Ton halten und singen können, sind der Hahn und ich. Sagen wir’s doch, wie’s ist.“ „Dann singt doch zu zweit, ihr beiden“, sagte der Hund. „Ich habe die Schnauze voll von diesem Gezänk.“
Und alle sind sie schlafen gegangen, ohne ein Wort. So böse waren sie aufeinander! In der Nacht hat der Hund geträumt, der Hahn wäre in den Suppentopf gekommen, und er, die Katze und der Esel hätten um den Tisch herum gesessen, einen Teller vor sich und Tränen in den Augen. Niemand konnte etwas essen, keiner wollte etwas sagen. Bis der Hund gebellt hat. „Ich esse ihn nicht, ich esse diese Suppe nicht“, hatte er geheult. „Geht mir weg mit solchen Rezepten!“
Und da war der Hahn aus dem Suppentopf gehüpft und hatte gekräht. Wie jeden Morgen. Und der Hund war auf einen Schlag wach. „Guten Morgen“, sagte er zum Hahn. „Tut mir leid, dass ich so fies zu dir gewesen bin.“ „Ich war auch nicht besser“, sagte der Hahn und putzte sich sein Federkleid. „Lass gut sein. Ich hatte einen Traum, der steckt mir immer noch in den Knochen.“
Er hatte geträumt, dass die Katze todkrank war, sie hatte Schnupfen und Fieber und einen glasigen Blick. Der Esel war los und hatte Kräuter ausgerupft und sie der Katze zu fressen gegeben. Der Hund hatte Holz im Wald gesammelt, damit der Ofen angemacht werden konnte. Und der Hahn ist an den Bach und hat einen Schnabel voll Wasser für die Katze geholt und noch einen und noch einen. Die Katze aber war schwächer und schwächer geworden. Vor lauter Aufregung war der Hahn von der Stange gefallen und hatte gekräht. Und noch einmal und noch einmal vor lauter Glück.
Die Katze war in der Nacht aufgewesen, wie gewöhnlich, und hatte kaum geschlafen. Aber auch sie hatte schlecht geträumt. In ihrem Traum hatte der Esel auf einer Bühne gestanden und vor großem Publikum gesungen, so schön wie Caruso. Die Katze dachte, sie höre nicht richtig. So ein Jubel, Beifall, Bravorufe! Mitten in der schönsten Arie aber fiel der Esel tot um. Und der Hahn krähte, und als die Katze sich umguckte, stand der Esel neben der Tür und schlief im Stehen und träumte.
In dem Traum des Esels hatte der Hund sich auf die beiden Gelehrten aus Kassel gestürzt, mit gefletschten Zähnen und gesträubtem Fell. „Aus“, schrie einer der beiden Herren. „Haust du ab!“ Aber der Hund hatte sie gebissen, fragt nicht, wo. Die beiden Gelehrten waren geflüchtet, und der Esel hatte noch gehört, wie der eine zum anderen sagte: „Wilhelm, erinnere mich daran, dass wir nie und nimmer ein Märchen aufschreiben, in dem ein Hund vorkommt!“
„Versprochen“, sagte der, der Wilhelm hieß. „Kein einziges Märchen mit Hund. Und jetzt auf zum Doktor, nach Bremen!“ Der Esel hatte ihnen noch „Iah“ hinterher gerufen, und da waren sie stehen geblieben, die zwei Gelehrten, die Brüder waren, auch wenn das hier nichts zur Sache tut. „Auch keine Märchen mit einem Esel, Jacob“, sagte Wilhelm. „Und wenn wir schon mal dabei sind, auch keins mit anderen Tieren, die sich die Menschen halten. Abgemacht.“
Dem Esel fehlten die Worte. In ein Märchen hatte er gar nicht gewollt, aber jetzt waren auch die anderen in Ungnade gefallen bei diesen zwei Gelehrten, die Wilhelm und Jacob hießen. Und die nicht aus Grünberg* waren, sondern aus Hanau. Und an allem war der Hund schuld.
„Alter Streithammel**“, dachte der Esel, als ihn die Hahnenschreie geweckt hatten. Aber es war wie im Märchen. Da saßen der Hund und die Katze und der Hahn beieinander und waren sich so einig wie nur was.
„Wie gut, dass du wach bist“, sagte der Hund.
„Und lebst“, sagte die Katze.
„Und darfst Chef sein“, sagte der Hahn.
Der Esel wusste nicht, was er sagen sollte, und hat das Maul gehalten.
Weil der Hund aber die Brüder Grimm nicht gebissen hat, kann es sein, dass sie doch noch ein Märchen aufgeschrieben haben, das von einem alten Esel, einer alten Katze, einem alten Hund und einem alten Hahn handelt, die zusammen gesungen haben. Etwas Besseres als Streiten kannst du allemal.
*Im Original: Grimmich.
**Im Original: Zonngiggel, Zornhahn.
Bruder Jakob
Es war einmal ein Junge in Oberhessen, der zu gern schlief, und er schlief und schlief, wo er ging und stand, beinahe auch im Laufen. „Du hast die Schlafkrankheit“, sagten die Leute oder, wenn seine Eltern nicht dabei waren: „Der ist so faul, es ist eine Schande.“ Und wieder andere dachten, er hielte sich für etwas Besseres: „Graf Koks von der Gasanstalt!“ Seine Patentante nannte ihn nur „unser Dornröschen“. Dabei wohnten sie gar nicht auf der Sababurg – die ist ja auch in Nordhessen.
Als sich Jakob einen Beruf suchen sollte, ist er bei einem Glockengießer in die Lehre gegangen. Er hatte sich gesagt: Wenn die Glocke erst einmal im Ofen ist, kann ich schlafen bis zum nächsten Tag. Und es wird ja auch nicht andauernd eine neue Glocke bestellt! Besser, da in die Lehre gehen als beim Bäcker!
Aber da hatte er sich geschnitten. Die Arbeit beim Glockengießer war hart, und es musste ständig etwas herbeigeschafft werden, Lehm für die Form oder Holz und andere Sachen, sodass ans Schlafen gar nicht zu denken war. Und wenn er doch mal schlafen durfte, dann träumte er, er wäre Bäcker geworden. Heimlich hat er sich auf und davon gemacht, als der Glockengießer fort war, um eine neue Glocke nach Fulda zu bringen. Da brauchten sie mehr Glocken als woanders.
Jakob war in die Welt hinaus und kam bald nach Frankreich. Um nicht arbeiten zu müssen, hatte er so getan, als ob er ein Mönch auf Pilgerfahrt wäre. Was man brauchte, um wie ein Mönch auszusehen, hatte er in einem Kloster gestohlen, wo sie ihn hatten übernachten lassen. In dieser Kutte sah er wie einer aus, der Gott dienen wollte, und die Haare hatte er sich auch noch geschnitten und ein Gesicht gemacht wie einer, der mit einem Fuß schon im Himmel war oder einen Fuß schon in der Tür des Himmels hatte. Latein konnte niemand, aber er hat einfach vor sich hingemurmelt, und das hat ohnehin niemand verstanden.
Die meiste Zeit hatte er gar nicht geredet und die Leute wissen lassen, das sei er seinem Gelübde schuldig. Wo er auch war, haben sie ihn für eine Nacht aufgenommen und ihn am Morgen zeitig zum Beten geweckt. „Frère Jacques, dormez vous?“, fragte ihn eine Frau in Frankreich, und eine andere, die aus Hessen auf dem Weg nach Paris war, wo sie die Straße fegen wollte, rief: „Hirrschde nicht die Glogge, hirrschde nicht die Glogge?"
Ei, ich höre sie ja, sagte sich Jakob und wollte sich noch einmal rumdrehen, aber da haben noch mehr Leute gerufen: „Frère Jacques, Frère Jacques, dormez vous?" Und aus war’s mit dem Schlaf.
Jakob ist weiter und weiter durch die Weltgeschichte, aber weil er sich für einen Mönch ausgegeben und gelogen und betrogen hatte, ist er blind und stumm geworden und musste so lange herumziehen, bis er die Glocken seines Heimatdorfes wieder erkannt hat. Das hat sich herumgesprochen, und die Leute haben ihn auf die Probe gestellt und gern Späße auf seine Kosten gemacht. Wo er auch hinkam, haben sie gesungen: „Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch, hörst du nicht die Glocken, bim, bam, bum?“ Und er hat Glocken gehört, überall, landauf, landab.
Wieder läuteten Glocken. Das war nicht in seinem Dorf, das waren ganz große Glocken, die Brema* und andere in Bremen. Und so ist er weiter, Leute haben ihn aufgenommen, aber er war im Kreis gelaufen, und niemand hat ihm gesagt, wo er war. „Bin ich daheim?“, fragte er sich, als er wieder Glocken hörte.
„Ai, du säisd joa als noch ean Bremè**“, verriet ihm einer, der aus Hessen auf dem Weg nach Amerika und auf der Durchreise war. „Doas eas als noch ean Bremè hieh, nur è anner Kearch.“***
Und so ist Jakob weiter und weiter und hat wieder was zum Schlafen gefunden. Der nächste Tag war ein Sonntag, und die Glocken riefen die Menschen in die Kirche. Aber da hat Jakob schon gewusst, das war nicht bei ihm daheim. Müde und verzweifelt ist er fort.
In einer Stadt hörte er eine Glocke, die kam ihm vertraut vor, aber er wusste nicht, warum. „Das ist die Glocke, die ein berühmter Glockengießer gemacht hat“, hörte er jemanden sagen. „Dem ist der Lehrling weggelaufen damals. Und der irrt jetzt durch die Lande und sucht die Glocke seines Dorfes. Die findet er niemals, das versichere ich dir.“ Und die Leute lachten. Die sahen Jakob ja und wussten, er konnte sie hören.
Dicke Tränen rollten ihm die Wangen hinunter, groß wie Erbsen, nur nicht so grün. Sein Hemd war schon klitschnass, und er schluchzte, dass die Steine davon mürbe geworden sind. Da hatte er eine Stimme gehört, und nicht nur eine: „Brurrer Joggob, Brurrer Joggob, schleefsde noch, schleefsde noch? Hirrschde nid die Glogge, hirrschde nid die Glogge? Bim, bam, bum!
Und als Jakob die Augen aufmachte, konnte er wieder sehen, und sprechen konnte er auch, aber da fiel ihm nichts ein. Er lag im Stroh auf dem Hof seiner Eltern, und alle standen sie um ihn herum, seine Schwestern, seine Brüder und wer noch alles, und es war taghell, und er war die ganze Zeit daheim gewesen, und vom Kirchturm kam ein vertrauter Ton...
Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt Jakob noch heute und ist ein Glockensachverständiger geworden. Von Glocken hat er ja was verstanden.
*So heißt eine der sechs Glocken am Bremer St.-Petri-Dom. Im Audio ist sie, wie diverse andere Glocken, bei ihrem ersten Einsatz an Ostern 2023 zu hören, außerdem Glocken aus Fulda und natürlich Ober-Gleen.
**Ei, du bist ja immer noch in Bremen.
***Das ist immer noch in Bremen hier, nur eine andere Kirche.
Der Näibar*
Es war einmal in Wahlen, es kann aber auch in Gleimenhain gewesen sein, da hat einer gewohnt, der hat niemals ja gesagt. Nicht ums Verrecken! Schon sein allererstes Wort, erzählt man sich, war nicht „Mama“ gewesen und auch nicht „Papa" oder „Happahappa", sondern „näi'. Nichts war ihm recht, es gab andauernd Ärger und Geschrei und Streit. In der Schule kam das auch nicht gut an. Wenn der Schullehrer wissen wollte, ob er wusste, wie die Landeshauptstadt des Großherzogtums Hessen-Darmstadt hieß, sagte der Kerl: „Näi, das weiß ich nicht. Das kommt davon, dass ich noch nie in Darmstadt gewesen bin. Da wissen sie’s bestimmt.“
Der Lehrer war sich nicht sicher, ob er ihn auf den Arm nehmen wollte, und fragte ihn nach der Landeshauptstadt des Kurfürstentums Hessen-Kassel. Und er sagte nur trocken: „Darmstadt ist es nicht, und auch nicht Frankfurt, da wohnen lauter Nassauer. Ab nach Kassel – da können wir fragen!“ „Ab nach Kassel sagt man nicht“, sagte der Schullehrer streng und hat ihn erst einmal nichts mehr gefragt.
Ein paar Jahre später hat der Kerl dann eine junge Frau kennen gelernt, die war aus demselben Holz geschnitzt. Drum sind sie nicht zusammengekommen. Es hätte zu gut gepasst. „Hast du sie denn nicht gefragt, ob sie dich heiraten will?“, wollte seine Mutter wissen. „Näi", sagte er. „Das konnte ich mir sparen. Die Antwort kannte ich ja schon.“
Und so ist er alleine geblieben und hat daheim, ob nun in Wahlen oder Gleimenhain, bei seinen Eltern gewohnt und nicht viele Freunde gehabt. Fragte ihn einer, ob er helfen könne beim Heumachen, sagte er: „Näi.“ Wollte jemand sich Geld von ihm leihen, sagte er: „Näi.“ Erkundigte sich einer, ob er bei der Feuerwehr mitmachen wolle, sagte er: „Näi“ Und so ging’s andauernd. Wenn es was zu feiern gab, war er nicht dabei. Da hat er nicht einmal „nein" sagen müssen – es hatte ihn niemand eingeladen.
Die anderen im Dorf waren schon lange nicht mehr gut auf ihn zu sprechen. Einer, der nichts als nein sagt, der keinem helfen will und von dem du nichts bekommen kannst, ist nicht der Beliebteste in der Nachbarschaft, das kann ich euch sagen. Den „Näibar“ nannten sie ihn, anstatt den „Nachbarn“, und haben einen Bogen um ihn gemacht. Auch die paar, die Mitleid mit ihm gehabt hatten, haben es irgendwann aufgegeben. Hast du ihn gefragt: „Geht es dir gut?“, sagte er: „Näi, und es geht dich gar nichts an.“ Hast du wissen wollen, ob er Hilfe brauchen könnte, schüttelte er den Kopf und sagte: „Und bevor du fragst: Ich bezahle auch nichts dafür.“ Die Sinti und Roma, die viele damals in Oberhessen noch Heere nannten, weil sie es nicht besser wussten oder gerne abfällig über sie sprachen, haben einen Zinken an seinen Zaun gemalt. Ein Zeichen, das hieß: „Der gibt nichts. Nicht einmal einem hungrigen Kind, das einen blinden Opa an der Hand führt.“ So schlecht war sein Ruf schon, und wenn er es gewusst hätte und gefragt worden wäre, ob ihm das etwas ausmachte, hätte er gesagt, ihr wisst es schon: „Näi!“
Aber irgendwann war das Geld ausgegeben, das ihm seine Eltern hinterlassen hatten, und einen Beruf hatte er ja nicht gelernt. Da war es nicht mehr lang hin, bis das Dorf für ihn zahlen musste, denn damals musste jedes Dorf seine Armen unterhalten. Die bekamen ja nicht viel, aber wer wusste schon, wie alt so einer werden konnte. Und das ging dann ins Geld.
Eines Abends haben sich die Männer in der Wirtschaft versammelt und Rat gehalten. „lch sehe nicht ein, dass ich ein Leben lang für den Näibar zahlen soll“, sagte einer. „Der hat noch nie etwas für uns getan“, ein zweiter. „Und keinem von uns geholfen“, ein dritter. „Und immer nur nein gesagt", ein vierter. Das war der Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr.
Keiner hat sich für den Näibar eingesetzt, alle hatten sie genug von ihm, auch die Frauen und die Kinder und der Wirt, der nichts an ihm verdienen konnte. Nicht, dass er nicht soff. Aber daheim, seinen Selbstgebrannten. Und so haben sie alle zusammengelegt, für eine Fahrkarte nach Amerika, einfache Fahrt, kein Retourbillet, und dritter Klasse. Dann haben sie ihm gezeigt, wo es zum Dorf hinausging, und sich erkundigt, ob er wiederkommen wollte.
„Näi", sagte er. „Ich hatte schon lange vor, auszuwandern, aber das Geld hat nicht gereicht.“ Und so ist er auf und davon und in Amerika auf lauter Leute getroffen, die waren wie er. Jeder Nachbar ein Näibar****.
*lm Original: Näiberr statt Noochberr für Nachbar. Näi heißt nein.
**englisch: neighbour.
Der Eber ist los
Es war einmal ein Eber in Oberhessen, der war in Schweinsberg oder in Deckenbach daheim, sagt man, aber das kann auch ein Scherz gewesen sein.
Der Eber, von dem hier die Rede ist, hatte schon so manche Sau gedeckt und umso mehr Kinder gezeugt. Nicht jeder Bauer konnte sich einen Eber halten, aber alle brauchten sie Ferkel, damit sie beizeiten etwas zum Schlachten hatten, so wie sie Kälber brauchten, weil nur die Mutterkühe Milch geben. Und wie sie die Kühe zum Bullen brachten, so holten sie sich einen Eber oder gingen mit ihrem Vieh da hin, wo einer war.
Wurst und Fleisch aßen die meisten Leute damals gar zu gerne. „In der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot”, sagten sie, auch wenn manche so arm waren, dass sie nicht einmal einen Zipfel Wurst im Haus hatten. Jedes Dorf hatte seine eigenen Schlachter und manches auch einen Schochet, einen jüdischen Schlachter, der sich an die religiösen Gesetze hielt, damit alles koscher war. „Fleisch ist mein Gemüse” ist ein alter hessischer Spruch, das könnt ihr im Hessenpark nachlesen. Aber das nur nebenbei.
Der Eber, von dem hier die Rede ist, kannte in der ganzen Gegend fast jede Sau, und jede Sau kannte ihn. Er wollte aber auch einmal andere Bekanntschaften machen und ist auf und davon, als die Stalltür einmal nicht richtig zu war. Er lief los und kam in einen Wald, und das hätte er lieber bleiben lassen. Es dauerte nicht lange, und ein wilder Eber hatte ihn aufgespürt und hatte ihn gejagt, dass er so schnell gerannt war wie noch nie in seinem ganzen Eberleben.
Er kam auf einer Wiese zum Stehen und sah sich um. „Wo bin ich denn bloß gelandet“, grunzte er. „Wo geht’s heim in meinen Stall? Ich könnte einen halben Trog leer fressen!“ Aber da war nichts als Gras und Blumen, und ein paar Käfer und Bienen. „Ich habe mich verlaufen”, sagte der Eber zu einem Vogel, der ihn die ganze Zeit beobachtet hatte. „Weißt du, wo ich daheim bin?“
„Nein“, zwitscherte der Vogel. „Für mich seht ihr Schweine alle gleich aus. Eins wie das andere. Aber da drüben, auf der anderen Seite des Hügels, habe ich eine ganze Herde gesehen, mit einem Jungen, der auf sie aufgepasst hat.“ Besser als gar nichts, hat sich der Eber gesagt. Da bekomme ich was zu fressen oder kann ein paar neue Ferkel machen. Oder alles zusammen.
Jedes Dorf hatte damals einen Gänse- oder Schweinehirten, der eine ging mit den Gänsen der Leute auf die Wiesen, der andere mit den Schweinen in den Wald. Nur nicht auf den Acker! Und alle mussten sie abends wieder da sein, wo sie hingehörten. Das war nicht leicht! Wenn nur eine Gans oder ein Schwein fehlte, war der Ärger groß. „Du Sauwanst“, beschimpften die Leute den Hirten dann. „Kannst du nicht besser aufpassen? Du bist so dumm, dass dich die Schweine beißen!“ Aber manchmal ist so ein Hirte auch eingeschlafen, und wenn er keinen Hund hatte, der auf der Hut war, dann war schnell eins von den Tieren fort. Oder zwei oder drei. Wer zählen konnte, wusste, wie groß der Schaden war. Und wie viel Schläge zu erwarten.
Der Eber kam über den Hügel, als die Herde schon auf dem Weg zurück ins Dorf war, und ist einfach hinten mitgelaufen. Die anderen Schweine haben sich gewundert, aber nichts gesagt. Die sprachen nicht mit jedem Dahergelaufenen. Als sie ins Dorf kamen, hat der Hirte alle nacheinander abgeliefert und sich gewundert, dass am Ende einer übrig war. „Wem gehörst du denn*?“, hatte er den Eber gefragt, aber der konnte nicht mit Menschen reden und grunzte nur.
„Schweinigel**“, sagte der Hirte. „Wegen dir bekomme ich nichts als Ärger. Behalten kann ich dich nicht, dann heißt es, ich hätte dich gestohlen, und wenn ich versuche, die Sache aufzuklären, sagen die Leute, ich hätte geschlafen. Und lachen über mich. Oder ich bin meinen Posten los.“ Und so hatte er den Eber heimlich beim größten Bauern in den Schweinestall geführt und keinem was gesagt. Der Eber ist an den Trog und hat für zwei gefressen und sich aufs Stroh gelegt. Auf Freiersfüßen war der nach dem Tag nicht mehr, und die anderen im Stall wollten auch nichts von ihm wissen und haben Abstand gehalten.
Als der Knecht am Morgen in den Stall kam, rieb er sich die Augen: Da lag ein Eber auf dem Stroh, den hatte er noch nie gesehen. Und was für einen Mordskerl. Die Magd kam und der Bauer und die Frau des Bauern und die Kinder und der Opa, und dann standen sie alle da und staunten. „Wo kommt der denn her?“, fragte der Bauer und hatte nicht mit einer Antwort gerechnet. Eber sprechen ja nicht.
„Müssen wir das melden?“, fragte die Bäuerin, aber ihr Mann hatte ihr bloß einen bösen Blick zugeworfen. „Wem denn“, blaffte er sie an. „Damit jemand sagt, dass das sein Eber ist? Der gehört hier niemandem. Und der Schultheiß fragt mich am Ende, wo ich ihn her habe, und ruft den Viehhändler – nein, nein, nein. Das gibt nichts als Ärger! Was für eine Sauerei!“ „Dann lass ihn uns verkaufen“, sagte der Opa. „In Alsfeld ist Pfingstmarkt, da schicken wir ihn hin. So ein Eber ist etwas wert. Ich meine auch, ich hätte den hier schon einmal gesehen. Wie wir vor zwei Jahren in Schweinsberg waren oder in Deckenbach...” „Sei still, sei still“, zischte der Bauer seinen alten Vater an. „Wir wissen von nichts. Sag dem Viehhändler, er kann diesen Eber verkaufen, wenn er niemandem sagt, für wen. Es soll sein Schaden nicht sein.“
Am nächsten Tag hat der Viehhändler den Eber geholt, aber recht war’s ihm nicht. Er hat sich gesagt, es wäre besser, noch ein bisschen weiter zu fahren, auf einen anderen Markt, damit bloß niemand den Eber wieder erkannte. Wenn er nicht sagen durfte, wer den Eber verkaufen wollte, dann hatte er über kurz oder lang den Ärger, und Ärger konnte er keinen brauchen, einem großen Bauern aber auch keinen Wunsch abschlagen. So etwas rächt sich.
Und so hat er den Eber in einen Viehwaggon der Bahn verladen und wollte mit ihm fort. Er setzte sich vorne ins Abteil und unterhielt sich mit den Leuten, und der Eber war hinten im Waggon und sprang gegen die Wände aus Zorn und Angst. „Raus, raus, nichts wie weg“, grunzte er, und die Menschen haben ihn nur schreien und quieken hören. „Der kann’s gar nicht erwarten“, sagten sie und lachten, denn sie wussten ja: Auf so einen Eber wartete eine Sau – oder der Schlachter.
Weil er es eilig gehabt hatte, hatte der Schaffner nicht richtig aufgepasst. Die Schiebetür des Viehwaggons war nicht richtig geschlossen gewesen, und als der Eber herumgesprungen war, war sie aufgegangen. Mit einem großen Satz war er draußen, rollte die Böschung hinunter und kam auf einer Wiese wieder zu sich.
Das Zugpersonal merkte es erst beim nächsten Bahnhof und ist losgelaufen und hat ihn gesucht. Vergeblich. Weit und breit nichts zu sehen, nicht einmal ein Ringelschwänzchen. „Eine schöne Sauerei“, rief der Schaffner und lief rot an. „Wenn wir das der Oberbahndirektion in Gießen melden, spotten sie alle über uns.“ „Das bleibt unter uns“, sagte der Viehhändler nur und war nicht böse darum, dass es so gekommen war. Wer konnte sich beschweren, wenn ein Eber, der keinem gehörte, weg war? „Ein Problem weniger. Der Ärger wäre sowieso meiner gewesen.“
Und wenn der Eber nicht geschlachtet worden ist, dann lebt er vielleicht heute noch und sucht den Weg nach Schweinsberg oder Deckenbach. Manche Leute nehmen an, dass er seine Freiheit genießt. Ist so ein Eber erst einmal los, dann gibt es kein Halten mehr.
*Im Original: Wemm säisdèdè? Diese Frage wird in Oberhessen auf dem Land auch Menschen gestellt. Gefragt ist dann nicht, was im Pass steht, sondern der Hausname und der Vorname. In meinem Fall: Pauls Monika. Wenn es um den Besitz von Sachen oder Tieren geht: Die eas mir. Die sai ouch. Der eas ins. Doas eas demm. Die gehört mir. Die gehören euch. Der gehört uns. Das gehört ihm. Doas eas mai Midds. Doas eas dere ihrn Hond. Doas sai dene ihr Cäise. Das ist meine Mütze. Das ihr Hund. Das sind ihre Ziegen.
**Im Original: Sauegel. Ein früher gern genutztes oberhessisches Schimpfwort der gröberen Sorte. Im Niederdeutschen heißt es Swinegel Sau wird allerdings auch wie im Hochdeutschen benutzt, um Hauptworte oder Adjektive zu steigern.
Das blitzgescheite Haus
Es war einmal ein Haus in Oberhessen, das stand ein bisschen abseits, oben auf einem Hügel. Die anderen Häuser wollten nichts mit ihm zu tun haben, aber so ein Haus sucht sich ja auch nicht aus, wo es hingestellt wird. Und weglaufen kann es erst recht nicht.
„Na, wie ist die Luft da oben“, stänkerten die anderen Häuser, aber das Haus, das auf einem Hügel stand, hat über sie hinweg gesehen und sich gewünscht, wo ganz anders zu sein. Und es hat geseufzt, dass seine Balken geknarrt haben.
„Unser Haus wird auch langsam zu alt“, sagte der, der darin gewohnt hat. „Die alte Bruchbude“, sagte seine Frau. „Jetzt wohnen wir schon ganz oben, und alle können uns sehen, und da blamieren wir uns bis ins nächste Dorf mit so einer wurmstichigen Hütte!“ „Am besten reißt man es ab und baut sich einen Bungalow“, sagte ihr Mann. Und das Haus ist erschrocken und hat gezittert. „Hast du das gespürt?“, rief die Frau. „Der Boden wackelt!“ „Ja“, sagte der Mann. „Ich bin’s auch gewahr geworden. So geht das nicht weiter.“
Und als sie da beieinander saßen in der Stube, da kam ein Gewitter, wie sie noch nie eines gehabt hatten. Der Himmel war schwarz wie die Kohlen im Ofen, und die Vögel gaben alle Ruhe. Die Katz hat sich unterm Rhabarber verkrochen, und der Hund hat vergessen zu bellen. Aus der dicksten Wolke aber kam ein Blitz, dass es taghell wurde, und du hast es geradezu zischen hören und Schwefel gerochen. Der Blitz ist im Karacho ins Dach des Hauses auf dem Hügel geschlagen, und alle Lampen haben geflackert wie blöde. Auch die, die gar nicht an gewesen waren. Das Haus fing nicht an zu brennen, sondern leuchtete wie ein Glühwürmchen im Hochsommer. Und dann war alles still.
Der Mann und die Frau saßen noch am Tisch und rührten sich nicht. Sie waren nicht tot, aber auch nicht so richtig lebendig. Der Schreck saß ihnen in allen Knochen. Und dann hat eine Stimme gesagt: „Das Haus bleibt stehen, wo es ist!" Die zwei haben sich angesehen und sich umgesehen und konnten nicht verstehen, wer da etwas gesagt hatte. „Das Haus bleibt stehen, wo es ist", sagte die Stimme noch einmal. „Habt ihr mich verstanden?"
„Ei, ja“, sagte der Mann, und weil’s so nach Schwefel stank, dachte er, es ginge mit dem Teufel zu. Und mit dem streitest du dich lieber nicht. „Gut", sagte die Stimme. „Und morgen kauft ihr Farben und Pinsel und streicht die Balken an und weißt die Gefache, damit das Haus auch mal wieder etwas aussieht!“ „Aber", sagte die Frau, und weiter kam sie nicht. „Ihr macht, was ich euch sage. Sonst werdet ihr euch noch umgucken!", sagte die Stimme, und umgeguckt hatten die zwei sich ja schon und niemanden gesehen. Also war der Teufel wohl bei ihnen zu Besuch gekommen. Das konntest du niemandem erzählen. Die einen hätten dir nicht geglaubt, und die anderen hätten es mit der Angst bekommen. Und die Mäuler hätten sie sich alle zusammen verrissen!
Und so ist der Mann am nächsten Tag los und holte Pinsel und Farbtöpfe. Eine Leiter hatten sie in der Scheune, und so machten sie sich an die Arbeit. Es dauerte, aber als sie fertig waren, sah das Haus wieder anständig aus. „Und das Dach könnt ihr auch mal ausbessern lassen", sagte die Stimme. „Und den Schornstein gleich mit! Neue Fensterläden gehören auch bestellt. Geht mal zum Schreiner, der macht sie euch."
Und als alles fertig war, sagte die Stimme: „Es ist an der Zeit, den Garten zu machen. Und den Gartenzaun gleich mit. Streichen könnt ihr jetzt ja, dann malt ihn mal schön bunt an! Im Garten will ich Blumen haben, Dahlienbüsche, aber auch andere Blumen, und dann Beete mit Karotten, Lauch, Zwiebeln, Erdbeeren, Bohnen, Salat und was sonst noch schmeckt."

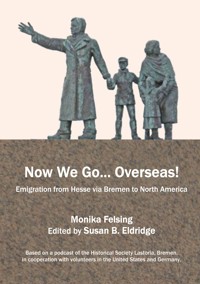
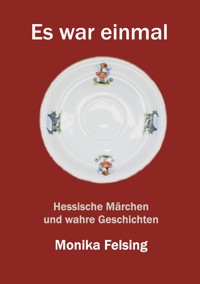
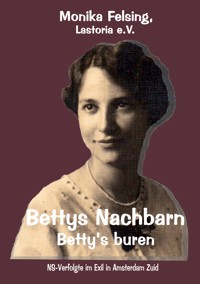

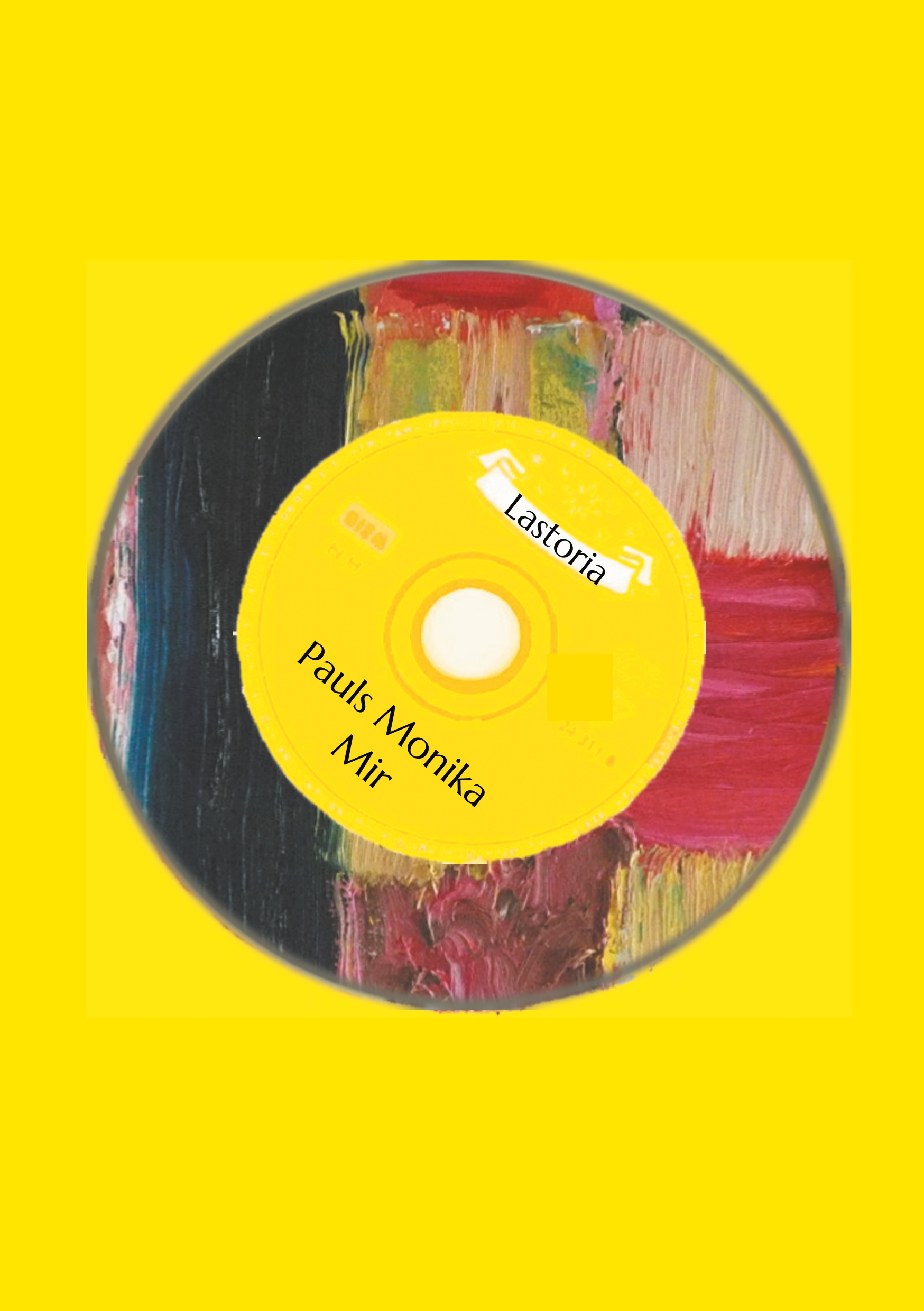













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









