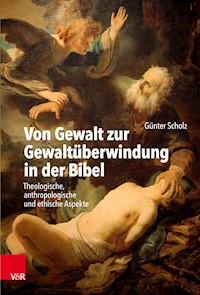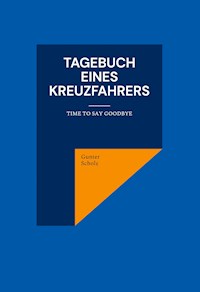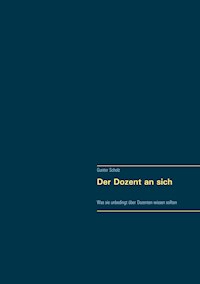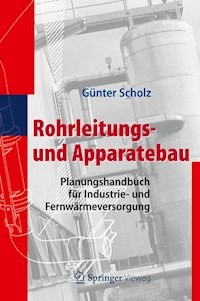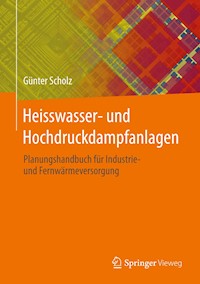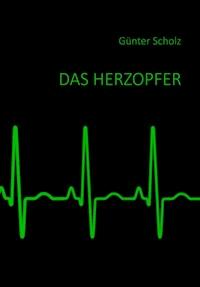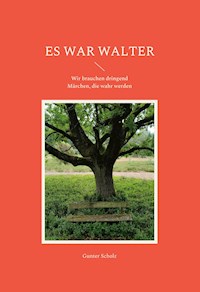
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wunderwanderer Endlich kommt Licht in den Mord an Kennedy. Warum war Mandela so erfolgreich? Wie entstand Harry Potter wirklich? Was haben der erste Mensch auf dem Mond und Harry Potter miteinander zu tun? Warum verschoss Uli Hoeneß einen entscheidenden Elfmeter und wer ist für die deutsche Wiedervereinigung verantwortlich? Ein bezauberndes Buch. Noch dazu ein lehrreiches, das zum Nachdenken anregt. Können nur noch Zaubereien unsere Welt verbessern? Walter versucht es und lernt dabei eine Menge über sich und seine Mitmenschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wunder gibt es immer wieder
Es ist so weit. Sachen in den 35-Liter Rucksack packen. Mehrere Außentaschen mit Reißverschluss. Innen wurde an Reißverschlüssen und damit an Gewicht gespart. Verwirrend viele Gurte. Dick gepolsterte Trageriemen, die nicht drücken sollen und es auch ohne Polsterung nicht täten. Hätten sie doch die schweren, dicken, sich von einer anstrengenden Tour zur nächsten mit mehr Schweiß vollsaugenden Polster weggelassen. Trocknet alles wieder, zumal er zwischen seinen Rucksacktouren Pausen von mehreren Tagen, manchmal gar Wochen einlegte. Die Wandertage waren nach keiner Systematik geplant. Die Länge der Pausen dazwischen waren durch seine menschliche Bequemlichkeit definiert. Noch war der Rucksack leer. Das Gewicht, das er bald haben würde, kündigte er durch seinen Geruch an und durch die Haptik, die jedem Griff nach einem Rucksack eine unverwechselbare Charakteristik gaben. Geruch und Material standen für Gewicht und immer wiederkehrender Suche nach den Dingen, die er doch gut durchdacht auf die Stauräume verteilt hatte. Die Verteilung war im Augenblick des Packens die beste Lösung. War der Rucksack voll, vergaß er zuerst die Packlogik, dann die Lagerorte der wichtigsten Dinge und entdeckte erst wieder nach und nach beim Wandern die Verstecke im und am Rucksack. Hatte er endlich den Überblick und einen sicheren Griff nach dem Gesuchten, war die Wanderung vorbei und die Ordnung im System bis zur nächsten Wanderung vergessen.
Er besaß mal einen kleinen Rucksack, der aus nur einem großen Innenfach bestand und eine große flache Außentasche hatte. Seine Gurte mussten auch nicht gepolstert sein, weil sein Gewicht wunderbar von den vorhandenen Gurten, die die Breite automobiler Sicherheitsgurte hatten, verteilt wurde. Nie musste er sich merken in welches Fach er welche Utensilien gelegt hatte. Es gab nur ein Fach. Einfach. Die sehr begrenzte Größe des Außenfaches und das 20-Liter-Volumen des Innenfaches waren eine äußerst hilfreiche Sortierhilfe. Der Rucksack entschied, was er mitnehmen konnte und was zu Hause bleiben musste. Nie vermisste er unterwegs Dinge, deren Transport sein kleiner Rucksack verweigerte. Irgendwann überzeugte er sich davon, dass ein größerer Rucksack sinnvoller wäre. Einer mit Regenhaube, die im Bodenfach integriert war und erlaubte, den gesamten Rucksack darin verschwinden zu lassen. Er trug die Haube jetzt seit mehr als zehn Jahren durch die Länder dieser Welt, hatte sie aber nie eingesetzt. Wenn sie sinnvoll gewesen wäre, hatte es derart geschüttet, dass es ihm nicht vorteilhaft erschien, zwar mit trockenem Rucksack sein Ziel zu erreichen, aber ansonsten bis auf die Haut durchnässt zu werden. Einfach irgendwo unterstellen war stets die einfachere und bessere Lösung.
Fünfunddreißig Liter Volumen boten die verführerische Bequemlichkeit, nicht über ein Aussortieren von Dingen entscheiden zu müssen, die er intuitiv als höchst wahrscheinlich überflüssig eingeschätzt hätte, stünden ihm im Rucksack nur 20 Liter zur Verfügung. Selbst seine Erfahrung, mit diversen ungenutzten Dingen wieder nach Hause zu kommen, ließ ihn nicht lernen, zu verzichten. Es war der bekannte Konflikt, der aus einem Maß an sinnvoller Sicherung eines Vorhabens eine ängstliche Übertreibung dieses Sicherheitsbedürfnisses zu Lasten eigener Bequemlichkeit werden ließ. Sicher oder Bequem? Sicher.
Der Rucksack sollte ihn ab morgen früh während einer Herbstferienwoche durch die Lüneburger Heide begleiten. Eine Woche lang durch Wälder und Heidelandschaft, vorbei an Maisfeldern und Wacholder, Kutschen ausweichen und nicht von Heidschnucken umrennen lassen. Durch Dörfer, die nur noch durch Wandertouristen überleben konnten, mit Bahnen und Bussen, deren lockere Fahrpläne keinerlei Systematik erkennen ließen, mit Übernachtungen in Hotels, in denen Regisseure ohne große Umbauten die Kulissen für Falladas Bauern, Bonzen und Bomben hätten finden können.
Er wollte sich entspannen, langsam gehen und vor allem sich nicht von ihm begegnender menschlicher Unzulänglichkeit provozieren lassen. Dieser Versuchung erlag er leider von Jahr zu Jahr immer häufiger. Seine ungewöhnlichen Fähigkeiten setzte er immer häufiger ein und er konnte dabei nicht übersehen, dass deren Einsatz ihn mit zunehmendem Alter mehr Kraft raubten. Er musste haushalten mit seinen Kräften. Sie dort einsetzen, wo sie die größte Wirkung erzielten. Bisher kam er sich bei der Auswahl seiner Aktivitäten vor wie jemand, der inmitten eines Waldbrandes mit einem 1-Kilo-Feuerlöscher allein auf sich gestellt den Brand löschen sollte. Er erkannte natürlich, klar wie er im Kopf war, die Unmöglichkeit, im Falle eines Falles wirklich wirksam löschen zu können. Aber was sollte er denn tun? Sollte er nicht einmal den Feuerlöscher leeren, um damit das ihm Mögliche zu leisten? Doch. Bisher hatte er sich immer für seinen maximal möglichen Einsatz entschieden. Auch wenn er sich darin bewusst war, mit seinem Feuerlöscher mehr für die Beruhigung seines Gewissens als gegen einen Waldbrand getan zu haben. Das was er konnte, wollte er leisten. Die Klarheit dieser Entscheidung beflügelte ihn und gab ihm die Sicherheit auch gewagte Operationen durchzuführen. Dass sie allesamt erfolgreich – jedenfalls nach seinen Erfolgskriterien – waren, spornte ihn nur noch mehr an, reicherte seine Phantasie für neue Taten an und gab seinen Träumen Nahrung. Doch die dafür notwendige Energie ging ihm im Alter merklich immer mehr aus. Es war aber noch einiges zu tun, um die Welt zu retten.
Selbst nach einer völlig überraschenden Entdeckung und dem dadurch ausgelösten Phantasietsunami gelang es ihm, mit seinen neu gewonnenen Fähigkeiten verantwortungsvoll umzugehen. So sah er es jedenfalls. Zu seiner Bewertung gehörte, alle die, die ihm in die Quere kamen als Egoisten, Schmarotzer, Kriminelle oder der Einfachheit halber als Unmenschen einzustufen. Nach jeder Anwendung seiner Begabung freute er sich über die Veränderungen, die er bewirkt hatte. Veränderungen, die mindestens in einer Steigerung seiner Zufriedenheit, meist aber auch in der festen Gewissheit bestanden, der Menschheit oder zumindest einem kleinen Teil, vielleicht auch nur einem Lebewesen daraus, einen Gefallen getan zu haben. Das war Grund genug, weder seine Haltung, noch sein Verhalten zu ändern.
Er schulterte seinen Rucksack und war froh, damit die Entscheidungsfindung über die zu verpackenden Dinge beendet zu haben. Von nun an begrenzten die einsortierten Artikel die Umfänge individualisierten Seins.
Er verließ das Haus, in dem seine Mietwohnung als Mansarde im sechsten Stockwerk über den anderen thronte, durch den Hofausgang. Hier hatte er sein Fahrrad an den verrosteten Zaun angeschlossen, der den Bewohnern im Parterre ihre winzigen Terrassen sicherte. Das von ihm verwendete Schloss war ungefähr so teuer wie sein altes Fahrrad selbst. Es war aber notwendig, wenn er beim An- oder Abschließen die Bekannten Revue passieren ließ, denen in seiner Wohngegend schon ihre Fahrräder gestohlen worden waren. Der materielle Schaden hielt sich jedes Mal in Grenzen. Hier nutzten alle nur einfache, alte Fahrräder für den Weg zur Arbeit oder zum Wochenmarkt. Ihre teuren E-Bikes waren für den Urlaub reserviert und lagerten in abgeschlossenen Kellern oder den Fluren ihrer Wohnungen. Und so ärgerte ihn nicht, dass sein fast wertloses Fahrrad von jedem Dieb, der es darauf abgesehen hatte, fast risikolos hätte gestohlen werden können. Es ärgerte ihn, in seiner freien Entscheidung, welches Fahrrad er nutzen möchte, wann er es für eine Fahrt - wohin auch immer -, einsetzen wollte, durch das Eingreifen einer dritten Person behindert zu werden. Nie konnte er sich darauf verlassen, sein Fahrrad noch als Ganzes vom Schloss gesichert vorzufinden. Neben seinem Fahrrad verrostete schon seit Monaten ein alter Fahrradrahmen, von dem Vorderrad und Sattel entfernt worden waren. Weil der Diebstahl des Hinterrades wohl zu aufwendig war, hatte es der Dieb durch einen hoffentlich für ihn schmerzhaften Tritt in die dadurch aus der Felge gerissenen Speichen zerstört. Dem Besitzer ist damit nicht nur sein Fahrradwert genommen worden, sondern seine Freiheit, mobil zu sein. Auch die Verlässlichkeit, mobil zu sein wann immer er wollte, war dahin. Am nachhaltigsten verwerflich war aber die Beeinflussung der Haltung des geschädigten Schrottbesitzers. Er hat gegen den aufkeimenden Hass in sich anzukämpfen. Den Hass, den er gegen Drogenabhängige in ihrer Beschaffungsnot aufkeimen spürte, den er aber nicht nähren wollte, oder den Hass gegen Nichtsnutze, die rücksichtslos für eine kleine Spritztour in das Leben anderer eingriffen. Er wollte nicht deren Kick für ihr Langweilerdasein liefern. Er wollte nicht ein schäbiges Fahrrad fahren, nur weil er keinen Neid auf ein tolles Zweirad auslösen wollte. Und es ärgerte ihn immer wieder beim Abschließen seines Fahrrades, dass sein altes Zweirad die sichtbare Kapitulation vor Zuständen war, gegen die es keine solidarische Abhilfe gab. Alle hatten resigniert, keiner fand es gut. Keiner unternahm Änderungsversuche und als Folge gab es eine breite gesellschaftliche Legitimation für Fahrraddiebstahl. Vielleicht hatten zu viele noch nicht die asoziale Dimension erfasst. Gestohlen wurden zuerst die Fahrräder, deren Besitzer sich kein sicheres, was auch bedeutete teures, Schloss leisten konnten. Das Phänomen des Fahrraddiebstahls erfüllte alle Kriterien, die für ihn gegeben sein mussten, um seine Fähigkeiten für Verbesserungen einzusetzen. Er wusste noch nicht genau, wie er vorgehen würde, aber je länger er nach einem Auftrag an sich selbst suchte, desto sicherer wurde er, dass ihm eines Tages ein erfolgversprechender Plan einfiel. Mit jedem Tag, den die Lösung auf sich wartete, festigte sich seine Motivation, in der Sache aktiv zu werden.
Beim Abnehmen seines Fahrrades vom Terrassenzaun bemerkte er das Schild, das mit seiner Aufschrift dafür warb, hier keine Fahrräder an den Zaun zu lehnen. Aber schon ein flüchtiger Rundblick, mit dem sichergestellt wurde, bei seiner Aktion unbeobachtet geblieben zu sein, reichte für eine Beruhigung seines Gewissens. Seinem Maßstab zu Folge war die Missachtung einer einseitig geäußerten Bitte bei weitem nicht so gravierend wie ein gegen Gesetze verstoßender Fahrraddiebstahl. Fing ihm bei dem Gedanken an zu dämmern, dass ein Fahrraddieb, den Diebstahl eines alten Fahrrades als sozialverträglicher als einen Banküberfall einstufte, zu dem sich Drogenabhängige ersatzweise genötigt gesehen hätte, verdrängte er diesen Gedanken schnell. Seine Werthaltungen durften nicht ins Rutschen kommen. Seine Perspektive auf Fahrraddiebstähle war durch das Bürgerliche Gesetzbuch gedeckt, die Ansicht des Junkies war eine selbst erfundene Schutzhaltung zu Lasten der Besitzenden. Es wurde Zeit, dass er etwas unternahm. Aber was?
Erst einmal musste er mit seinem Fahrrad zu seinem VW-Bus fahren, den er nicht mehr in seiner Wohnstraße abstellen durfte. Aus der Straße, in der vor wenigen Jahren noch friedlich ein Blechkasten neben dem anderen parkte, wurde zuerst eine Einbahnstraße, dann versuchte man den Verkehrsfluss durch Blumenkübel auf der Fahrbahn zu begrenzen, bevor auf die Fahrbahn Fahrradsymbole gemalt wurden. Inzwischen war die Straße zu einer Spielstraße degradiert worden. Leider gab es kaum noch Kinder in den Häusern mit den großartigen Jugendstilhäusern. Familien konnten sich die großen Mietwohnungen mit den hohen Stuckdecken kaum noch leisten, nachdem die hier aktiven Immobilienmakler vor einigen Jahren erfolgreich begannen, die Gegend konsequent als ein innerstädtisches In-Viertel zu beschreiben.
Die nun zu einem In-Viertel verwandelte Straße hatte als Einbahnstraße den Parksuchverkehr auf die benachbarten Straßen verlagert. Wer vor seinem Haus parken wollte, umkreiste die angrenzenden Viertel, um stets korrekt von der richtigen Seite in die Wohnstraße einzufahren. Wenigstens boten die neu installierten Tempo-30-Schilder eine gute Möglichkeit, daran sein Fahrrad anzuschließen. Als man bemerkte, dass Tempo-30-Schilder keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Fahrzeuge hatten, die die Straße nur durchqueren wollten, lernte man von Parkplatzsuchenden. Blumenkübel zwangen zu einer Slalomfahrt, an der nun viel mehr Fahrzeuge als vor der Aufstellung der Hindernisse teilnehmen mussten, da die Kübel etliches an Parkfläche einnahmen. Alles sollte perfekt werden durch die aufgemalten Fahrradwege. Leider ignorierten Autofahrer und Kurierdienste diese vollständig. So war das Ergebnis nach 15 Jahren angeblich anwohnerfreundlicher Verkehrsberuhigung, dass Anwohner lange umherfuhren, um einen Parkplatz zu finden, Familien aus neuerdings tatsächlich und nicht nur als Verkaufsargument angegebener In-Lage, in die Plattenbauten am Stadtrand zogen und dass er nun mit dem Fahrrad umherfuhr und seinen VW-Bus suchte. Es entstand Fahrradverkehr, den es nicht gegeben hätte und für den auch keine kleinen, lustigen Fahrräder auf den Asphalt hätten gemalt werden müssen, wenn man alles beim Alten belassen hätte.
Er fand seinen Bus heute schnell, da er dort stand wo er das Abstellen in letzter Zeit immer wieder erfolgreich hinbekam. Der Rucksack fand im Fußraum des Beifahrers Platz. Mit der Wiederholung seines Vorsatzes, die nächste Zeit zu entspannen, begann er seine Wanderwoche, konnte aber die vielen Themen, die ihn beschäftigten nicht vollständig aus seinem Unterbewusstsein tilgen.
Der erste Tag einer Wanderung bleibt immer die erste Begegnung mit den wirklichen Anstrengungen. Kein Training kann die Realität vorwegnehmen, keine Routenplanung jede Schwierigkeit vorhersehbar machen. Der erste Tag war erst bewältigt, als er nach einer ausgiebigen Dusche ohne Abendessen wenige Sekunden nachdem er ins Bett fiel, einschlief. Während die Tiefe seiner Schlafphase abnahm, steigerte sich sein Traum in Länge und Klarheit. Er hieß Walter – auch in seinen Träumen.
Jedem Beginn liegt ein Zauber inne. Diesen Sonnabend wird Walter sicher nie vergessen. Mit dem grauen Nieselregen, der Kühle eines durchschnittlichen Novembertages und den lautlosen Bewegungen der dunkel gekleideten Marktbesucher war der perfekte Rahmen für Mystisches vorhanden. Die Stände der Gärtner, die ihre neue Apfelernte präsentierten, boten einen eigenartigen Kontrast zu der ansonsten fast farblosen Tristesse. Doch die Farbtupfer störten nicht. Sie sorgten viel mehr dafür, dass die Gleichförmigkeit des trüben Farbrestes deutlicher wurde. Bunte Äpfel in einer grauen Szenerie, die nicht einmal durch attraktive Geräusche, belebendes Vogelgezwitscher oder Fahrradklingeln aufgebrochen wurde. Es passte alles gut zusammen, um jedermann klar zu machen, es ist November. Die Schwalben waren längst weg, die bunten Sommerkleider waren eingemottet und den Pullovern gewichen und Urlaubspläne würden erst nach Weihnachten konkretisiert werden. Kurz: Es gab wenig die Seele Erhellendes. Und dann gab es an diesem Tag noch die Begegnung mit seiner Lehrerin.
Es war in den Jahren, in denen die Lehrergewerkschaft noch immer erfolglos gegen die Abschaffung des Unterrichts an Sonnabenden kämpfte. Pädagogische Argumente verhinderten den freien Tag für Lehrer. Doch auf die besseren Lernmöglichkeiten für die Schüler, die bei sechs statt fünf Unterrichtstagen gegeben waren, konnten Lehrergewerkschaften keine Rücksicht nehmen, wenn ihre Mitglieder am Sonnabend ausschlafen wollten.
Walters Schule stand direkt neben dem Wochenmarkt. Sonnabends kam es dann immer zu gegenseitig unliebsamer Durchdringung. Marktbesucher stellten ihre Fahrräder auf dem Schulhof ab, auf dem Schüler wegen der begrenzten Zahl von Fahrradständern nur ihre Fahrräder abstellen durften, wenn sie einen Parkausweis hatten. Den gab es nur für Schüler die weiter als drei Kilometer von der Schule entfernt wohnten. Die Marktbesucher kamen aus der näheren Umgebung und hatten ihr Fahrrad meist nur zum Transport des schweren Gemüses dabei. Der Hausmeister legte sich bei Kontrollen der Fahrradabstellberechtigung sehr gerne mit kleinen Schülern an. Die Diskussionen mit ihren Eltern, die sonnabends als Marktbesucher auftauchten, ersparte er sich lieber. Im Unterbewusstsein verbuchte er sein Verhalten als Unterordnung, als Niederlage wegen seines wenig ausgeprägten rhetorischen Talents. Das war für Hausmeister keine Einstellungsvoraussetzung. Wichtigeres Kriterium schien das lautstarke Stimmorgan zu sein, mit dem es täglich galt, kleine Kinder zu drangsalieren.
Sonnabends musste er aber nicht nur vor Marktbesuchern kapitulieren, sondern auch hinnehmen, dass die diensthabenden Lehrerinnen und Lehrer den Pausenhof als Parkplatz für ihre Autos nutzen wollten. Die Lehrer versuchten unbemerkt auf den Hof zu fahren, weil in der Nähe des Wochenmarktes alle Parkmöglichkeiten von den schon früh morgens angerückten Marktbeschickern belegt worden waren.
Die Begegnung von Markt und Schule erschuf eine emsige Menschenmasse, die stillschweigend ihren Interessen folgte, sich dabei berührungslos aneinander vorbei bewegte und sich nur beachtete, wenn der gereizte Trott durch außergewöhnliche Ereignisse beschleunigt wurde. Das war an jenem Sonnabend, der alles änderte, nicht der Fall. Alles ging seinen scheinbar unbeeinflussbaren Gang. Nur für Walter und seine Hexe war es anders.
Seine Lehrerin verteilte Noten für die Klassenarbeiten, die Tage zuvor geschrieben worden waren und längst weit hinter den viel wichtigeren Ereignissen dieser Woche wie in einem Nebel verschwunden waren. Walter erinnerte sich noch daran, ein wunderbares Tor in dieser Woche geschossen zu haben. Von halbrechts anstürmend mit dem Außenrist des rechten Fußes in die kurze Ecke. Der Torwart reagierte nicht einmal bei diesem sowieso unhaltbaren Geschoss. Was aber die richtige Anwendung der binomischen Formeln bei der Mathearbeit betraf, so wäre er nicht einmal mehr von alleine darauf gekommen, dass es diese Formeln immer noch gab. Seine Lehrerin erinnerte alle daran, war aber nicht bereit einen Gedächtnisnachlasseffekt positiv zu berücksichtigen. Es hagelte schlechte Noten. Walter war sauer. Das änderte sich auch nicht nachdem er niemanden fand, auf den er seine Fehler hätte projizieren können. Die miese Matheleistung blieb also unbewältigt und drückte auf seine Stimmung.
Mit dieser Stimmung betrat er in der ersten Pause den Markt, um wie üblich sonnabends vier Pferdebratwürste für eine Mark zu erwerben und am Brett des Imbisswagens mit seinen Freunden gemeinsam zu verschlingen. Es war sein, Walters, sonnabendliches Pausenritual. Wie es Ritualen immanent ist, so wurde auch diese Pausenhandlung nicht mehr hinterfragt, genauso wenig wie die Entscheidung seiner Eltern, ihr Kind Walter zu nennen. Es war einfach so wie es war, so wie morgens die Sonne aufging oder Walter und seine Freunde in der Pause des Sonnabendunterrichts vier kleine Pferdewürste aßen.
Vielleicht lag in dieser ignoranten Verweigerung der Reflektion eigenen Handelns der Verstärker, der ihn auf eine ansonsten vielleicht nicht erkannte Begebenheit aufmerksam werden ließ. Eine äußerst betagt daherschleichende Frau wurde von einem jugendlichen Läufer, der die anderen Marktbesucher wie Slalomstangen umkurvte, angerempelt. Normal wäre jetzt gewesen, dass nichts weiter passierte. Schließlich stand die Frau noch auf ihren wackeligen Beinen und niemand würde davon berührt worden sein, wenn sie sich etwas in ihren grauen, viel zu voluminösen Schal gebrabbelt hätte. Vom Läufer konnte man keine Unterbrechung seiner Gangart erwarten. Doch es kam anders.
Die Alte blieb angerempelt stehen. Sie drehte ihren Kopf, wandte ihren Blick dem jugendlichen Rempler hinterher und dieser wurde durch diesen stechenden, eher strafenden Blick wie von einem unsichtbaren Lasso eingefangen und so abrupt gebremst, dass er fast nach hinten fiel. Er drehte sich um und die Blicke der beiden Aneinandergeratenen trafen sich wie imaginäre Schwerter aus einer billigen Rittersaga.
Am Stand des Pferdewurstbraters passierte nichts, wirklich gar nichts. Niemand maß diesem Treffen von Hexe und Raser irgendeine Bedeutung bei. Nur Walter bemerkte die Energie, die die alte Frau in ihren Blick legen konnte. Eine Energie, die jugendliche Raser zum Stolpern bringen konnte und Pferdewurstesser noch in etlichen Metern Entfernung zu einer Gänsehaut verhalf. Die gewonnene Aufmerksamkeit blieb bei der Alten, denn die Begegnung verlief nicht so weiter wie ihr Verlauf es hätte erwarten lassen können. Wäre der Raser weitergelaufen, hätte die Alte sich kopfschüttelnd wieder ihres Weges gemacht, niemand hätte sich am selben Abend noch an diese Episode erinnert. Es kam aber anders.
Die Alte bemerkte mit welch intensiver Beobachtung Walter vom Imbisswagen aus ihrem Blick die Energie absaugte. Dass überhaupt jemand ihre Fähigkeit wahrnahm, war sehr selten. Sie wandte sich zum Gehen, setzte ihren Weg aber nicht fort. Als wäre sie durch seinen Blick angelockt, kam sie auf Walter zu. Seine kauenden Schulkameraden aßen immer langsamer, nachdem sie die Hexengestalt näherkommen sahen. Als die Alte in Reichweite war, legten sie ihre Pappteller beiseite und warteten ganz passiv auf das Vorhaben dieser vor ihnen stehenden Person, die sie trotz ihrer noch nicht ausgewachsenen jugendlichen Erscheinung um mindestens eine Kopfgröße überragten. Allein Walter blieb nicht nur äußerlich entspannt, sondern harrte in dem Vertrauen aus, das sonst nur Enkel ihrer lieben Oma gegenüber aufbringen, seelenruhig auf den Fortgang der Begegnung.
Es wurden keine Worte gewechselt. Die Alte zog aus ihrem Schal eine Mütze und reichte sie ihm. Er griff ohne Zögern und ohne Hast zu, so wie er es auch getan hätte, wäre diese Übergabe zwischen ihm und einem Freund abgesprochen gewesen. War da dann noch ein leichtes angedeutetes Lächeln auf den Lippen der Hexe? Er war sich sicher, konnte seinen Eindruck aber nicht bestätigen, denn sie wandte ihr Gesicht sofort wieder in ihre Laufrichtung. Als sie sich nach etwa zehn Metern kurz nach ihm umdrehte, sah er das schon nicht mehr, weil er sich ganz der Mütze gewidmet hatte. Deshalb nahm er auch das Funkeln in den Augen der Alten nicht wahr.
Ein orangefarbenes Baseballcap. In dieser trostlosen Herbststimmung auf diesem Wochenmarkt und nach dem Empfangen der Mathematikarbeit wirkte das helle Orange der Mütze wie eine Nebensonne, die an diesem Tag für die Erhellung des Marktplatzes zuständig war. Während seine Freunde ihre überstandene Ängstlichkeit lautstark mit Sätzen feierten, die allesamt mit „Hast du auch gesehen, dass sie…“ begannen, betrachtete Walter das Cap. Er traute sich aber nicht, es aufzusetzen.
Äußerlich sah die Kopfbedeckung aus, wie die, die Handwerker in Baumärkten oder Sportfans in ihren Fanshops kaufen konnten. Es hatte keinerlei Symbol, keinen Schriftzug und Gott sei Dank auch keine Werbebotschaft. Es hatte aber die Ausstrahlung seiner früheren Besitzerin in seinen Fasern. Es fühlte sich wärmer an, als die Umgebung es eigentlich vermuten ließ. Nun ja, sie hatte es vor Kurzem aus einem offensichtlich gut wärmenden Schal gezogen. Aber das Cap war nicht nur warm, es vibrierte. Das wollte er seinem durch die Aufregung ausgelöstem Zittern zuordnen, merkte aber sofort, dass er gar nicht aufgeregt war und somit das Vibrieren eine verborgene Ursache haben musste. Er drehte die Mütze auf der Suche nach etwas Besonderem daran. Er hob es an, musterte die Größe, um befriedigt zu vermuten, es könnte ihm passen. Was hielt ihn davon ab, es aufzusetzen und sich so zum Mittelpunkt seiner Gruppe zu machen, die nun schon bei einem anderen Thema war und den Weg zum Schulhof antrat?
Er konnte die Mütze jetzt nicht aufsetzen, weil es ihm schien, dass das Geschenk der alten Frau damit zu banal gewürdigt werden würde. Er wartete auf den passenden Augenblick für eine richtige Inbesitznahme, ohne zu wissen, wann dieser Augenblick wohl kommen würde undworan er diesen Augenblick erkennen würde.
Obwohl bei der Übergabe kein Wort gewechselt worden war, hatte er aus dem Blick, der Haltung und der übertragenen Energie, deren Verarbeitung ihn überforderte und ratlos ließ, vernommen, mit dieser Mütze hatte es etwas Besonderes auf sich. Er wusste nicht, warum er sich darin so sicher sein konnte und wunderte sich sehr über seine Gewissheit, mit der er jede Wette eingegangen wäre, sogar die, dass Bayern München in dieser Saison nicht Deutscher Fußballmeister werden würde.
Quo vadis, Walter? Als er im Jahr 2020 in die USA flog, lag für ihn die Entdeckung des Cap-Geheimnisses schon Jahrzehnte zurück. Ohne die ihm damals von der Hexe per Cap übertragenen Fähigkeiten wäre er nicht in den Wahlkampf um das US-amerikanische Präsidentenamt geflogen. Sein Leben hätte einen völlig anderen Verlauf genommen und er fing an, parallel zum Schwinden seiner Kräfte, sein Leben für gewöhnlich zu halten. Gewöhnlich nicht im Sinne, das getan zu haben, was andere auch taten. Nein, es war unübersehbar, dass er Besonderes tat. Er tat es, weil er es konnte und daran maß er seine Gewöhnlichkeit. Hätten andere die Chance erhalten, zu tun was er konnte, hätten sie sie auch genutzt. Wer Ungewöhnliches tun will, muss über seine Möglichkeiten hinauswachsen. Dieser Gedanke wurde immer wieder hinterfragt durch die bisher rein rhetorische Frage, warum gerade ihm das Cap überreicht wurde. Hatte die Alte in ihm Fähigkeiten erkannt, die sie an anderen vermisste und ihnen deshalb die Wunderwirkung des Caps verweigert? Bedurfte es eines besonderen Charakters, einer besonderen Haltung, eines eisernen Willens, seine Wunderkraft allein dem Guten zu widmen? Und woran erkannte die Alte damals, dass er den Nutzen der Kopfbedeckung nicht für Feuer und Frevel missbrauchen würde? Bisher, so war er sich sicher, hatte er die Hexe nicht enttäuscht, auch wenn er sich nie über die Gemeinsamkeit in der Beurteilung der Faktoren, die seine Handlungen auslösten, austauschen konnte.
Als er in New York - La Guardia landete lief im Flughafen gerade die neueste Umfrage zu den Chancen der Kandidaten, nächster Präsident zu werden, über die stets präsenten Bildschirme. CNN ließ D.T., the man who must not be named, an J. Biden knapp vorbeiziehen. Walter kam hoffentlich noch rechtzeitig, um den Text auf dem gelben Fließband im CNN-Fernsehbild zu verändern. Wie aber konnte er seine Möglichkeiten wirksam einbringen?
Die immer weiter verschärften Sicherheitskontrollen bei der Einreise, die bereits von Deutschland aus zu buchenden und zu bezahlenden Einreisepapiere, die black-lives-matters-verunsicherten Polizisten, die enorme Waffendichte, die als Ergebnis mehr Waffen als Einwohner in den USA hatte und die hilf- und machtlose Situation der friedlichen US-Bewohner, denen immer klarer wurde, dass Argumente keine Kugeln abhalten, schufen eine jederzeit in seinem Kopf vorhandene Ängstlichkeit vor Fehlern, die er mangels Erfahrung im Umgang mit latent bürgerkriegsähnlichen Zuständen gar nicht als Fehler erkannte. In dieser Gemengelage nahm er sich vor, äußerst konzentriert zu bleiben und merkte schnell, wie anstrengend das ständige Scannen seiner Umgebung war. Zuerst einmal ließ er sich ein Taxi kommen und fuhr in die Bronx. Hier hatte er sich lieber einquartiert, als in dem von Touristen okkupierten Manhattan. Die Wahrscheinlichkeit von Zufallsbegegnungen mit Menschen, die ihn erkannten, schien in der Bronx gegen Null zu tendieren. Diesen Stadtteil sieht nur, wer Manhattan kennt oder ihn auf dem Weg zum Kennedy-Airport mit dem Taxi oder dem Busshuttle durchquert.
Sein Hotel war ein alter achtstöckiger dunkler Klinkerbau, wahrscheinlich aus den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das Gebäude war nach allen Seiten und auf allen Stockwerken mit Fenstern gleicher Größe bestückt. Offensichtlich war es dem Architekten ein Anliegen, den Zimmern nach außen und innen jegliche Individualität zu nehmen. Von außen waren die Zimmerfenster völlig gleichmäßig über die jeweiligen Hausfronten verteilt. An ihrer Anordnung war nicht zu erkennen, ob sie großen oder kleinen Zimmern Licht gaben, ob sie ein Treppenhaus oder einen Lagerraum erhellten. Ihre Gleichförmigkeit schuf eine perfekte Anonymität. Und obwohl er natürlich außer seinem Zimmer kein anderes einsah, war er sich sicher, dass alle Zimmer dieselbe Ausstattung aufwiesen. Abweichungen vom Einerlei der Ausstattung erzwangen bestenfalls die am Mobiliar über Jahrzehnte der Nutzung notwendig gewordenen Reparaturen. Das Hotel war perfekt in seiner Unterstützung für Menschen, die nicht auffallenwollten.
Eine gute Basis ist wichtig für eine erfolgreiche Operation, aber sie stellt eben noch nicht die Operation selbst dar. Hierfür waren seine Pläne alles andere als vollständig ausgearbeitet, ja nicht einmal schlüssig ausgedacht. Er vertraute seinem Improvisationstalent und seinem Cap.
Die ersten Stunden nach Landung verbrachte er vor dem Fernseher in seinem Hotelzimmer. Instinktiv erwartete er durch Dauerfernsehen eher eine Annäherung an die US-amerikanische Seelenbefindlichkeit, als ihr auf Spaziergängen zu begegnen. Bei den meisten US-Bürgern lief zu Hause der Fernseher ununterbrochen. Über den Köpfen der wartenden Flugreisenden an den Gates liefen die CNN-Meldungen, in den Busbahnhöfen derGreyhounds