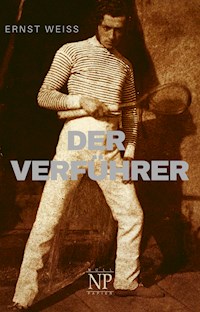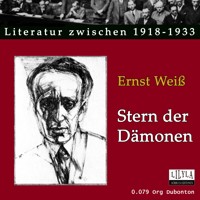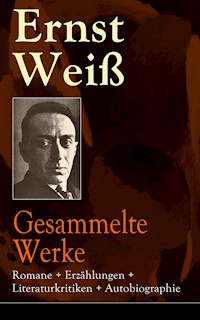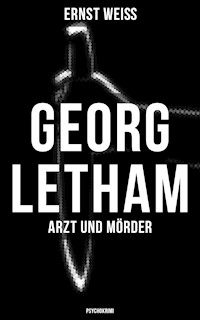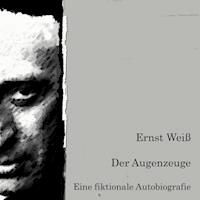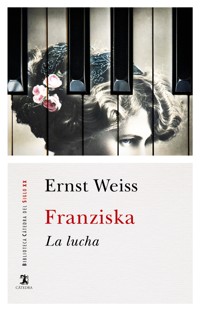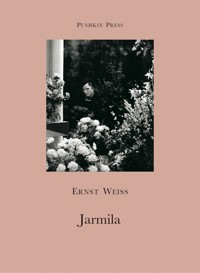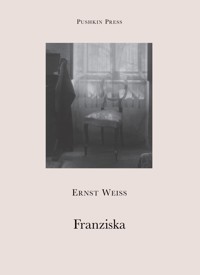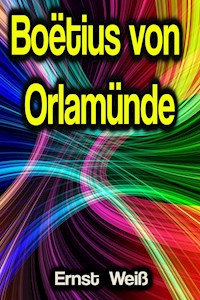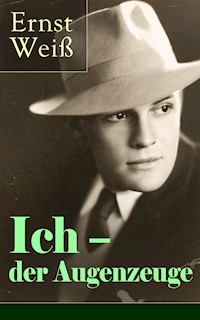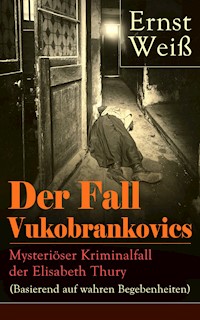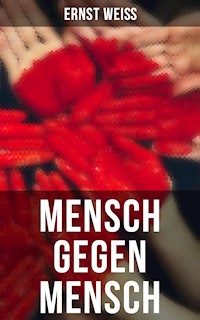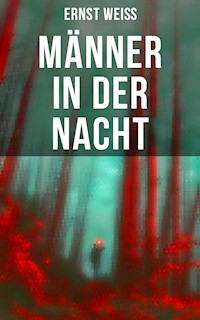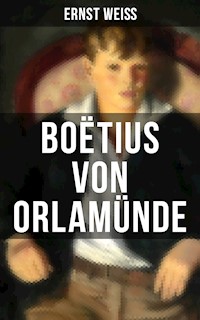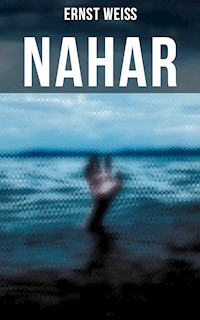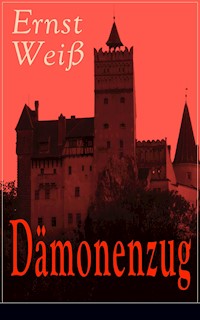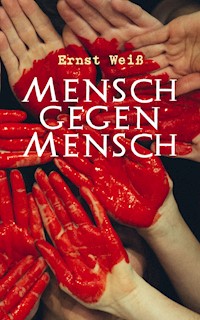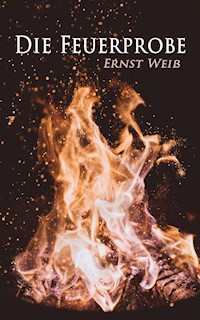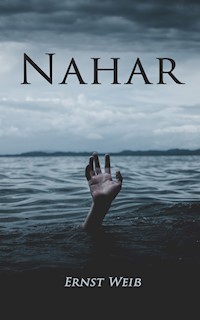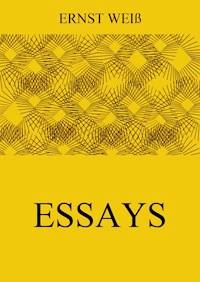
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Sammelband beinhaltet einen umfassenden Querschnitt der besten Essays des österreichischen Autors. Aus dem Inhalt: Über die Liebe Ordnung und Gerechtigkeit Ein Wort zu Macbeth Von Chinas Göttern Östliche Landschaft Mozart, ein Meister des Ostens Recentissime oder die Zeitung als Kunstwerk Aktualität Albert Ehrenstein Goethe Ernest Shackleton Daumier Rousseau Cervantes zu Ehren Der Genius der Grammatik Der Film hat keine Tradition Der neue Roman Der Vorwurf in der Kunst Die Ruhe in der Kunst Die Kunst des Erzählens Credo, quia absurdum Die Freunde Flaubert und Maupassant Adalbert Stifter Das Unverlierbare Ein Wort zu Wedekinds "Schloss Wetterstein" Lebensfragen des Theaters Balzac Frieden, Erziehung, Politik Die Jugend im Roman Jack London ... u.v.m. ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Essays
Ernst Weiss
Inhalt:
Ernst Weiß – Biografie und Bibliografie
Essays
Über die Liebe
Ordnung und Gerechtigkeit
Ein Wort zu Macbeth
Von Chinas Göttern
Östliche Landschaft
Mozart, ein Meister des Ostens
Recentissime oder die Zeitung als Kunstwerk
Aktualität
Albert Ehrenstein
Goethe
Ernest Shackleton
Daumier
Rousseau
Cervantes zu Ehren
Der Genius der Grammatik
Der Film hat keine Tradition
Der neue Roman
Der Vorwurf in der Kunst
Die Ruhe in der Kunst
Die Kunst des Erzählens
Credo, quia absurdum
Die Freunde Flaubert und Maupassant
Adalbert Stifter
Das Unverlierbare
Ein Wort zu Wedekinds "Schloss Wetterstein"
Lebensfragen des Theaters
Balzac
Frieden, Erziehung, Politik
Die Jugend im Roman
Jack London
Conrad
Kleist als Erzähler
Kleist
Tod, Erkenntnis, Heiligkeit
Über die Sprache
Robert Stevenson
James Watt, der Schöpfer des Industriezeitalters
Der Krieg in der Literatur
Heinrich Heine
Prag
Das Ende der Novelle
Franz Kafka, die Tragödie eines Lebens
Bemerkungen zu den Tagebüchern und Briefen Franz Kafkas
Von der Wollust der Dummheit
Essays, Ernst Weiß
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639617
www.jazzybee-verlag.de
Ernst Weiß – Biografie und Bibliografie
Österreichischer Arzt und Schriftsteller, geboren am 28. August 1882 in Brünn, verstorben am 15. Juni 1940 in Paris. Der aus einer jüdischen Familie stammende Weiß war der Sohn des Tuchhändlers Gustav Weiß und dessen Ehefrau Berta Weinberg. Am 24. November 1886 starb der Vater. Trotz finanzieller Probleme und mehrfacher Schulwechsel (unter anderem besuchte er Gymnasien in Leitmeritz und Arnau) bestand Weiß 1902 erfolgreich die Matura (Abitur). Anschließend begann er in Prag und Wien Medizin zu studieren. Dieses Studium beendete er 1908 mit der Promotion in Brünn und arbeitete danach als Chirurg in Bern bei Emil Theodor Kocher und in Berlin bei August Bier.
1911 kehrte Weiß nach Wien zurück und fand eine Anstellung im Wiedner Spital. Aus dieser Zeit stammt auch sein Briefwechsel mit Martin Buber. Nach einer Erkrankung an Lungentuberkulose hatte er in den Jahren 1912 und 1913 eine Anstellung als Schiffsarzt beim österreichischen Lloyd und kam mit dem Dampfer Austria nach Indien, Japan und in die Karibik.
Im Juni 1913 machte Weiß die Bekanntschaft von Franz Kafka. Dieser bestätigte ihn in seiner schriftstellerischen Tätigkeit, und Weiß debütierte noch im selben Jahr mit seinem Roman Die Galeere.
1914 wurde Weiß zum Militär einberufen und nahm im Ersten Weltkrieg als Regimentsarzt in Ungarn und Wolhynien teil. Nach Kriegsende ließ er sich als Arzt in Prag nieder und wirkte dort in den Jahren 1919 und 1920 im Allgemeinen Krankenhaus.
Nach einem kurzen Aufenthalt in München ließ sich Weiß Anfang 1921 in Berlin nieder. Dort arbeitete er als freier Schriftsteller, u.a. als Mitarbeiter beim Berliner Börsen-Courier. In den Jahren 1926 bis 1931 lebte und wirkte Weiß in Berlin-Schöneberg. Am Haus Luitpoldstraße 34 erinnert daran eine Gedenktafel. Im selben Haus wohnte zeitweise der Schriftsteller Ödön von Horváth, mit dem Weiß eng befreundet war.
1928 wurde Weiß vom Land Oberösterreich mit dem Adalbert-Stifter-Preis ausgezeichnet. Außerdem gewann er im selben Jahr bei den Olympischen Spielen in Amsterdam eine Silbermedaille im Kunst-Wettbewerb.
Kurz nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 verließ er Berlin für immer und kehrte nach Prag zurück. Dort pflegte er seine Mutter bis zu deren Tod im Januar 1934. Vier Wochen später emigrierte Weiß nach Paris. Da er dort als Arzt keine Arbeitserlaubnis bekam, begann er für verschiedene Emigrantenzeitschriften zu schreiben, u.a. für Die Sammlung, Das Neue Tage-Buch und Maß und Wert. Da er mit diesen Arbeiten seinen Lebensunterhalt nicht decken konnte, unterstützten ihn die Schriftsteller Thomas Mann und Stefan Zweig.
Ernst Weiß letzter Roman Der Augenzeuge wurde 1939 geschrieben. In Form einer fiktiven ärztlichen Autobiographie wird von der „Heilung“ des hysterischen Kriegsblinden A.H. nach der militärischen Niederlage in einem Reichswehrlazarett Ende 1918 berichtet. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 wird der Arzt, weil Augenzeuge, in ein KZ verbracht: Sein Wissen um die Krankheit des A.H. könnte den Nazis gefährlich werden. Um den Preis der Dokumentenübergabe wird „der Augenzeuge“ freigelassen und aus Deutschland ausgewiesen. Nun will er nicht mehr nur Augenzeuge sein, sondern praktisch-organisiert kämpfen und entschließt sich, auf der Seite der Republikaner für die Befreiung Spaniens und gegen den mit Nazideutschland politisch verbündeten Franquismus zu kämpfen.
Als Weiß am 14. Juni 1940 den Einmarsch der deutschen Truppen in Paris von seinem Hotel aus miterleben musste, beging er Suizid, indem er sich in der Badewanne seines Hotelzimmers die Pulsadern aufschnitt, nachdem er Gift genommen hatte. Im Alter von 57 Jahren starb Ernst Weiß am 15. Juni 1940 im nahegelegenen Krankenhaus.
Wichtige Werke
Die Galeere, Roman, S. Fischer, Berlin 1913Der Kampf, Roman, S. Fischer, Berlin 1916 (seit 1919 Franziska)Tiere in Ketten, Roman, S. Fischer, Berlin 1918Das Versöhnungsfest, Eine Dichtung in vier Kreisen, in: Der Mensch (Zeitschrift), 1918Mensch gegen Mensch, Roman, Verlag Georg Müller, München, 1919Tanja, Drama in 3 Akten, UA 1919 in PragStern der Dämonen, Erzählung, Genossenschaftsverlag Wien/Leipzig 1920Nahar, Roman, Kurt Wolff Verlag, München 1922Hodin, Erzählung, Verlag H. Tillgner, Berlin 1923Die Feuerprobe, Roman, Verlag Die Schmiede, Berlin 1923Atua, Erzählungen, Kurt Wolff Verlag, München 1923Der Fall Vukobrankovics, Kriminalreportage, Verlag Die Schmiede, Berlin 1924Männer in der Nacht, Roman (um Balzac), Propyläen Verlag, Berlin 1925Dämonenzug, Erzählungen, Ullstein, Berlin 1928Boëtius von Orlamünde, Roman, S.Fischer, Berlin 1928 (seit 1930 Der Aristokrat)Georg Letham. Arzt und Mörder, Roman, Zsolnay, Wien 1931Der Gefängnisarzt oder Die Vaterlosen, Roman, Verlag Julius Kittls Nachf., Mährisch-Ostrau, 1934Der arme Verschwender, Roman, Querido Verlag, Amsterdam 1936Jarmila, Novelle, 1937Der Verführer, Roman, Humanitas Verlag, Zürich 1938Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Im Gesamten ist dieser Text zu finden unter http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wei%C3%9F_%28Schriftsteller%29.
Essays
Leser, du vielköpfiges, unfaßbares Wesen, das ich nie ganz begreife und dennoch liebe, was wäre ich ohne dich? Vor wem sollte ich die vielen Figürchen meiner geistigen Marionettenbühne spielen – nein, leben, sterben, weinen, lachen, verzweifeln und lächeln lassen – wenn nicht vor dir und nur für dich?
Verbunden sind und bleiben wir, auch wenn wir uns nie sehen. Vielleicht ist ein echter, männlicher Freund, eine himmlisch schöne und gute Frau unter euch – gerade die Menschen, nach denen ich mich zeit meines Lebens gesehnt habe – einerlei, wir werden einander nie begegnen, es sei denn über den aufgeschlagenen Seiten meines Buches, das durch einen guten Zufall euch in die Hände geraten ist. Vielleicht darf ich aber auch euch etwas sein und bedeuten, kann euch über einen bitteren Tag, eine Enttäuschung in dem Berufe, über einen Nachmittag der Langeweile, über ein hartes Wort eurer Angehörigen hinweghelfen. – Ich möchte es ja so gern. Mehr als das, es ist der einzige Zweck meines Daseins, und selbst nach meinem Tode wird dieses mein Sprechenwollen nicht zu Ende sein. Ich bin euch dankbar, denn ihr habt mir nie etwas Böses getan, oft aber Gutes dadurch, daß ihr meine Bücher durchgeblättert habt – so war ich doch mit dem Wesentlichsten meines Daseins nicht allein. Ihr habt euch mir gegeben – so gebe ich mich euch und grüße euch.
Ernst Weiß zum Tag des Buches 1930
Über die Liebe
Alle Regierungen trifft der Vorwurf, Macht an Recht geschmiedet zu haben. Einige haben es früher getan, haben getrotzt und getrieft von diesem bösesten Glauben, andere haben sich dieses "Kampfargument zu eigen gemacht", gewillt, dem Gegner die Wahl der Waffe zu überlassen, ihn nur durch die Qualität der Waffe zu übertreffen. Die Welt ist greisenhaft geworden. Aus ihren Fugen bröckelt Mißtrauen, das macht sie so schwer zu ertragen, so schwer zu lieben für mich.
Dieses "Recht bedeutet Macht", dieser folgenschwerste aller Fehlschlüsse, ist nicht neu. Er ist unter Darwins Einflusse zu einem Allgemeingut der europäischen Zivilisation geworden; ich finde es bei preußischen, stahlgehelmten Seelen, ich finde es bei Dostojewski, dem ewig wandernden, dem ewig aus Dämonie zur Güte, aus Güte zum Verbrechen schreitenden.
"Freilich, es ist ein Kriminalverbrechen begangen", sagt Raskolnikow, "freilich, der Buchstabe des Gesetzes ist verletzt und" (welch ein und!) "Blut vergossen worden; nun, so nehmt doch für den verletzten Buchstaben des Gesetzes meinen Kopf, und genug damit! In diesem Fall hätten aber auch viele Wohltäter des Menschengeschlechts, die ihre Macht nicht ererbt, sondern sich ihrer bemächtigt haben, gleich bei ihrem ersten Schritt hingerichtet werden müssen. Jene aber haben ihr Ziel beharrlich verfolgt, und deshalb sind sie im Recht; ich aber ..." Mag sein, daß nicht der letzte tiefste Dostojewski aus diesem Raskolnikow spricht, aber ein Dostojewski spricht aus ihm. Denn Raskolnikow sagt hier sein Bekenntnis, der menschlichste Verbrecher, der Mann des Leidens, der Mensch, der das Wunder Sonja erlebt hat, die christliche Heilige der Demut, Dostojewski, der Mann auf der Brücke, der guten Entscheidung zugewandt. Raskolnikow ist ein guter Mensch. Ist er es nicht? Ist er nicht der brüderliche Bruder, der liebende Sohn, der künftige gute Gatte? Sein Verbrechen hat er eisern eingeschlossen in den starren Kampf des fieberhaften Wirbels aller Seelen, er steht davor und schützt es mit dem Letzten, das er hat; aber er verrät es doch, er verrät sich selbst, dem Fremden? Dem Säufer in der Erniedrigung, der Dirne auf dem demütigen Weg? Nein, dem präsumtiven Bräutigam der Schwester, Rasumichin; er gibt sich hin aus brüderlichen Schutz- und Schirmgefühlen, aus Obsorge für die arme, seelenempfindliche Mutter. Der Mörder, der gute Sohn.
Leonhard Frank, über dessen hohen Willen zur Menschlichkeit wir uns im tiefsten freuen, schildert seinen Helden, der vorbewußt gemordet hat; er hat gemordet, nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Sehnsucht nach Erlösung, nach Freiheit der Erinnerung; aber ein Mörder ist er; und als dieser Mensch vor der Todesstrafe steht, erscheint seine alte Mutter, rührend mit Kissen für die Nacht beladen, Tränen, menschlichstes Gefühl hier wie dort. Wer stünde hier ohne Ergriffenheit zwischen dem Blut und den Tränen und fragte nach der Mutter des gemordeten alten Lehrers, seiner Tochter, nach seinen "Lieben"? Aber auch hier, wer sieht dies nicht, der Mörder, der gute Sohn.
Der Mörder ist der Mensch der Macht. Er ist mehr als der böse Gedanke, der verruchte Trieb. Es ist außerdem das Können, das "den Verhältnissen gewachsen sein", es ist die Bestätigung, die richtige Erfüllung des Höllischen, das in unserer Gesellschaft, in unserem Miteinander ist. Hier – auf der einen Seite, Gewalt, dort – auf der andern Seite, Gefühl, hier "Recht bedeutet Macht", dort dieses Unsagbare, dieser einzig herrliche Weg, das " ich liebe", der wunderbare Umschwung der Seele. Dieses Hier und Dort vereinigt sich nicht. Eines lügt, denn das Ganze lügt.
Die Zeit ist so, daß Blindheit vielleicht Freude und alle Seligkeit wäre, sicher aber Unrecht ist. Ich will nicht blind sein. Zu erkennen glaube ich einen Zusammenhang zwischen Familienliebe und Mord. – Ich sehe die Tastatur der Seele verschoben um einen Ton, alles ist um eine Stufe heraufgerückt oder herab, das relative Gleichgewicht, die lügnerische Harmonie ist erhalten, und doch, jede Taste schlägt falsch, und an der Dissonanz zerschmettert sich alle Welt bis zur letzten Verzweiflung.
Die Liebe, die ich im Bewußtsein besonderer Güte an meine Mutter, an mein Kind wende, diese Liebe fehlt der Welt.
Die Liebe, die ich im Bewußtsein besonderer Güte wende an meinen Glauben, an meine Erinnerung, an der Heimat hohes warmes Haus, an meine Sprachverwandten, die meines Atems, mehr als das, meines Blutes sind, mit Blut wird diese Liebe jetzt gezahlt. Und nie ganz gezahlt. Wer hat den infamen Mut, von "unnützen Opfern" zu reden, die etwa ein unvorsichtig oder ein gar zu rücksichtslos eingesetzter Angriff gekostet hat? Kein Opfer kann nützlich sein, kein Erfolg lohnt Blut, nichts wird gebessert durch gewaltsamen Tod, keine Idee ist das Leben wert.
Ich verachte, ich hasse bis zum letzten Fanatismus jede Idee der Meistbegünstigung.
Sprache, Nationalität, Glauben sollen einem seelisch Fremden recht geben auf meine Liebe, weil Nationalität Stammesverwandtschaft ist.
Meine Sprache nenne ich Muttersprache oder Mutterlaut, und es ist notwendig, solche Redensarten der Lesebücher zu packen und zu zerreißen, zu zerschmettern in Atome, denn sie selbst haben mich und meinesgleichen gepackt und zerrissen.
Weil ich die schutzlose Schwester treu im Herzen trage, weil ich sie schütze vor der bösen Welt, deshalb ist die Welt böse. Der Kern ist die böse "Verbrüderung", die Entmenschung durch die Familie. Der Kern ist die Mutter, in der ich lügnerisch und ohnmächtig sentimental "mein besseres Teil" liebe, da ist, da starrt, heute noch unangetastet, ehern die letzte Grenze, die ich um mich schlage.
Wer wundert sich über das Mißtrauen, den stinkenden, faulenden Unglauben, der strategische Sicherungen, der Landesgrenzen fordert, der einverstanden ist mit einer Wiederholung der fürchterlichsten Weltbefleckung unter der einzigen Voraussetzung, daß er und vor allem seine Kinder geschützt seien durch Meistbegünstigung: "der Kampf? Gut, der Kampf. Aber nur im Feindesland, und wer es wagt, einem mir durch Familienbande oder Sprach- und Landgemeinschaft Verwandten ein Haar zu krümmen, der büße in der bittersten Verdammnis!"
Mißtrauen ist verbrecherisch, mehr als das heiße Verbrechen eines ist – berauschte Tat, denn es verseucht wie Pest die Welt. Ich verurteile in jeder Form das Mißtrauen gegenüber der allgemeinen, grenzenlosen Güte des Menschen, gegenüber der Fähigkeit des Menschen an sich, geliebt zu werden. Daran möchte ich selbst immer glauben.
Sind aber die "Tatsachen", die "Geschichte" (die doch nur eine Geschichte des Bösen im Menschen ist), ist das alles zu stark, zu beweisend, ist also in der menschlichen Seele nicht Güte, kann sie durchaus nicht geliebt werden bis zu ihrer tiefsten gemeinsten Inkarnation, dann ist Hölle in der menschlichen Seele, dann fehlt Hölle der Mutter nicht, meiner Mutter fehlt Hölle nicht, und kein Kind ist frei von den Pranken des Satans, und mein Kind trägt Mörderblut an seinen Händen und in seinen Adern unter seinesgleichen.
Wer hat den infamen Mut, wer hat sich tief genug gewälzt in Unverschämtheit, um nach diesen vier fürchterlichsten Jahren voller Scheußlichkeiten, die die Menschheit teils ertragen hat, teils ausgeteilt hat, sich noch im Spiegel zu sehen, sich auszunehmen, sich als einzelnen gut und menschlich zu finden, seine Familie, seine Nation zu verteidigen gegen die allgemeine Verdammnis? Kann Erfolg, kann "restloser Sieg", kann höchster Triumph der Macht jemandem das Gefühl des Rechtes geben?
Und wohin nun? Wohin heute, am 2. Oktober 1918?
Es heißt, daß man nur "in Nationen denken" kann. Nationen, behaupten noch die am meisten Gemäßigten, seien die niedrigste Recheneinheit der Geschichte.
Wären sie es nur, könnten sich Ideen und Grammatikbücher und Landesgrenzen, "Schollen" bekämpfen und losstürzen mit Überfällen auf ihresgleichen und sich gegen ungerechte Angriffe von ihresgleichen wehren.
Wozu sollen Menschen gegen Menschen stehen, wenn Ideen sich mit Ideen bekriegen wollen?
Aber hier ist es: Nicht steht einfach Mensch gegen Mensch, sondern der Mensch mit einer höheren Idee "opfert sich" im Kampf gegen Menschen mit einer noch höheren Idee – oder mit noch mehr Macht. Von der Macht schweigt man dem einzelnen gegenüber, aber mit "noch höheren Ideen" wird nicht gespart. Er soll nicht für sich selbst sterben und leiden, drei Tage verdurstend, durch den Ischiatikus-Nerv geschossen in der zusammengestürzten Kaverne am Monte Cimone liegen, denn was soll diesem alle Macht, alle Zukunft, alle "wirtschaftlichen Vorteile und Aufschwünge", alle nationalen Lebensnotwendigkeiten? Er hat ausgesorgt.
Aber er hat andere, die ihm nahe sind, Meistbegünstigte, denen er unberechtigte Liebe zugeschanzt hat, denen zuliebe er die ganze Menschheit, Gott und das Tier, alles, alles verraten hat, und für diese verrät er sich selbst. Nein, der gute Sohn der guten Mutter (inmitten der leider auf ewig bösen Welt) war im guten Glauben. Im besten Glauben sparte er nicht mit der Todesstrafe, um "seine armen guten Geschwister zu schützen".
Seit langem war die Liebe, das Herrliche, das grenzenlos Schwingende organisiert, sie "ging auf Karten". Anteil hatte jede Blutsverwandtschaft. Wo aber war die "Vagabundage der Liebe", das "liebet euren Nächsten wie dich selbst", wo aber nie der Mann des verwandten Blutes gemeint war, sondern der zufällig Nächste, jeder, der gerade des Weges kam; daß man bei dem ersten, der kommt, beginnen muß mit der Erlösung der Welt, das ist der Sinn.
Häuft man aber verrucht in Geiz und Mißtrauen die Liebe in den sicheren Speichern der unverlierbaren, unzerstörbaren Mitglieder der Blutsverwandtschaft und Sprachverwandtschaft auf, dann wundere sich niemand, wenn Blut in springenden Fontänen über die Geizigen stürzt und der Haß der brennenden Sprache auch die Fernsten vergiftet in der innersten Seele.
Ordnung und Gerechtigkeit
l
Wer wie ich überzeugt ist, daß diese unsere Höllenwelt von 1918 keineswegs mit dem Mobilisierungstag begonnen hat, wer mit mir in den letzten Jahren nur eine mystische Verwandlung der ewig über dem Dasein ruhenden bösen Mächte in sichtbare, greifbare, fühlbare sieht, der muß gesegnet sein mit einem aufrührerischen Optimismus, einem fanatischen Glauben an das Endlich-Gute. Denn sonst ertrüge er das Dasein nicht.
Mir schwebte schon vor Jahren vor, die Höllenkreise darzustellen, wie sie über die Oberfläche der Jahre 1910 oder 1911 dahinrollten. Ich sah nicht wie Dante die Hölle zugänglich gemacht durch eine moralische Stufenleiter, die im Dämonischen wurzelt und sich verliert ins Seraphische, seelisch Unbeseelte. Hölle war mir die Anschauungsart eines mit besonderen Sinnen Begabten, die Erlebnisform eines mit Gerechtigkeit Belasteten.
Wenn ich im Winter über die ausgefransten, mit Tod infizierten Korridore eines Wiener Hospitals zu fürchterlich der Welt Entgegensterbenden gehen mußte, konnte ich nicht mehr an eine letzte Erlösungsfähigkeit eines solchen Daseins glauben. Nach der Schlacht und dem Rückzug bei Rawa-Ruska war mein Gefühl: Nie kommt Gott, nie komme ich über dieses Rawa-Ruska, den Herbst 1914, hinweg, nie hinüber über den Saal 13 a, in dem die weiblichen Krebs-Pestkranken liegen, nie wölbt sich über uns der wolkenlose Himmel der klingenden Sphären.
Wo gibt es Freiheit für uns? Wo tagt der Gerichtstag, auf dem Gott ewig den Verteidigungsprozeß führt zugunsten der Welt und seiner selbst? Die Welt vor meinen Augen stand auf, die Welt vor meinen Füßen bäumte sich. Die Hölle um mich stieß durch die Feigheit meiner Seele, und Flucht sah ich nirgends. Ich war zu Hölle verdammt, während Amtsgenossen bloß einen "gewiß ja ein wenig strapaziösen Dienst machten, der aber nun doch einmal von jemand gemacht werden mußte".
Es gibt unter allen eine große Zahl handfester Optimisten, die durchaus soldatisch empfinden, die das von ihnen stündlich Erlebte mit dem letzten Hauch der Seele glühend ableugnen, von sich fernhaltend alle pessimistischen und nervösen Herren. Die Stütze dieser Menschen ist durchaus nicht immer Macht (die schließlich jeder gewinnt oder besitzt, besonders über sich selbst, den er durch Verleugnen und "absichtlich blind sein" unendlich stärken kann), sondern Ordnung ist ihr Halt. Nicht die Erschütterbarkeit, das ist die Menschlichkeit, gibt ihnen Trost, Ruhe, Heiterkeit, sondern die Ordnung, das arithmetische Verhältnis der Existenzen zueinander, die kalte Relation, die blinde Zahl, der "Kopfstrich", wie es in militärischen Haushaltungsbüchern genannt wird, ein senkrechter Strich in einer Rubrik, ein "Mann", ein gottloses Phantom, seelenlos.
Was diesen Menschen aber unbegreiflich bleibt, vom ersten bis zum letzten Tag, was sie nie ahnen, was sie daher bewußt nie bekämpfen können, ist Gerechtigkeit.
2
Ich stimme Romain Rolland in seiner Hoffnung auf eine Internationale des menschlichen Geistes, auf einen Bund menschlichster Gesinnung durchaus zu, wie ich jeder guten Hoffnung als einem vorwärtstreibenden, irgendwie Gott fördernden Motor zustimme, aber ich sehe gleichzeitig die Schwierigkeiten dieser Kristallisation: Ohne tiefste Verallgemeinerung wäre dieser Weltbund der Liebe machtlos, vergeblich, bloß ein Verein schöner Seelen. Geht man aber so weit, alle Menschen zu begnadigen, sie zu verherrlichen bis in ihre letzte Spur, sie in ihrer ganzen Wirklichkeit einzusetzen in den Schwung unserer Idee, sie zu verwirklichen, statt sie faustisch-sentimental auf das alte Später-Früher, Streben-Werden zu vertrösten, dann steht die nackte Hölle in unserem Bruder vor uns, gegen uns, über uns. Es ist ganz nutzlos, das gutklingende, leicht hingeschriebene und immer besänftigende Wort "Bruder" dorthin zu setzen, wo man sonst Konkurrent, Erbfeind, Idiot, Autokrat, Chauvinist, Wucherer, Blutsauger, Feind mit einemmal für allemal gesagt hat.
Hauptsache scheint mir: das Böse in den Mitlebenden, in allen Mitlebenden im tiefsten Herzensgrunde, also von Gott an, zu sehen, zu erkennen und trotzdem zu lieben oder ganz zu verzichten auf eine Verbrüderung hier oder dort. Was soll uns das "Liebet eure Feinde!"? Das Rufzeichen allein, das Kommando: seid voll Liebe, das könnte schon die Wolke des Segens, die sich auf das "Liebet" niedersenkt, verscheuchen mit böse funkelndem Gendarmensäbel, mit schwarz qualmenden Flammenwerfern. Aber daran allein liegt es nicht.
Der "Feind", das ist die einer Verallgemeinerung, einer Weltvertiefung unzugängliche Perspektive. Der "Feind" ist das im schlechten Sinne Unverantwortliche. Der "Feind" ist der in böser Ordnung Eingeordnete, der Abgeurteilte. Von diesem Urteil bis zum Todesurteil ist ein weiter Weg, aber es ist doch ein Weg. Man muß tiefer gehen: Muß entweder Gott leugnend sich auf reine Zweckmäßigkeitsmaßnahmen beschränken, wissend, daß es bloß Zweckmäßigkeit, Polizeisinn ist, was sie diktiert. Dann ist eben der Feind bloß der Ruhestörer, der seinen geringen Spaß mit unseren teuren eigenen Interessen bezahlt, er ist der zufällig Böse, der schlecht befestigte Ziegelstein am Dach, der auf die Straße herabhängende, elektrisch mit 10 000 Volt geladene zerrissene Hochspannungsdraht: man komme mit Isolierhandschuhen heran, versorge ihn zweckmäßig, aber was soll Liebe einer Zufälligkeit gegenüber – hier schweige Gerechtigkeit. Oder muß man Gott als das Höchst-Denkbare, als das Höchst-Wünschbare mit dieser Höllenexistenz konfrontieren, man stelle sein Bild oder das eben für ihn gebrauchte Religionssymbol neben den Galgen, nicht aber auf den Richtertisch, trage es auf beiden Fronten entwickelten Schlachtlinien voran und pflanze es in Schützengrabennester, die mit Handgranaten ausgeräuchert werden, binde es an Tanks, die "erledigt" werden, statt es, wie bisher, bloß bei Soldatenvereidigungen und bei offiziellen Tedeums vorzubringen, denen doch nur die Gesundgebliebenen, also der Idee des Krieges widerrechtlich Entgangenen beiwohnen.
Ich glaube an die Möglichkeit einer neuen Menschheit unter einem neuen Gott. Soll aber Gott weiter existieren und endlich wirkend in uns werden, statt ewig widersprechend, soll er bei uns tagen, statt ewig isoliert zu starren, dann beginne die Revolution bei ihm. Statt Furcht und Demut: Freiheit und Liebe.
Ist aber Gott inkommensurabel, von ihm aus zu uns, dann sei er's auch, von heute an, vom Jahr der Hölle 1918, auch von uns aus zu ihm.
3
Wenn wir Gott mit der von uns aus gesehenen, bewußt ganz anthropomorphen Gerechtigkeit konfrontieren, bäumt sich Ordnung auf: bürgerliche Ordnung, "göttliche Weltordnung. Man verweist bei den fürchterlichen Teufeleien der Welt auf die Harmonie der Gestirne, und wenn unsere Liebe zu Gott so groß glühend wird, daß sie gerecht zu sein beginnt und Gottes Wirklichkeit in die Wirklichkeit unserer liebenden Seele herüberträgt mit gewaltig schwingenden Armen, dann drängt man uns von der Erwirklichung Gottes fort zur Bescheidenheit, vergleicht das Menschliche mit dem vergänglichen Wurm (als ob man wüßte, was "Wurm" ist, und was die Vergänglichkeit für ihn), nennt mich eine armselige, menschliche Kreatur, mit Blindheit geschlagen, zur Vergänglichkeit bestimmt. Gut, zur Vergänglichkeit, aber lange noch nicht zur Vergeblichkeit. Für mich ist eben diese menschliche Kreatur das letzte, das denkbar Nächste, wenn auch nicht das einzig Denkbare. Und auf die Stelle, die meine Sehnsucht offen läßt, setze ich Gott, nicht als Herrn, sondern als Kameraden.
4
Ordnung ist nur scheinbare Gerechtigkeit. Sie gibt dem durchaus Zufälligen, Ephemeren, den Thron der höchsten Gewißheit. Die "Familienordnung", die "Schulordnung", das sind die Fabriken der Liebe, die Fabriken des Geistes. Bürgerlicher Aufbau, scheinbar pyramidenhaft auf dem festesten Fundament fußend, im Innern ist er unwirklich, gehalten durch üble Worte, nicht durch Seele, sich neu gründend Tag für Tag, nicht auf Tat, sondern auf Arbeit, vermittelnd zwischen Ich und Du nicht durch Annäherung menschlicher Strahlung, also Glück, sondern wieder nur durch eine Ordnungsart, eine Kategorie der Macht, ein arithmetisches Gespenst, das in falscher Gleichung Glück bedeuten soll und Geld heißt.
Daß unser ganzes System auf einen imaginären Nullpunkt des Gefühls aufgebaut ist, den man Objektivität nennt, und der nie da war, und der dem Begriff der Menschlichkeit, also der Erschütterbarkeit direkt widerspricht, das fühlen wir heute besonders tief: da die streitenden Parteien den Frieden auf dem Boden der Objektivität, der "gerechten Interessen", der "wirklichen Lebens- und Entwicklungsnotwendigkeiten" suchen, statt auf dem der Liebe um jeden Preis; jeder gute Friede müßte ein solcher um jeden Preis sein, denn die Gerechtigkeit selbst wirkt um "jeden Preis", und das macht ihre Göttlichkeit aus, ihre Brücke zu Gott.
5
Gerechtigkeit ist keineswegs der Versuch auszugleichen, unbekümmert, unbeteiligt, ungerührt mit harter Seele dazustehen, sich mühsam zu vereisen auf dem Nullpunkt des Gefühls. Gerechtigkeit ist vielmehr Parteinahme im tiefsten Glauben, durch den tiefsten Glauben an das Endlich-Gute. Zu lange hat man Gott entweder als Opfer eines Justizmordes gesehen und sich abgehärtet gegen die ewig mit dieser durch den Justizmord befleckten Welt, oder man sah Gott als Strafrichter, als Kriminalist, den die Tat erst als geschehene Tat angeht, der sieht, aber nicht spricht, der "objektiv" liebt und Ruhe und Neigung zu seelischen Versuchen und Versuchungen hat. Wir sehen Gott tiefer mit der Welt verwandt. Wir wollen nicht, daß die ganze Ungerechtigkeit des Daseins am Rücken des gegenwärtig Angeklagten zerbricht. Wir fühlen, und das ist der Kern unseres aufrührerischen Optimismus, daß die Entscheidung über die Welt nicht, noch nicht gefallen ist. Deshalb lehnen wir jedes Gericht von Grund aus ab und glauben, daß nie durch Mittel der Macht, nie durch ausgleichende Strafen, nie durch züchtigende Strafrute Gottes, diese Höllenwelt gerettet werden kann, sondern nur durch seinen Kuß, durch seine Kameradschaft, durch sein "Nebeneinander-Ineinander" im beschwingten Schweben der endlichen Zeit.
Ein Wort zu Macbeth
Die Darstellung von Macbeth auf unserer modernen Bühne ist wohl immer und überall ein Problem für Schauspieler und Regisseure geworden. Das liegt zum Teil an den im Laufe der Jahrhunderte vollständig verschobenen Bedingungen, unter denen dieses Drama aufgeführt wurde.
Im allgemeinen gibt es zwei Typen: Entweder der Versuch, das konzentrierteste Leben, die im Anprall aneinander zündenden Funken, die sprechende, handelnde und leidende Menschenseele in ihrer stärksten Verdichtung auf die Bühne zu stellen als eine Art Expression; als treibende Kraft die Freude an den gesteigerten, oft ins Ungeheure ausblühenden Äußerungen der menschlichen Seele; Liebe, Haß, Kampf und Überwindung. Der andere Typus ist die Illusionsbühne, wie sie uns im Anschluß an die realistischen Darlegungen Zolas, Tolstois und Gorkis von Reinhardt gegeben worden ist. Hier ist der Zuschauer die Hauptaufgabe, er soll sich in die Bühne versetzen, soll das Proszenium überbrücken und ein Stück wirklichen Lebens nach Ende der Aufführung nach Hause tragen.
Wir können annehmen, daß die Darstellung zu Shakespeares Zeiten im höchsten Grade den Charakter der Expression gehabt hat, und zwar läßt sich gerade dies aus den zeithistorischen Dramen schließen. Gerade das Schicksal der eben mitlebenden oder eben vergangenen Generation, die Königsgeschicke der eben herrschenden oder eben abgesetzten Dynastie, ja selbst die Landschaft Londons, der Tower und die Brücken und Plätze der Stadt, all dies hätte niemals auf einer Illusionsbühne Platz gefunden; es bedurfte unbedingt der höchsten Zusammenballung in Darstellung und Dichtung, um nicht als Nachahmung der politischen Ereignisse zu erscheinen, die damals die politische Welt und jedes private Leben beschatteten. Wir können uns nicht denken, daß wir heute das Schicksal Nikolaus des Zweiten oder des Kaiser Wilhelm in Reinhardtscher wirklichkeitstreuer Wiedergabe ertragen könnten. Sollen diese Dinge auf uns wirken, sollen sie nicht ganz verblassen neben den Erinnerungen an das schaudernd Miterlebte, bedürfen wir eines monumental über alle Zeit gestaltenden Genies, eines Menschen, der zum zweiten Male als Gott, und als Gott in einer anderen Sphäre, die Welt zerschlägt und wieder und wieder aufbaut.
Als Darstellungsmöglichkeit könnte man sich hier nur eine durchaus stilisierte Bühne denken, wobei Stil immer Einfachheit, nicht aber Langeweile bedeutet, wo die Schöpfung auf der Ausstrahlung der aufs höchste gesteigerten Seele der Darsteller beruht, nicht aber auf Menschenansammlungen, deren grobe Mechanik dem Kommando eines Regisseurs gehorcht, der mehr Turnlehrer als Künstler ist.
Gleichgültig, wer die Dekorationen zeichnet. Vorausgesetzt, daß der Darsteller selbst imstande ist, aus sich heraus die gleichgültigste Leinwand und das konventionellste Versatzstück zu beseelen, werden wir mit den geringsten äußeren Behelfen die größte Wirkung erzielen. Ich glaube, daß nie eine Zeit günstiger ist für diese Wiedergeburt der Tragödie über Raum und Zeit aus der Seele als die unsere, denn sie hat Ehrfurcht vor dem Großen gelernt, wenn sie nicht glaubt, so hungert sie doch danach, glauben zu können; wenn sie nicht hingerissen ist, so sehnt sie sich danach, hingerissen zu sein.
Unter den Dramen, die zuerst in Betracht kämen, scheinen mir Shakespeare und die antike Tragödie zu sein. Die antike Tragödie ist freilich in den letzten Jahren diesem Ideal schon ziemlich nahe gebracht worden, da die ungeheuren Dimensionen der Seele und die durch keine Kunststücke zu brechende Rhythmik eine naturalistische Darstellung nicht zuließen. Shakespeare aber ist die Hoffnung auch unserer Generation; die Erwartungen, die sich an ihn knüpfen, können nicht zu hoch gespannt sein, die Wirkungen, die wir von ihm erwarten, werden alles übertreffen, was die übrige dramatische Darstellung im Augenblicke bieten kann.
Unter den Dramen Shakespeares sind es wieder die magischen Stücke, welche die größten Aufgaben für Darsteller und Regisseur bieten, sie gestalten am vollkommensten ein Werk, abseits der unseren und jenseits der bürgerlichen Sphäre.
Hamlet, Macbeth, Sturm, das ist der Kreis. Das Drama, das am leichtesten darzustellen ist, ist Hamlet. Sind nur für die Hauptrollen genügend starke Darsteller gefunden, kann das Drama auf jeder Bühne, unter allen Umständen und auf alle Menschen wirken. Dieses Glück verdankt es nicht der Geschlossenheit seines Aufbaues, sondern seiner vollkommenen Zerrissenheit. Die Spiegelung des Menschen im Problem, die Spiegelung des Problems im Menschen ist so grenzenlos, so bis ins letzte durchgeführt, daß die einzelnen Stücke des Werkes, Akte, Szenen, Augenblicke immer harmonieren werden, daß jede Darstellung vollkommen sein kann. Das Werk wird immer den Charakter der Zeit tragen, in der es gegeben wird, es war ganz 1900 mit Kainz, er war ganz 1920 mit Moissi. Es ist ein Kuriosum, aber wie alle Kuriosa charakteristisch, daß selbst eine Frau, Sarah Bernhardt, sich in dieser Rolle zeigte, es kann sich jede große Seele in ihr zeigen, denn Hamlet ist das Problem der Problemlosigkeit, die Frage nach dem moralischen Beginn von Schuld und Sühne, das Suchen nach dem geometrischen Ort, jeglicher menschlicher Begegnung: Vater und Sohn, Hölle und Erde, Thron und Kerker, Geist und Element. Wirklichkeit und Spiegelbild.
Ist bei Hamlet jedem phantastischen Künstler eine Welt eröffnet, in der er sich nur ausleben darf nach seiner eigensten Weise, um dem ganzen Werke Genüge zu tun, so ist bei Macbeth der Kreis der Möglichkeiten viel enger umgrenzt. Auch Macbeth ist ein phantastisches Stück. Es ist ein Drama der Dämonen. Nicht nur Hexen, Geister, Nebel und Moor sind Dämonen, sondern, was viel tiefer geht, die sogenannte Wirklichkeit, die pragmatische Weltgeschichte ist den Dämonen Untertan, sie stützt Macbeth, begünstigt sein Verbrechen, macht sich mitschuldig an seinem Mord. Der eigentliche Held des Stückes tritt nicht auf. Er spricht durch den Mund von Urwesen, er ist der Geist, der die Lady begeistert und sie mit einer unmerklichen Bewegung aus dem bewußtesten, klarsten, überlegten Geschöpf umwandelt in ein flatterndes Segel, das sich dem Hauche des Unnennbaren beugt. Gleichgültig, was den Vorwurf des Dramas zu seiner Zeit gebildet hat. Lächerlich die Königskrone, wo es gilt, im Widerstreite gigantischer Dämonen Partei zu ergreifen. Die Handlung steigt aus einer niederen Sphäre der Prophezeiung und Wirklichkeitsdeutung zu einem ganz ungeheuren Problem: Macbeth will Ehre, begehrt gierig einen Thron. Aber indem er in das Böse eintritt, wie in eine den Weg abkürzende Gasse, steigt das Böse über ihn. Nie hat ein Mörder so viel Glück im Mord und an dem Mord gehabt. Die ganze Welt ist nur im Mord und durch den Mord gestaltet, alles spricht ihm zu, nirgends ein Hindernis, nie ein Widerstand, und das Ungeheuerste: Hier ist ein Mensch geschaffen, Böses zu tun, von Gott auserkoren, die Hölle zu sein, und weiß es. Er weiß es nicht allein. Daß die einzigen Menschen, die versöhnt, die miteinander vermählt leben, Mörder sind, so furchtlos, so heimisch im Blut, im ungeheuersten Wirbel ruhig die Welt an sich vorüberziehen lassen, die tief zu ihren Füßen liegt, kaum mehr erkennbar ihren Blicken; daß Königtum, Macht, Recht und Gesetz, Freude und Dasein, Angst vor Hölle, Furcht vor dem Himmel, ja überhaupt alle menschlichen Beziehungen völlig hinschwinden unter dem Hauch dessen, den ich als unsichtbaren Haupthelden des Dramas denke, das macht das nie ganz darstellende, aber immer zu ahnende Grundproblem dieses Dramas aus. Tiefste Mystik, dargestellt durch die kälteste, von schärfster Berechnung geleitete Handlung.
Auch hier wird man das allergrößte Gewicht auf die äußerste Herausarbeitung des Seelischen geben müssen.
Macbeth ist wie Hamlet ein Mysteriendrama, keine Königstragödie. Für die Einzelheiten dieses Dramas kann keine einfache Lösung gefunden werden. Das Werk ist zu groß, das Problem zu unergründlich, als daß das Drama auf eine einfache Formel gebracht werden könnte, wie dies noch bei "Hamlet" oder im "Sturm" möglich ist.
Es haben sich im Laufe der Jahrhunderte unzählige Bearbeiter an dem Stück versucht. Wenn ich es unternommen habe, noch eine neue Fassung vorzuschlagen, so war dieser Versuch durch meine persönliche Liebe zu dieser Schöpfung begründet. Es schweben mir zwei Wege vor: entweder das Drama in seiner Urgestalt aufzuführen, und zwar unter Verzicht auf Dekorationen auf einer Andeutungsbühne. Es ist möglich, daß gerade durch die Vielfalt der einzelnen Szenen, durch den ewigen Wechsel von Menschen und Seelen, im Zusammenklang dennoch etwas ganz Einheitliches entsteht. Wohl sind die Elemente nach Größe und Tiefe ganz verschieden. Aber sie sind im tiefsten Grunde in der gleichen Weise orientiert, und selbst in den schwächsten Szenen weht noch ein Hauch der großen Idee. Es sind dies Spiegelszenen, ein Stück im Stück. In einer Beziehung das, was Kierkegaard die Paradoxie des Wahren nennt, wo das Leben mit sich selbst spielt, wo sich zwei zertrümmerte Gestirne in einer ruhenden Fläche spiegeln.
Die zweite Möglichkeit, und dies ist meine Gruppierung der Szenen, beruht in einer radikalen Herausarbeitung des Wesentlichen. Kann man die Umwelt, alle kleinen Statisten des ungeheuren Weltgeschehens, die Mitbeteiligten des gigantischen Gottesdramas, nicht vollkommen darstellen, wie sie der Dichter geschaffen hat, so muß man, wie ich glaube, ihre Äußerungen aufs allernotwendigste beschränken, die ganze Nebenhandlung, das ist die Welt der bürgerlichen Sphäre, reduzieren, die Frage nach der königlichen Thronfolge und nach den zukünftigen Geschicken Schottlands als Nebenfrage betrachten und alles den Hauptdarstellern geben. Der von allen Seiten von Dämonen umgebene Macbeth werde mit Umgehung aller zwischen seinen Rivalen sich abwickelnden sekundären "historischen" Vorgänge in einen ungeheuren Schlußakt hineingesteigert. Will man auf diese bürgerliche Sphäre nicht ganz verzichten, deute man sie nur an, etwa als den Grund, auf dem sich diese Pyramide erhebt, damit man mit Schaudern und Bewunderung die Größe menschlicher Leidenschaft, die Gottgebundenheit und den Wirbel der Hölle nebeneinander erkennt.
Da Macbeth wahr ist, wird er nie wirklich sein. Da Macbeth sittlich ist, kann eine moralisierende Wirkung nie von ihm ausgehen. Um so intensiver muß die große Linie, die Shakespeares tiefstem Meisterwerk zugrunde liegt, bis zum Ende durchgeführt werden.
Von Chinas Göttern
1
Perzynski, der Autor eines Buches, das der Verlag Kurt Wolff vor kurzem unter obenstehendem Titel veröffentlicht hat, hält es in seiner Einleitung für nötig, seine Art des künstlerischen Reisens zu verteidigen gegen den Vorwurf, man könnte es für die zeitvergeudende Beschäftigung geistig verkümmernder Menschen halten. In den letzten sechs Jahren, die offenbar dem Entstehungsjahr des Buches gefolgt sind, hat sich freilich gezeigt, daß geistig verkümmernde Menschen andere Arten von Betätigung gesucht haben, und es ist ebenso bitter als wahr, daß die ungeheuerste Ansammlung von Macht mit dem geringsten Aufwände von Geist verknüpfbar ist, daß die vernichtendsten Kämpfe, bei denen der einzelne weniger bedeutet als ein Kilogramm Messing, ganz unter Ausschaltung jeder Idee durchgefochten werden, das Sinnbild dieser Jahre scheint das öde und maschinenmäßig bemalte bunte Flaggentuch zu sein, das Menschen der gleichen westlichen, freilich schwer verrotteten Zivilisation gegeneinander antreten ließ.
Aus Perzynskis Buch lernen wir eine vollständig kampfesmüde und wie es scheint militärisch unfähige, politisch ziellose Welt kennen: China. Perzynski hat sich seine Sache manchmal leicht und, man möchte sagen, eben dadurch schwer gemacht. Denn er vermittelt uns mit lässiger Hand die Welt, von der er unzweifelhaft neue Teile entdeckt hat, im Vorübergehen, an unnötiger Stelle bei Kochrezepten verweilend, die nicht ganz so bezeichnend für das Land sind, als es dem mehr körperlich als geistig ausgehungerten Reisenden erscheinen mag. Immerhin hat er sich den Blick in der richtigen Einstellung gewahrt, und das Buch bringt als Wesentlichstes unerhörte Reste alter Bauwerke und herrlich lebende Trümmer jahrtausendealter Skulpturen. Diese sind von ungeheurer Eindringlichkeit, von einer unerschütterlichen Glaubensstärke; Bewunderung und Ehrfurcht sind mein einziges Gefühl. Neugierde und der Reiz des Exotischen entschwinden vollkommen.
Man hat oft den Eindruck bei chinesischen Kunstwerken, daß es sich um Erzeugnisse einer überfeinerten Kultur, um etwas Barockes handelt. Hier zum ersten Male sieht man Dinge von solcher Größe, von so mächtigen seelischen Dimensionen, jenseits aller Formate, daß man sie als klassisch bezeichnen würde, wenn das Wort nicht einen akademischen Beiklang hätte. Perzynski hat in den Grotten von Ichou ein Götterstandbild entdeckt, einen "Lohan", offenbar nur einen kleinen Rest von zahlreichen anderen Kunstwerken, die inzwischen im wahrsten Sinn des Wortes in den Staub zerfallen sind, aus dem sie kamen. Aber dieser kleine Rest lebt. Es ist der Zeus von Otrikoli Chinas. Ein Mann ohne Haare, mit breiten Wülsten über den Augen, ein Lächeln unendlichen Ernstes um den breiten Mund, das Erkennen der Verruchtheit der Welt in gewaltigen Furchen des Antlitzes und einen Blick von solcher Intensität, von solcher Göttlichkeit, daß er uns eine ganze Welt zu spiegeln scheint und doch bleibt, was er ist: Blick eines vergöttlichten Menschen. Die Herrschergewalt ist so überzeugend, daß sie eher tröstlich als bedrückend wirkt. Und dieses Gefühl von Trost, von Ruhe in aller Verwirrung bleibt sich treu selbst im Anblick der furchtbarsten Zerstörung, die das Schicksal dieses Gottes war und das Verhängnis des Volkes, das diesen Gott geschaffen hat und mit ihm unterging. Und über alle Wahrscheinlichkeitsrechnungen der Vernunftshistoriker und Tatsachen-Rechner fühlt man, daß Leben und Tod eines Volkes nicht durch die Einführung von Eisenbahnen und durch die Verluste und Gewinne "an Mensch und Material" entschieden werden können. Es ist mehr als China zugrunde gegangen. Aber es gibt auch da Auferstehungen. Haben wir Götter, deren Gestalten Menschen noch nach Jahrtausenden das Schweigen tiefster Ergriffenheit abzwingen werden?
2
Die Wellen der Weltgeschichte und des Weltgeschehens pflanzen sich nicht in gerader Richtung fort. Alles, was wir von vergangenen Epochen wissen, ist Fragment, und es ist kaum möglich zu sagen, ob gerade die überlebenden Fragmente gerade die wichtigsten waren.
Wir nähern uns in Europa, wenn nicht alle Anzeichen trügen, einer zweiten Renaissance chinesischen Geistes. Die erste geht in die späteren Jahrzehnte des achtzehnten Jahrhunderts zurück, und vieles, was wir bei dem großen und sehr klugen Voltaire bewundern, war die erste Auferstehung chinesischen Geistes, sein Lächeln, weise und mild zugleich, war das eines östlichen Weisen, seine Abwehr des Katholischen und Christlichen war ein Abglanz des asiatischen Panzers, der das menschlichste Herz umschloß, das je in der Brust eines französischen Spötters und Kavaliers gelebt hat.
Die Französische Revolution war im letzten Sinn die Auswirkung dieser Ideen, sie war der Versuch, den großen Entscheidungskampf zwischen Gott und der Welt aus der Seele des einzelnen in die Seelen ganzer Klassen zu verlegen. Die furchtbaren Hungersnöte, die grauenhaften Leiden der niederen Stände, die den Revolutionsjahren vorausgingen, hätte die christlich-katholische Menschheit so beantwortet, wie es das christlich-katholische Spanien getan hat, nämlich mit dem Aussterben der Bevölkerung, mit der Verödung einst blühender Provinzen und mit dem Fortbestande der alten, zwar längst Lügen gestraften, aber doch unzerstörbaren Mächte: des Herrschertums von Thron und Altar.
Die Französische Revolution ging nicht an das Metaphysische, sondern an das Wirkliche, nicht die Erbsünde wird bekämpft, sondern die großen und kleinen Mißstände, man betet nicht mehr, sondern ordnet die Welt. Man ordnet. Man ordnet die Welt einem Sinn unter, einer Idee, einer Utopie, einem Schlagwort, das Schlagwort ist falsch, aber es gibt den Menschen eine ungeahnte Stärke, einen riesenhaften Willen zum Leben. Dieses Wort lautet: Der Mensch ist eines Fortschritts fähig. Er ist zu erziehen. Die ganze Revolution ist nichts als ein grandioser Erziehungsversuch, niemand kann das Schulmeisterliche in der Bewegung verkennen, und wenn auch Rousseau den Fortschritt der Menschheit in seinem berühmten Versuch geleugnet hat, so lautet doch der Titel seines Ewigkeitswerkes Emile, und die Bekenntnisse, die Beichte seines Erdenlebens sind nicht die Geschichten seiner Abenteuer und Begegnungen, sondern die Geschichte seiner Erziehung durch sich selbst und durch die Welt. Gleichviel, was das positive Ergebnis war, die Einstellung ist es, der unbezähmbare Elan, der unerschütterlich brennende Glaube an den Adel des Menschen, der wert ist zu leben, also auch wert, erzogen zu sein. Das ist die Maxime der chinesischen Weisen, und von hier wäre auch eine Brücke zu schlagen zu dem Lebenswerk des Arnos Komenius, zu dem tiefsten Geheimnis der böhmischen Wälder.
Hier möchte ich nur auf ein zweites Fragment des Ostens hinweisen. Wie der Lohan als Fragment einer alles überragenden plastischen Kunst Ostasiens in unsere Tage ernst erschütternd hinüberragt, ist es ein Monument einer ungemein reichen schöpferischen, glücklichen Zeit, die dem Denken und Schaffen des Konfuzius und Lao Tse nachfolgte. Urälteste Tradition, Kritik an allem schon Erreichten, tiefinnerste Gläubigkeit, zusammengefaßt in einem Erziehungswerk freiester Fügung. Gespräch, Anekdote, Mirakel, Tier- und Menschenfabel, das alles und noch mehr ist der fast unerschöpfliche Inhalt des Werkes, an das ich denke: Dschuang Dsi. Das wahre Buch vom südlichen Blütenland. Es ist schon vor fast zehn Jahren in einer Sammlung östlicher Weisheit erschienen, die der in Europa unerreichte Verlag des Eugen Diederichs in Jena erscheinen läßt.
Die Lehre des Dschuang Dsi ist groß, sie ist umfassend und mehr als das, sie ist beglückend. Sie erfaßt die Welt und vernichtet sie nicht. Sie erkennt das Böse und leugnet es nicht. Sie weiß, daß der Mensch böse ist von Urbeginn, und glaubt doch an ihn, denn was wäre der Sinn des Lebens eines Weisen, wenn nicht die Erziehung? Sie begnügt sich nicht mit der sichtbaren Welt, die zu ermessen und zu messen ist, sondern er nimmt mystischen Aufschwung in das unbegrenzte und nie zu ermessende Reich. Aber das ist keine Mystik des müden Unterganges, sondern die des aufblühenden Lotus, der aufgehenden Sonne, des aufrauschenden, unbeschreiblich mächtigen, unbeschreiblich freudigen Vogels Rockh.
Das höchste und tiefste, das dieser Mensch der Vorzeit uns zu geben hat, ist eben diese Vereinigung des Tiefsten mit dem Höchsten. Es ist eine Religion der Versöhnung, nicht auf dem Boden eines Dogmas, also auch nicht auf dem Boden des ewig unerfüllbaren: Liebet einander, sondern durch den Weg, den er jedem zu (seinem) innersten Erlebnis, zum Sinn des Lebens führen will. Dann gehen alle Farben ein in den unwandelbaren Regenbogen der Vereinigung. Er ist der einzige Weltgelehrte, der die Weltanschauung nicht durchsetzen, sondern alle Weltanschauungen zur Ruhe bringen will. Keine Zeit konnte so dürsten nach der Ruhe und der Vereinigung wie die unsere. Und unsere Zeit, kann man ihr auch nachsagen, wieviel man will und wieviel sie verdient, sie hat viel gelitten; und hier, in der Freude des lichten Ostens, könnte sie Heilung finden; wenn irgendwie und irgendwo, so im südlichen Blütenland.
Östliche Landschaft
In einem Augenblick, da China von neuem im Mittelpunkt des politischen Interesses steht, ist jede Aufklärung über östliche Kultur doppelt erfreulich. Es ist heute so, daß chinesische Philosophie, als die einzige wirklich friedliche, mitten im Herzen Europas Fuß zu fassen beginnt, daß chinesisches Kunstgewerbe in London mit Gold aufgewogen wird: Und da es sich um letzte Reste, um Bruchstücke, um Reliquien handelt, um