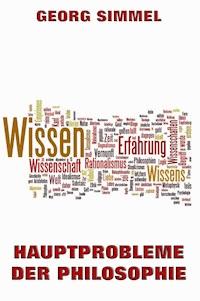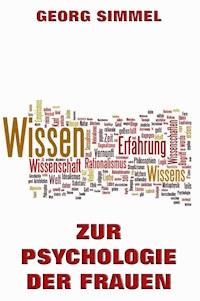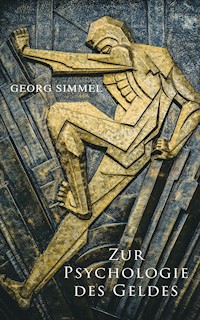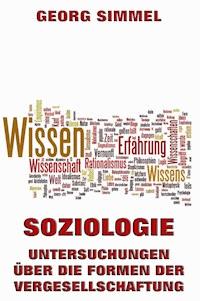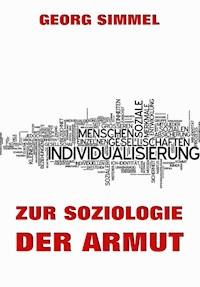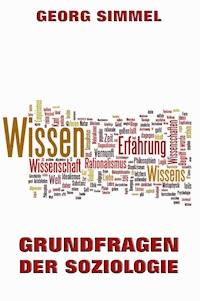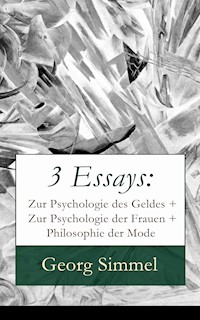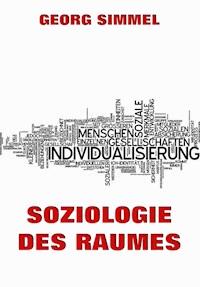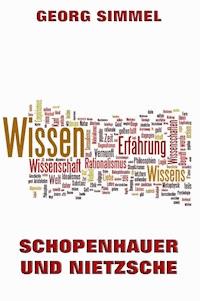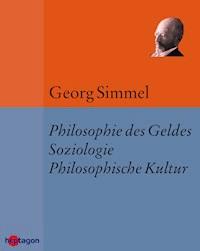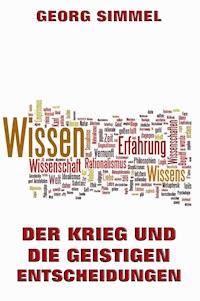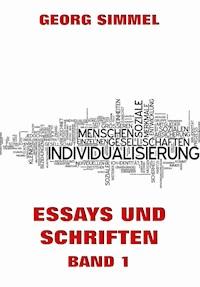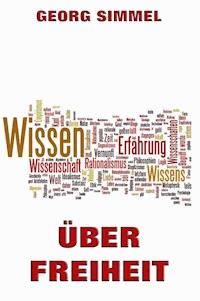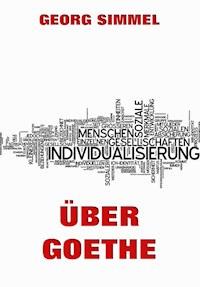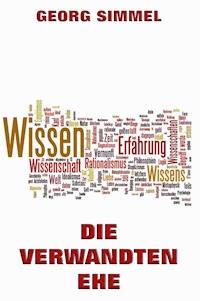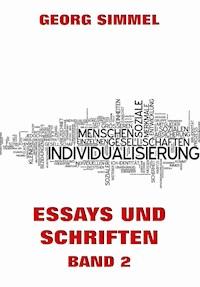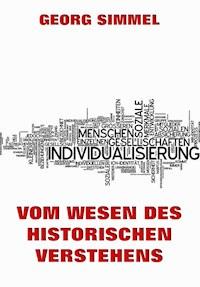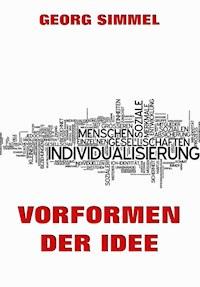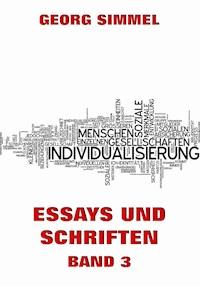
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet die folgenden Werke Simmels: Psychologie der Diskretion Psychologie der Koketterie Schopenhauers Ästhetik und die moderne Kunstauffassung Skizze einer Willenstheorie Soziologie der Geselligkeit Soziologie der Konkurrenz Soziologie der Mahlzeit Soziologie der Sinne Soziologische Ästhetik Stefan George - Eine kunstphilosophische Studie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Essays und Schriften, Band 3
Georg Simmel
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Psychologie der Diskretion
Psychologie der Koketterie
Schopenhauers Ästhetik und die moderne Kunstauffassung
Skizze einer Willenstheorie
Soziologie der Geselligkeit
Soziologie der Konkurrenz
Soziologie der Mahlzeit
Soziologie der Sinne
Soziologische Ästhetik
Stefan George - Eine kunstphilosophische Studie
Essays und Schriften, Band 3, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849617288
www.jazzybee-verlag.de
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Psychologie der Diskretion
Dass alle Beziehungen zwischen Menschen auf dem Wissen ruhen, das der eine von dem anderen hat - dies ist eine Tatsache von so banaler Selbstverständlichkeit, dass man nicht leicht an die gar nicht selbstverständlichen Nuancen und Maßbestimmungen dieses Wissens denkt und wie sehr sie, als Ursache und als Wirkung, die Sonderart jedes Verhältnisses charakterisieren.
Denn nicht nur, was der eine von dem andern weiß, sondern dessen Verwebung mit dem, was er von ihm nicht weiß, gibt der Beziehung ihren Ton, ihren Umfang, ihr Tiefenmaß.
Bei vollkommener gegenseitiger Durchsichtigkeit wären alle Verhältnisse der Menschen in einer gar nicht abzusehenden Weise abgeändert, wie sie bei vollkommenem Nichtwissen umeinander unmöglich wären.
Es ist bedeutsam, dass man gerade die oberflächlichste Beziehung, für die die moderne Kultur einen besonderen Begriff geprägt hat, als "Bekanntschaft" bezeichnet.
Dass man sich gegenseitig "kennt", bedeutet in diesem Sinne durchaus nicht, dass man sich gegenseitig kennt, d. h. einen Einblick in das eigentlich Persönliche der Individualität habe; sondern nur, dass jeder sozusagen von der Existenz des anderen Notiz genommen habe.
Indem man aussagt, mit einer bestimmten Person bekannt, ja selbst gut bekannt zu sein, bezeichnet man doch sehr deutlich den Mangel eigentlich intimer Beziehungen.
Der Grad des Kennens, den das "gut miteinander bekannt sein" einschließt, bezieht sich nicht auf das, was ein jeder an und in sich, sondern nur, was er in der dem anderen und der Welt zugewandten Schicht ist.
Deshalb ist die Bekanntschaft in diesem gesellschaftlichen Sinne der eigentliche Sitz der "Diskretion", Denn diese besteht keineswegs nur in dem Respekt vor dem Geheimnis des anderen, vor seinem direkten Willen, uns dies oder jenes zu verbergen, sondern schon darin, dass man sich von der Kenntnis alles dessen am anderen fernhält, was er nicht positiv offenbart.
Hier kommt die auch sonst wirkungsvolle Empfindung zu Worte, dass um jeden Menschen eine Reihe ideeller Sphären von mannigfaltigstem Umfang und Richtung liegen, in die einzudringen den Persönlichkeitswert des Individuums zerstört.
Die "Ehre" legt einen solchen Bezirk um uns: die Sprache bezeichnet eine Ehrenkränkung treffend als ein "Zunahetreten" - der Radius jener Sphäre gleichsam markiert die Distanz, deren Überschreitung durch eine fremde Persönlichkeit die Ehre kränkt.
Eine andere Sphäre lässt das, was man die "Bedeutung" eines Menschen nennt, um ihn wachsen.
Dem "bedeutenden" Menschen gegenüber besteht ein innerer Zwang zum Distanzhalten, der selbst im intimen Verhältnis mit ihm nicht ohne weiteres verschwindet und der nur für denjenigen nicht vorhanden ist, der kein Organ zur Wahrnehmung der Bedeutung hat.
Darum existiert jene Distanzsphäre nicht für den "Kammerdiener", weil es für ihn keinen "Helden" gibt, was aber nicht an dem Helden, sondern an dem Kammerdiener liegt.
Darum ist alle Zudringlichkeit mit einem auffallenden Mangel an Gefühl für die Bedeutungsunterschiede der Menschen verbunden.
Und ein solcher, von wie anderen Werten auch akzentuierter Umkreis umgibt den Menschen, besetzt mit seinen Angelegenheiten und Beschaffenheiten, deren bloße Kenntnisnahme ein Zunahetreten ist.
Wie das materielle Eigentum gleichsam eine Ausdehnung des Ich ist, und wie deshalb jeder Eingriff in den Besitzstand als eine Vergewaltigung der Persönlichkeit empfunden wird, so gibt es ein seelisches Privateigentum, in das einzudringen eine Lädierung des Ich in seinem Zentrum bedeutet.
Diskretion ist nichts anderes als das Rechtsgefühl in Bezug auf die hiermit bezeichnete Sphäre, deren Grenze freilich nicht ohne weiteres festzulegen ist; denn das Recht jenes seelischen Privateigentums kann so wenig ganz unumschränkt bejaht werden wie das des materiellen.
Wie allenthalben Einschränkungen des individuellen Besitzes, sei es durch gesetzliche Gebote und Verbote über Erwerb und Verkehr, sei es durch Besteuerung im Interesse des sozialen Ganzen zu Recht bestehen, so gilt dies auch für die innere Sphäre.
Im Interesse des Verkehrs und des sozialen Zusammenhaltes muss der eine vom andern gewisse Dinge wissen, und dieser andere hat nicht das Recht, sich vom moralischen Standpunkt dagegen zu wehren und die Diskretion des anderen, d. h. den ungestört eigenen Besitz seines Seins und Bewusstseins auch da zu verlangen, wo die Diskretion die gesellschaftlichen Interessen schädigen würde.
Der Geschäftsmann, der mit einem anderen langsichtige Verpflichtungen kontrahiert; die Herrschaft, die einen Dienstboten engagiert; der Vorgesetzte, der einen Untergebenen avancieren lässt; die Hausfrau, die eine neue Persönlichkeit in ihren Geselligkeitskreis aufnimmt - alle diese müssen berechtigt sein, von der Vergangenheit und Gegenwart des fraglichen anderen, von seinem Temperament und seiner moralischen Beschaffenheit alles das zu erfahren oder zu kombinieren, worauf sich die Beziehung ihm gegenüber oder ihre Ablehnung vernünftigerweise gründen lässt.
Aber auch jenseits dieser groben Formen ruht in feineren und weniger eindeutigen, in fragmentarischen Ansätzen und Unausgesprochenheiten der ganze Verkehr der Menschen auf einem gewissen Recht auf Indiskretion, ruht darauf, dass jeder vom andern etwas mehr weiß, als dieser ihm willentlich offenbart, und vielfach solches, dessen Erkanntwerden ihm, wenn er es wüsste, höchst unerwünscht wäre.
Der Umfang dieses Rechtes ist, wie gesagt, sehr schwer zu bestimmen.
Im allgemeinen spricht der Mensch sich das Recht zu, alles das zu wissen, was er ohne Anwendung äußerer illegaler Mittel, rein durch psychologische Beobachtung und Nachdenken ergründen kann.
Tatsächlich aber kann die auf diese Weise geübte Indiskretion ebenso gewalttätig und moralisch unzulässig sein wie das Horchen an verschlossenen Türen und das Hinschielen auf fremde Briefe.
Für den psychologisch Feinhörigen verraten die Menschen unzählige Male ihre geheimsten Gedanken und Beschaffenheiten, nicht nur obgleich, sondern oft gerade weil sie ängstlich bemüht sind, sie zu hüten.
Das gierige, spionierende Auffangen jedes unbedachten Wortes; die bohrende Reflexion: was dieser Tonfall wohl zu bedeuten habe, wozu jene Äußerungen sich kombinieren ließen, was das Erröten bei der Nennung eines bestimmten Namens wohl verrate - alles dies überschreitet die Grenze der äußerlichen Diskretion nicht.
So sehr der anständige Mensch aber sich solches Nachgrübeln über die Verborgenheiten eines anderen, solche Ausnutzung seiner Unvorsichtigkeiten und Hilflosigkeiten verbieten wird, so besteht hier doch eine besondere Schwierigkeit: Erkenntnisse dieses Gebietes stellen sich oft so automatisch und ohne absichtliches Nachdenken ein, sie stehen oft so unübersehbar vor uns, dass es selbst dem besten Willen zur Diskretion nicht gelingt, sich des geistigen Antastens "alles dessen, was sein ist", zu enthalten.
Jedenfalls aber ist innerhalb der hier berührten Verhältnisse kein Zweifel, dass prinzipiell eine Diskretionspflicht besteht, wie unsicher auch ihre Grenzen sich zeigen.
Viel weniger aber wird die Anschauung des "gesunden Menschenverstandes" - in der freilich die Gesundheit den Verstand zu dominieren pflegt - solche Beziehungen unter den Aspekt von Recht und Pflicht stellen, die, mindestens ihrer Idee nach, die ganze Breite der Persönlichkeit vorbehaltlos umfassen.
Die hauptsächlichen Typen sind hier Freundschaft und Ehe.
Das Freundschaftsideal, wie es von der Antike aufgenommen und eigentümlicherweise gerade im romantischen Sinne fortgebildet worden ist, geht auf eine absolute seelische Vertrautheit, die hier auch oft erreichbarer scheint als in der Liebe, weil der Freundschaft die einseitige Zuspitzung auf ein Element fehlt, die die Liebe durch ihre Sinnlichkeit erfährt.
Andererseits wird diese Einseitigkeit oft die Bahn brechen, auf der die andern Beziehungskräfte, die ohne die Liebe latent geblieben wären, ihr folgen.
Unleugbar öffnet bei den meisten Menschen die geschlechtliche Liebe die Tore der Gesamtpersönlichkeit am weitesten, ja bei nicht wenigen ist sie die einzige Form, in der sie ihr ganzes Ich geben können.
Es sind keineswegs nur die weiblichen Naturen, bei denen das ganze Sein und besonders dessen sonst unzugängliche, unschmelzbare Teile in der Liebe gleichsam chemisch gelöst werden und nur und ganz in deren Färbung, Gestalt, Temperatur auf den andern überfließen.
Wo aber das Liebesgefühl nicht expansiv genug, die übrigen Seeleninhalte nicht fügsam genug sind, kann, wie ich andeutete, das Überwiegen der erotischen Verbindungslinie die übrigen sowohl praktisch-sittlichen wie geistigen Berührungen, das Sich-öffnen der jenseits des Erotischen liegenden Reservoire der Persönlichkeit hintanhalten.
Deshalb mag die Freundschaft, der diese Heftigkeit, aber auch diese Ungleichmäßigkeit der Hingabe fehlt, eher den ganzen Menschen mit dem ganzen Menschen verbinden, mag eher die Verschlossenheiten der Seele, zwar nicht so stürmisch, aber in breiterem Umfang und längerem Nacheinander lösen.
Diese völlige Vertrautheit dürfte indes mit der wachsenden Differenzierung der Menschen immer schwieriger werden.
Vielleicht hat der moderne Mensch zuviel zu verbergen, um eine Freundschaft im antiken Sinne zu haben, vielleicht sind die Persönlichkeiten auch, außer in sehr jungen Jahren, zu eigenartig individualisiert, um die volle Gegenseitigkeit des Verständnisses, des bloßen Aufnehmens, zu dem ja immer so viel auf den andern eingestellte Divination und produktive Phantasie gehört, zu ermöglichen.
Es scheint, dass deshalb die moderne Gefühlsweise sich mehr zu differenzierten Freundschaften neigte, d. h. zu solchen, die ihr Gebiet nur an je einer Seite der Persönlichkeiten haben und in die die übrigen nicht hineinspielen.
Damit kommt ein ganz besonderer Typus der Freundschaft auf, der für unser Problem: das Maß des Eindringens oder der Reserve innerhalb des Freundschaftsverhältnisses von größter Bedeutung ist.
Jene Freundschaften, die uns mit einem Menschen von der Seite des Gemütes, mit einem anderen von der der geistigen Gemeinsamkeit her, mit einem dritten um religiöser Impulse willen, mit einem vierten durch gemeinsame Erlebnisse verbinden, können zwar trotz der Umgrenztheit ihres Gebietes echte und wirkliche Freundschaft sein, die tiefsten Wurzelsäfte der Persönlichkeit können sie tränken.
Aber gerade dann stellen sie in Hinsicht der Diskretionsfrage, des Sichoffenbarens und Sichverschweigens die strenge Forderung: dass die Freunde gegenseitig nicht in die Interessen- und Gefühlsbezirke hineinsehen, die nun einmal nicht in die Beziehung eingeschlossen sind und deren Berührung die Grenze des gegenseitigen Sichverstehens schmerzlich fühlbar machen würde.
Aber diese Rücksicht, statt das Verhältnis zu irritieren, bringt vielmehr, in den guten Fällen, eine neue Zartheit hinein, ja eine neue Gemeinsamkeit.
Denn allenthalben wirkt ein beiderseitiges Vermeiden empfindlicher oder steriler Gebiete als eine unterirdische Nähe, als ein wortloses Sichverstehen, das an verbindender Kraft manchem positiven Momente gleichkommt.
Viel diffiziler liegt die Abmessung des Sichoffenbarens und Sichzurückhaltens, des Eindringens und der Diskretion, in der Ehe.
Die Schwierigkeit erwächst aus der Eigentümlichkeit der modernen Eheform gegenüber denen anderer Kulturen: dass in diesen die Ehe prinzipiell kein erotisches Institut war und ist, sondern eines, das von vornherein nur auf gewisse Sonderzwecke, besonders ökonomisch-sozialer Natur, angelegt ist, nicht auf das Sichgeben des ganzen Menschen, das der erotischen Verbindung eigen ist; und indem dem Prinzip nach die letztere die moderne Ehe fundamentiert, erhebt sich erst für sie das Problem jener freiwilligen Reserve, in der die Diskretion besteht.
In der ethnologischen und vielfach in der antiken Welt ist mit der Ehe die Befriedigung der Liebeswünsche nur akzidentell verbunden, sie wird, natürlich mit Ausnahmen, nicht aus der individuellen Attraktion, sondern aus Gründen der Familienverbindung, der Arbeitsverhältnisse, der Nachkommenschaft geschlossen.
Zu äußerst klarer Differenzierung haben es in dieser Hinsicht die Griechen gebracht, laut Demosthenes: "Wir haben Hetären für das Vergnügen, Konkubinen für die täglichen Bedürfnisse, Gattinnen aber, um uns rechtmäßige Kinder zu geben und für das Innere des Hauses zu sorgen." Nun wird niemand verkennen, dass auch innerhalb des modernen Lebens die Ehe wahrscheinlich überwiegend aus konventionellen oder materiellen Motiven eingegangen wird.
Allein, gleichviel wie oft verwirklicht, die Idee der modernen Ehe ist die Gemeinsamkeit aller Lebensinhalte, die den Wert und das Schicksal der Persönlichkeiten bestimmen.
Und dass dies, wenn auch nur als ideale Forderung, besteht, ist durchaus nicht wirkungslos; es hat oft genug Raum und Anregung gegeben, eine ursprünglich sehr unvollkommene Gemeinsamkeit zu einer immer umfassenderen zu entwickeln.
Aber während gerade die Unbeendbarkeit dieses Prozesses der Vergemeinsamung das Glück und die innere Lebendigkeit des Verhältnisses trägt, pflegt seine Umkehrung schwere Enttäuschungen zu bringen: wenn nämlich die absolute Einheit vorweggenommen wird, Verlangen wie Darbieten keinerlei Zurückhaltung kennt, selbst diejenige nicht, die für alle tieferen und feineren Naturen noch immer in den dunklen Gründen der Seele bleibt, wenn sie sie ganz vor dem andern auszuschütten meinen.
In der Ehe wie in eheartigen freien Verhältnissen liegt die Versuchung sehr nahe, in der ersten Zeit völlig ineinander aufzugehen, die letzten Reserven der Seele denen der Körperlichkeit nachzuschicken, sich vorbehaltlos aneinander zu verlieren.
Dies aber wird meistens die Zukunft des Verhältnisses erheblich bedrohen.
Ohne Gefahr können nur diejenigen Menschen sich ganz geben, die sich überhaupt gar nicht ganz geben können, weil der Reichtum ihrer Seele in fortwährenden Weiterentwicklungen besteht, so dass jeder Hingabe sogleich neuer Erwerb nachwächst, in denen eine Unerschöpflichkeit latenter seelischer Besitztümer ruht und die diese deshalb so wenig mit einem Male offenbaren und wegschenken können, wie mit den verschenkten Jahresfrüchten eines Baumes die des nächsten Jahres vergeben sind.
Anders aber bei denen, die mit den Aufschwüngen des Gefühles, der Unbedingtheit einer Hingabe, der Offenbarung ihres Seelenlebens sozusagen vom Kapital nehmen und damit dem typisch-menschlichen Triebe nachgeben: die Henne zu schlachten, die die goldenen Eier legt; bei denen es an jener gar nicht zu offenbarenden und von dem Ich gar nicht ablösbaren Quellkraft immer neuen seelischen Gewinnes fehlt.
Da liegt denn die Chance nahe, dass man sich eines Tages mit leeren Händen gegenübersteht, dass die dionysische Schenkseligkeit eine Verarmung zurücklässt, die noch rückwirkend - ungerecht, aber darum nicht weniger bitter - sogar die genossenen Hingaben und ihr Glück Lügen straft.
Wir sind nun einmal so eingerichtet, dass wir nicht nur einer bestimmten Proportion von Wahrheit und Irrtum als Basis unseres Lebens bedürfen, sondern auch einer solchen von Deutlichkeit und Undeutlichkeit im Bilde unserer Lebenselemente.
Was wir bis auf den letzten Grund deutlich durchschauen, zeigt uns eben damit die Grenze seines Reizes und verbietet der Phantasie, ihre Möglichkeiten darein zu weben, für deren Verlust keine Wirklichkeit uns entschädigen kann.
Der andere soll uns nicht nur eine hinzunehmende Gabe schenken, sondern auch die Möglichkeit, ihn zu beschenken, mit unseren Idealisierungen und Hoffnungen, mit seinen verborgenen Schönheiten und ihm selbst unbewussten Reizen.
Der Ort aber, an dem wir all dies von uns, aber für ihn Hervorgebrachte deponieren, ist der undeutliche Horizont seiner Persönlichkeit, das Zwischenreich, in dem der Glaube das Wissen ablöst.
Es handelt sich dabei keineswegs nur um Illusionen und verliebten Selbstbetrug, sondern einfach darum, dass uns ein Teil auch an den nächsten Menschen, damit ihr Reiz für uns auf der Höhe bleibe, in der Form der Undeutlichkeit oder Unanschaulichkeit geboten sein muss; indem sie diese idealisierende Tätigkeit ermöglichen, ersetzt die Mehrzahl der Menschen den Attraktionswert, den jene Minderzahl durch die Unerschöpflichkeit ihres inneren Lebens und Wachsens besitzt.
Die bloße Tatsache des absoluten Kennens, des psychologischen Ausgeschöpfthabens ernüchtert uns sogar ohne vorhergegangenen Rausch, lähmt die Lebendigkeit der Beziehungen und lässt ihre Fortsetzung als etwas eigentlich Zweckloses erscheinen.
Dies ist die Gefahr der restlosen und in einem mehr als äußeren Sinne schamlosen Hingabe, zu der die unbeschränkten Möglichkeiten intimer Beziehungen verführen, ja, die leicht als eine Art Pflicht empfunden werden - namentlich da, wo keine absolute Sicherheit des eigenen Gefühles besteht und die Besorgnis, dem anderen nicht genug zu geben, dazu verleitet, ihm zuviel zu geben.
An diesem Mangel gegenseitiger Diskretion, im Sinne des Nehmens wie des Gebens, gehen sicher viele Ehen zugrunde, das heißt, verfallen in eine reizlos banale Gewöhnung, in eine Selbstverständlichkeit, die keinen Raum für Überraschungen mehr hat.
Die fruchtbare Tiefe der Beziehungen, die hinter jedem geoffenbarten Letzten noch ein Allerletztes ahnt und ehrt, die auch das sicher Besessene täglich von neuem zu erobern reizt, ist nur der Lohn jener Zartheit und Selbstbeherrschung, die auch in dem engsten, den ganzen Menschen umfassenden Verhältnis noch das innere Privateigentum respektiert, die das Recht auf Frage durch das Recht auf Geheimnis begrenzen lässt.
Psychologie der Koketterie
Die Weisheit Platos über die Liebe: dass sie ein mittlerer Zustand zwischen Haben und Nichthaben sei, scheint nicht an die Tiefe ihres Wesens, sondern nur an eine Form ihrer Erscheinung zu rühren.
Nicht nur, dass sie keinen Raum hat für die Liebe, die spricht: "Wenn ich dich liebe, was geht's dich an" - so kann sie eigentlich nur die meinen, die an der Erfüllung ihres Sehnens stirbt.
Auf den Weg vom Nichthaben zum Haben gestellt, mit der Bewegung auf ihm ihr Wesen erschöpfend, kann sie, wenn sie nun "hat", nicht mehr dasselbe sein, was sie vorher war, kann nicht mehr Liebe sein, sondern setzt ihr Energiequantum in Genuss oder vielleicht in Überdruss um.
Es hebt diese Konsequenz der Liebe, als der Sehnsucht des Nichthabenden nach dem Haben, nicht auf, dass sie in jenem Augenblick ihres Vergehens vielleicht von neuem entsteht: ihrem Sinne nach bleibt sie in einen rhythmischen Wechsel gebannt, in dessen Zäsuren die Momente der Erfüllung stehen.
Wo sie aber in den letzten seelischen Tiefen verankert ist, beschreibt der Turnus von Haben und Nichthaben doch nur die Gestalt ihrer Äußerung und Oberfläche. Das Sein der Liebe, dessen bloßes Phänomen die Begehrung ist, kann durch deren Stillung nicht aufgehoben werden.
Was aber auch der Sinn des Habenwollens sei, und ob es das Definitivum der Liebe oder nur die Hebung des über ihr Definitivum hinspielenden Wellenrhythmus bedeute - wo sein Gegenstand eine Frau und sein Subjekt ein Mann ist, erhebt es sich über der eigentümlichen seelischen Tatsache des "Gefallens".
Das Gefallen ist der Quell, aus dem jenes Haben und Nichthaben gespeist wird, wenn es für uns Lust oder Leid, Begehrung oder Befürchtung werden soll. Aber hier wie sonst läuft die Verbindung zwischen einem Besitz und seiner Schätzung auch in umgekehrter Richtung.
Nicht nur wächst Wichtigkeit und Wert dem Haben und Nichthaben des Gegenstandes zu, der uns gefällt; sondern wo ein Haben und Nichthaben aus irgendwelchen anderen Ursachen heraus für uns Bedeutung und Betonung gewinnt, pflegt sein Gegenstand unser Gefallen zu erregen.
So bestimmt nicht nur der Reiz eines käuflichen Dinges den Preis, den wir dafür zahlen mögen: sondern dass ein Preis dafür gefordert wird, dass sein Erwerb nicht etwas Selbstverständliches, sondern nur mit Opfern und Mühen Gelingendes ist - das macht uns unzählige Male erst das Ding reizvoll und begehrenswert.
Die Möglichkeit dieser psychologischen Wendung lässt die Beziehung zwischen Männern und Frauen in die Form der Koketterie hineinwachsen. Dass die Kokette "gefallen will", gibt an und für sich ihrem Verhalten noch nicht das entscheidende Cachet; übersetzt man Koketterie mit "Gefallsucht", so verwechselt man das Mittel zu einem Zweck mit dem Triebe zu diesem Zweck.
Eine Frau mag alles aufbieten, um zu gefallen, von den subtilsten geistigen Reizen bis zur zudringlichsten Exposition physischer Anziehungspunkte - so kann sie sich mit alledem noch sehr von der Kokette unterscheiden.
Denn dieser ist es eigen, durch Abwechslung oder Gleichzeitigkeit von Entgegenkommen und Versagen, durch symbolisches, angedeutetes, "wie aus der Ferne" wirksames Ja- und Neinsagen, durch Geben und Nichtgeben oder, platonisch zu reden, von Haben und Nichthaben, die sie gegeneinander spannt, indem sie sie doch wie mit einem Schlage fühlen lässt - es ist ihr eigen, durch diese einzigartige Antithese und Synthese Gefallen und Begehren zu wecken.
In dem Verhalten der Kokette fühlt der Mann das Nebeneinander und Ineinander von Gewinnen- und Nicht-gewinnen-Können, das das Wesen des "Preises" ist, und das ihm mit jener Drehung, die den Wert zum Epigonen des Preises macht, diesen Gewinn als wertvoll und begehrenswert erscheinen lässt.
Das Wesen der Koketterie, mit paradoxer Kürze ausgedrückt, ist dieses: wo Liebe ist, da ist - sei es in ihrem Fundament, sei es an ihrer Oberfläche - Haben und Nichthaben; und darum, wo Haben und Nichthaben ist - wenn auch nicht in der Form der Wirklichkeit, sondern des Spieles - da ist Liebe, oder etwas, was ihre Stelle ausfüllt.
Ich wende diese Deutung der Koketterie zunächst auf einige Tatsachen der Erfahrung an. Der Koketterie in ihrer banaleren Erscheinung ist der Blick aus dem Augenwinkel heraus, mit halbabgewandtem Kopfe, charakteristisch.
In ihm liegt ein Sich-Abwenden, mit dem doch zugleich ein flüchtiges Sich-Geben verbunden ist, ein momentanes Richten der Aufmerksamkeit auf den anderen, dem man sich in demselben Momente durch die andere Richtung von Kopf und Körper symbolisch versagt.
Dieser Blick kann physiologisch nie länger als wenige Sekunden dauern, so dass in seiner Zuwendung schon seine Wegwendung wie etwas Unvermeidliches präformiert ist.
Er hat den Reiz der Heimlichkeit, des Verstohlenen, das nicht auf die Dauer bestehen kann, und in dem sich deshalb das ja und das Nein untrennbar mischen.
Der volle En-face-Blick, so innig und verlangend er sei, hat nie eben dies spezifisch Kokette.
In derselben Oberschicht koketter Effekte liegt das Wiegen und Drehen der Hüften, der "schwänzelnde" Gang.
Nicht nur, weil er durch die Bewegung der sexuell anregenden Körperteile sie anschaulich betont, während zugleich doch Distanz und Reserve tatsächlich besteht - sondern weil dieser Gang das Zuwenden und Abwenden in der spielenden Rhythmik fortwährender Alternierung versinnlicht.
Es ist nur eine technische Modifikation dieser Gleichzeitigkeit eines angedeuteten ja und Nein, wenn die Koketterie über die Bewegungen und den Ausdruck ihres Subjekts selbst hinausgreift.
Sie liebt die Beschäftigung mit gleichsam abseits liegenden Gegenständen: mit Hunden oder Blumen oder Kindern.
Denn dies ist einerseits Abwendung von dem, auf den es abgesehen ist, andrerseits wird ihm doch durch jene Hinwendung vor Augen geführt, wie beneidenswert sie ist; es heißt: nicht du interessierst mich, sondern diese Dinge hier - und zugleich: dies ist ein Spiel, das ich dir vorspiele, es ist das Interesse für dich, dessentwegen ich mich zu diesen anderen hinwende.
Solches Ineinanderwachsen symbolischen Habens und Nichthabens kulminiert ersichtlich in der Hinwendung der Frau zu einem anderen Manne als dem, den sie eigentlich meint.
Nicht um die brutale Einfachheit der Eifersucht handelt es sich dabei.
Diese steht auf einem anderen Blatt, und wo sie etwa vorbehaltlos entfesselt werden soll, um das Gewinnen- oder Behaltenwollen zur Leidenschaft zu steigern, da fügt sie sich nicht mehr in die Form der Koketterie.
Diese vielmehr muss den, dem sie gilt, das labile Spiel zwischen Ja und Nein fühlen lassen, das Sich-Versagen, das der Umweg des Sich-Gebens sein könnte, das Sich-Geben, hinter dem, als Hintergrund, als Möglichkeit, als Drohung das Sich-Zurücknehmen steht.
An jeder definitiven Entscheidung endet die Koketterie, und die souveräne Höhe ihrer Kunst offenbart sich an der Nähe zu einem Definitivum, in die sie sich begibt, um dieses dennoch in jedem Augenblick von seinem Gegenteil balancieren zu lassen.
Der Doppelsinn des "mit", einerseits das Werkzeug, andererseits den Partner, das Objekt einer Korrelation zu bezeichnen, offenbart hier ein tiefes Recht.
Mit alledem scheint die Koketterie, als das bewusst dualistische Verhalten, in völligem Widerspruch zu jener "Einheitlichkeit" des weiblichen Wesens zu stehen, die, wie verschieden verstanden, wie tief oder oberflächlich gedeutet, doch alle Frauenpsychologien als ihr Grundmotiv durchzieht.
Wo überhaupt die weibliche und die männliche Seele als solche in einem Wesensgegensatz empfunden werden, da pflegt es dieser zu sein: dass die Frau das seiner Natur nach in sich zentralisiertere Wesen ist, dessen Triebe und Gedanken enger um einen oder wenige Punkte gesammelt und unmittelbarer von diesen her erregbar sind, als bei dem differenzierteren Manne, dessen Interessen und Betätigungen mehr in sachlich bestimmter Selbständigkeit, in arbeitsteiliger Sonderung von dem Ganzen und Inneren der Persönlichkeit verlaufen.