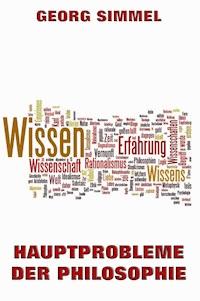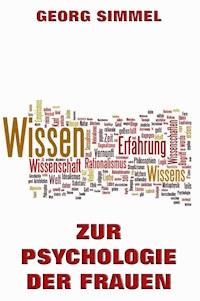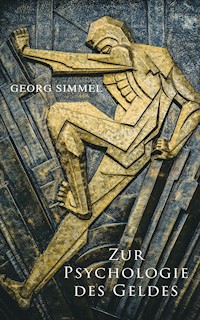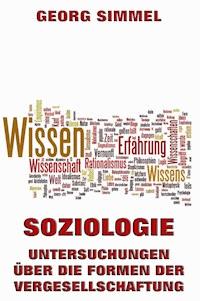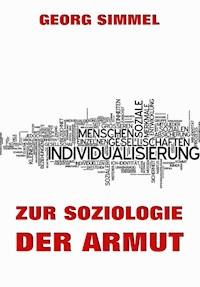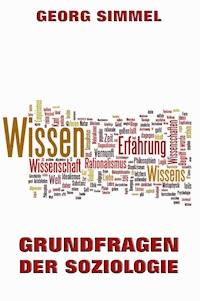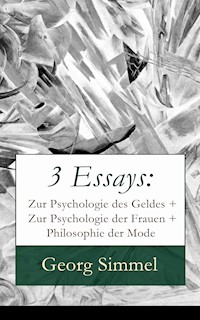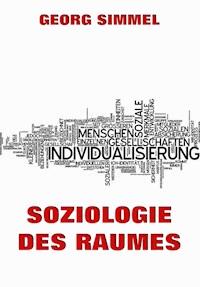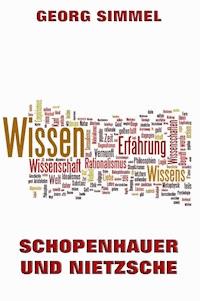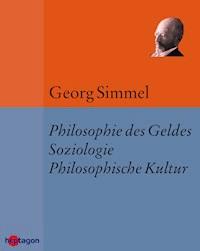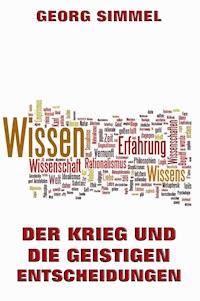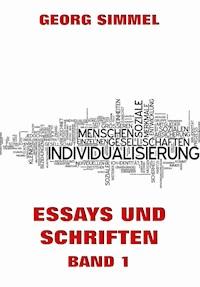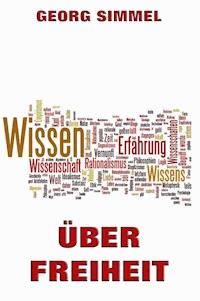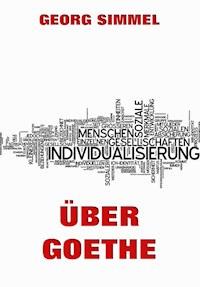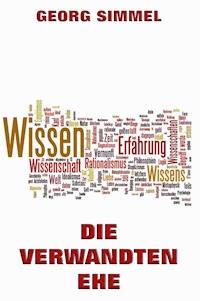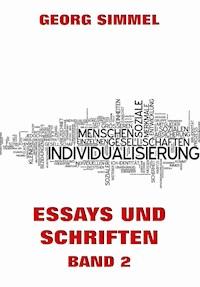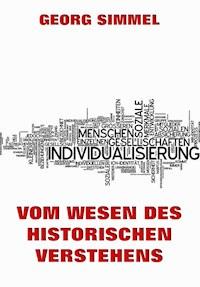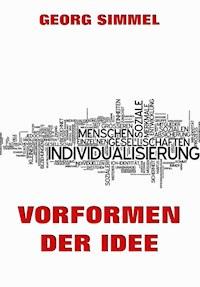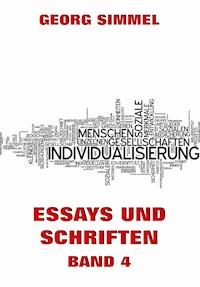
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet die folgenden Werke Simmels: Studien zur Philosophie der Kunst, besonders der Rembrandtschen Über die Grundfrage des Pessimismus in methodischer Hinsicht Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnistheorie Über Geiz, Verschwendung und Armut Zu einer Theorie des Pessimismus Zur Soziologie des Adels - Fragment aus einer Formenlehre der Gesellschaft Vom Heil der Seele
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Essays und Schriften, Band 4
Georg Simmel
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Studien zur Philosophie der Kunst, besonders der Rembrandtschen
I.
II.
III.
IV.
V.
Über die Grundfrage des Pessimismus in methodischer Hinsicht
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnistheorie
Über Geiz, Verschwendung und Armut
Zu einer Theorie des Pessimismus
I. Der Pessimismus als Übergangserscheinung
II. Das Grausamkeitsmoment im Pessimismus
Sozialismus und Pessimismus
Zur Soziologie des Adels - Fragment aus einer Formenlehre der Gesellschaft
Vom Heil der Seele
Essays und Schriften, Band 4, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849617455
www.jazzybee-verlag.de
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Studien zur Philosophie der Kunst, besonders der Rembrandtschen
I.
"Die Einheit des wohlkomponierten Renaissancebildes liegt ausserhalb des Bildinhaltes selbst, sie ist als abstrakte Form zu denken: Pyramide, Gruppensymmetrie, Kontrapost an und mit den Einzelfiguren - deren an und für sich selbständige Bedeutung auch von anderem Inhalt erfüllt werden könnte. Abgesehen aber von dieser, in einem ideellen Ausserhalb gelegenen Form, hat das Bild oft eine sehr geringe Einheit, sondern besteht in einem Nebeneinander von Teilen, die dadurch, dass sie alle gleichmässig durchgeführt sind, ganz des organischen Verhältnisses entbehren."
Dieser Satz aus einer früheren Rembrandtstudie1
)
gilt natürlich nur in sehr abgestuftem Masse für italienische Kunst überhaupt.
Bei Giotto ist keine innere Fremdheit zwischen der kompositionellen Form und dem eigenen Leben der Gestalten fühlbar, einmal, weil die letzteren überhaupt nicht stark individualisiert sind und keine Existenz beanspruchen, die über die Funktion ihrer bildmässigen Gegebenheit hinausginge; und dann, weil die Form hier noch keine geometrische, sondern eine architektonische ist.
Das geometrische Schema der späteren Kompositionen hat eine Abstraktheit, deren Leere und hart selbständiger Sinn durch keine noch so geistreiche und im einzelnen lebendige Erfüllung ganz zu überwinden ist.
Architektonisch aber wird man eine Formgebung nennen können, die zwar nicht aus einer individuellen Lebendigkeit, wohl aber aus der materialen Extensität und dynamischen Intensität ihrer Erfüllungen unmittelbar hervorgeht und mit diesen identisch ist.
Das architektonische Prinzip steht jenseits des Gegensatzes von Schematik und Leben.
Die Gruppen Giottos erwachsen nicht aus den Lebendigkeiten der Einzelgestalten, ebenso wenig aber als Ausfüllungen eines in eigener geometrischer Bedeutung vorbestehenden Schemas; sondern es ist wie ein Bauwerk, in dem kein Teil ein einzigartiges Leben hat, ein jeder aber doch eine eigentümliche Masse, Form und Kraft einsetzt und dadurch unmittelbar die mit nichts vergleichliche architektonische Einheit entstehen lässt.
In Raffaels Madonnen bestimmt zwar wesentlich das geometrische Motiv die Komposition, allein sie sind von solcher malerischen Mächtigkeit, dass - sozusagen wenigstens nachträglich - das Eigenleben der Gestalten sich ohne inneren Widerspruch und ohne Zufälligkeit dieser Form anschmiegt.
In der Madonna von Castelfranco ist der dreieckige Aufbau zweifellos etwas mechanisch und ohne rechte Beziehung zu der lyrischen Gesamtstimmung des Bildes; es ist aber interessant, wie sehr eben diese Stimmung und die vertiefte Schönheit der Gestalten über die Unbehilflichkeit der geometrischen Form Herr wird, so dass der Gesamteindruck für Viele den der entsprechenden Raffaelschen Werke übertrifft, obgleich bei diesen der geometrische Schematismus und sein lebendiger Inhalt eine viel natürlichere, harmonischere Einheit bilden.
Erst bei den minderen Meistern tritt ganz fühlbar hervor, dass das Schema und seine Erfüllung mit lebenden Wesen von ganz inkohärenten seelischen Grundstrebungen geführt und auseinandergeführt werden.
Zu leugnen aber ist nicht, dass der im romanischen Wesen gelegene rationalistische Trieb nach klar überschaulicher, in sich geschlossener Aussenform solche Schemata fördert, die durch die Selbständigkeit ihres Sinnes dem Inhalt gegenüber leer und mechanisierend wirken.
Auch die Dichtkunst scheint mir dies zu bestätigen, insofern die spezifisch romanische Versform doch wohl das Sonett ist.
Hier liegt jene anschauliche Geschlossenheit vor, die keine Fortsetzung gestattet und deshalb einerseits zeitlos-unhistorischen Charakter hat, so dass man im Sonett nichts "erzählen" kann; andererseits den Weg ins Unendliche verschliesst, der der Reichtum, vielleicht auch die Verführung der nordischen Völker ist.
(In Dantes Versform mit ihrer prinzipiellen Unabschliessbarkeit symbolisiert sich, was an gotischem Geiste in ihm ist).
Das Sonett gleicht dem klassischen Ornament mit seinen in sich zurücklaufenden Formen, gegenüber dem nordischen, das sich ins Unendliche fortsetzen will.
Diese gleichsam tendenziöse, unbarmherzig betonte Vollendetheit der Form begünstigt es, dass das Sonett die am meisten zur äusserlichen Spielerei verführende, am leichtesten leer und formalistisch wirkende Versart ist - wo nicht, genau wie bei dem geometrischen Schema der bildenden Kunst, eine singuläre Genialität dieser Gefahren Herr wird.
Bei Rembrandt nun erwächst die Gesamtform des mehrfigurigen Bildes aus dem Leben der einzelnen Figuren, d. h. daraus, dass das Leben der einzelnen, ausschliesslich von ihrem eigenen Zentrum aus bestimmt, gewissermassen über sie hinausströmt und dem der anderen begegnet, zu gegenseitiger Beeinflussung und Stärkung, Modifikation und Vermählung.
Eine übergreifende Gesamtform, die man als für sich vorstellbare und bedeutsame dem Ganzen entlesen oder als ein Schema vorzeichnen könnte, wie an geometrisch komponierten Bildern, besteht hier nicht.
Dies vielleicht trägt den unerhörten Eindruck der Nachtwache: dass die Einheit des Bildes sozusagen nichts für sich ist, nicht herauszuabstrahieren, nicht in einer Form jenseits ihrer Erfüllungen beruhend; sondern ihr Wesen und ihre Kraft ist nichts anderes als die unmittelbare Verwehung der Vitalitäten, die aus jedem Individuum herausbrechen.
Es ginge schon zu weit über diese Unmittelbarkeit hinaus, konstruierte schon eine zu abstrakte Einheit, wollte man von einem Gesamtleben sprechen, das dies Bild trüge; das Leben bleibt vielmehr in jede einzelne Figur versenkt, und indem es von einer jeden zu der anderen hinstrahlt, gibt es sein Zentrum nicht an eine darübergelegene Einheit ab.
Nur der ganze umfassende Raum kann bei dieser Konstellation wie von Lebenswellen durchflutet sein, und wenn man das Magische dieses Bildes irgendwie - mit unvermeidlich subjektiver Symbolik - zu bezeichnen wagen will, so möchte man sagen: der Raum selbst scheint hier in lebendige Bewegung geraten zu sein, nicht nur die Erscheinungen im Raum.
Denn die Totaleinheit des Bildes, die man als eine unerhört lebendige fühlt, ist nicht zu einer für sich gültigen, in Lösung von ihren Inhalten vorstellbaren Form gleichsam zugespitzt, sondern sie besteht in der Summe der Figuren, die aber dennoch nicht auseinanderfallen, sondern, wie angedeutet, mit ihren intensiven Lebendigkeiten sozusagen Adhäsion aneinander besitzen; so dass tatsächlich nur das ihnen gemeinsame Medium, der Raum, durch die sich in ihm organisierenden Lebenssphären wie eine grosse lebenerfüllte und dadurch selbst lebendig gewordene Einheit erscheint.
Man muss sich nur klarmachen, dass derjenige Wert eines Bildes, den wir als seine Einheit bezeichnen, auf viel mannigfaltigere Weise herstellbar ist, als unsere an der Klassik geschulte Denkweise es im allgemeinen anerkennt.
Dieser gewohnte Begriff heftet sich durchaus an die Form, die ihren Erfüllungen gegenüber irgendwie selbständig in sich selbst zurückläuft und dadurch gewissermassen einen einheitlichen Begriff darstellt.
Diese Art von Einheit ist aber ersichtlich nicht an organische Erfüllungen gebunden, sondern kann sich mit dem gleichen Erfolge formaler Geschlossenheit auch an unlebendigen Inhalten verwirklichen.
Im Unterschiede davon aber gibt es eine Einheitlichkeit, die unmittelbar ihren Erfüllungen verhaftet ist, die gerade nur an diesem Stoff bestehen kann und zwar, weil sie nur aus ihm erstehen kann.
Dies ist die Einheit ausschliesslich des organischen Wesens.
Die Einheit eines solchen lässt sich gar nicht als eine Form denken, die mit einem irgendwie qualitativ anderen Gehalt auszufüllen wäre.
Und aus einer Mehrheit solcher Wesen kann ein Gebilde zustande kommen, das wiederum einheitlich ist, weil es seine im vitalen Sinne einheitlichen Bestandteile in Verwebung und Verwachsung zeigt; denn es ist das Wesen des Lebens, über sich hinauszugreifen, hinauszustrahlen, ohne seine Einheit zu verlieren, sich gleichsam mit einer Sphäre über seine primäre Greifbarkeit hinaus zu umgeben, die immer an seinen Mittelpunkt gebunden bleibt, aber mit der Sphäre anderer wechselwirkt, sich durchdringt, verschmilzt.
In der deutschen Sinnesart liegt von vornherein eine andere Möglichkeit, Einheit zu empfinden, als in der klassischen.
Dürers Melancholie, Holbeins Kaufmann Gyse, viele holländische Stilleben zeigen ein Nebeneinander von einzelnen Dingen, das vom Standpunkt der klassischen Kunst aus zufällig und zusammenhanglos erscheint.
Aber obgleich es den Schöpfern selbst sicher nicht so erschien, so ist doch von da aus die Sehnsucht solcher germanischer Geister nach der klassischen Form begreiflich.
Denn das Unorganische gewinnt anschauliche Einheit nur in geometrisch abstrakten Formen, es kann nicht durch Wachstum von innen her zu sinnvoller, d. h. einheitlicher Gestaltung gelangen, es entbehrt jener bewegten Sphäre, durch die ein Lebendiges mit dem anderen zusammenfliessen kann.
Jener frühere Mangel an äusserer Zusammengefasstheit in der deutschen Kunst war also allerdings ein Widerspruch, die eigentümliche, nicht klassische Einheit, zu der diese Kunst hinstrebte, war an unorganischem Material nicht zu gewinnen.
Erst mit Rembrandt hat dieses Streben sich selbst verstanden und hat, am deutlichsten in der Nachtwache, mit dem ihm unvermeidlich scheinenden und ihm dennoch innerlich widersprechenden Ideal der klassisch geometrisierenden Form gebrochen.
Die Nachtwache ist eines der rätselhaftesten Bilder.
Wie diese wirr und planlos, und, nach den hergebrachten Begriffen, formlos nebeneinander und durcheinanderlaufenden Konfigurationen die Einheit des Ganzen ergeben können, ohne die der ungeheure Eindruck dieses Ganzen gar nicht möglich wäre - das ist nach eben jenen Begriffen nicht zu erklären.
Aber indem die Nachtwache so und so viele Lebendigkeiten und nur sie zum Bildinhalt macht und dem Geheimnis ihrer rein vitalen Wechselwirkungen anschauliche Sprache gibt, hat sie jenes alte germanische Drängen zu einer Einheit, die nicht geschlossen formmässig, nicht für sich darstellbar, sondern nur an ihren Trägern zu realisieren ist, zum ersten Mal in der Geschichte der Kunst rein befriedigt.
Die Einheit ist hier, wo sie zugleich ganz tief und ganz labil ist, auf eine viel gewagtere Weise gewonnen, als im klassischen Kunstwerk, bei dem sie durch den eigenen vorbestehenden Sinn der Form eine gewisse Garantie für das Nicht-auseinanderfallen-Können und das Verstandenwerdenmüssen in sich trägt.
Hierfür ist nun ein früher schon angedeutetes Moment von der allergrössten Wichtigkeit: die Abstufung der Deutlichkeitsgrade im Rembrandtschen Gemälde.
Die Herrschaft der klassischen Form, mit ihrem Streben nach geometrisch-übersichtlicher Einfachheit, hat eben deshalb ein solches nach dem linearen Prinzip, und selbst der Kolorismus der venezianischen Kunst kann dies nicht verleugnen.
Freilich hat die Farbe, die den Rembrandtschen Deutlichkeitsunterschieden ihr eigentliches Feld eröffnet, schon an und für sich zu dem Formprinzip in seiner wesentlich linearen und plastischen Bedeutung ein tiefes Gegensatzverhältnis.
Stellt sich in der Form gewissermassen die abstrakte Idee der Erscheinung dar, so steht die Farbe sowohl diesseits wie jenseits dieser: sie ist sinnlicher und ist metaphysischer, ihre Wirkung ist einerseits unmittelbarer, andererseits tiefer und geheimnisvoller.
Ist die Form etwa als die Logik der Erscheinung zu bezeichnen, so bedeutet die Farbe eher deren psychologischen und metaphysischen Charakter - auch hier diese beiden, untereinander durchaus geschiedenen Intentionen in ihrer gemeinsamen Gegensätzlichkeit gegen das logische Prinzip erweisend; die vorwiegend logisch interessierten Denker verhalten sich deshalb häufig gleichmässig ablehnend gegen die psychologische wie gegen die metaphysische Sinnesart, und dies scheint mir der tiefere Zusammenhang zu sein, aus dem heraus Kant in seinem ästhetischen Wertsystem die Farbe eigentlich ganz zu Gunsten der Form ablehnt.