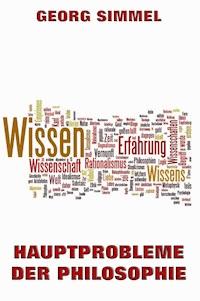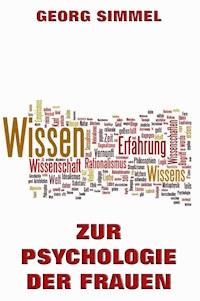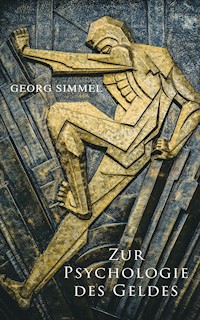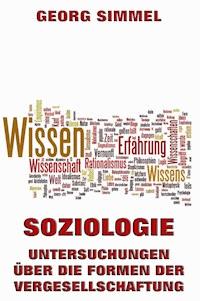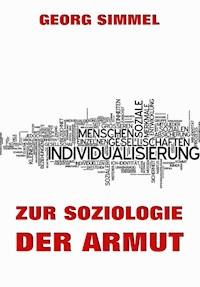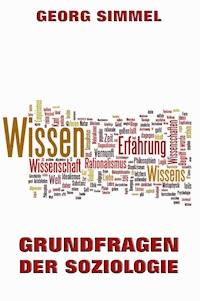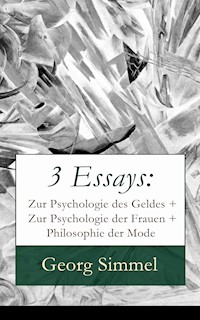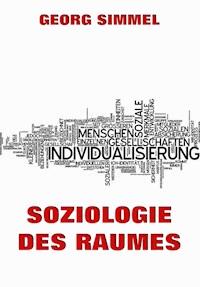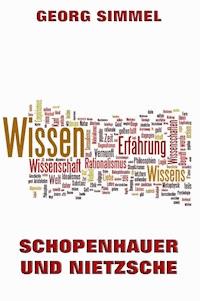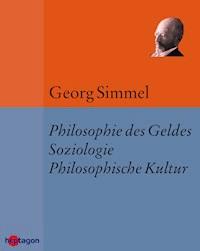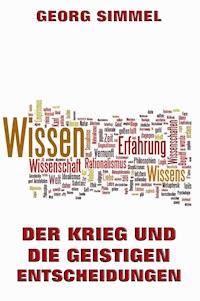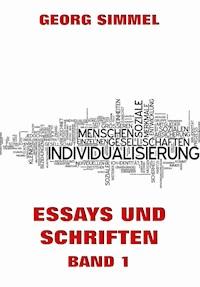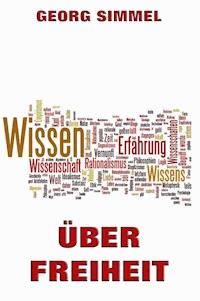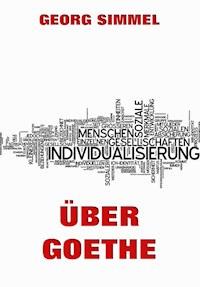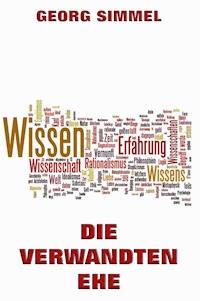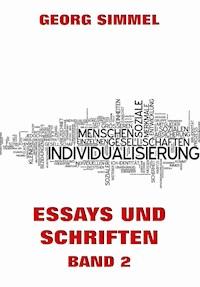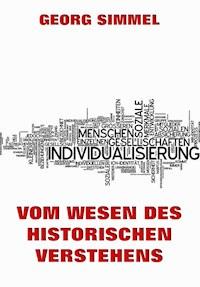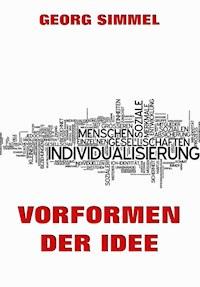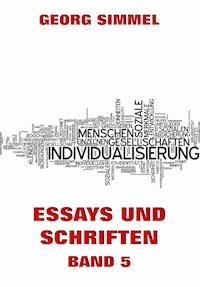
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet die folgenden Werke Simmels: Vom Wesen der Kultur Vom Wesen der Philosophie Zum Verständnis Nietzsches Zur Erkenntnistheorie der Religion Zur Psychologie der Mode Zur Psychologie des Geldes Zur Soziologie der Familie Zur Soziologie der Religion
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Essays und Schriften, Band 5
Georg Simmel
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Vom Wesen der Kultur
Vom Wesen der Philosophie
Zum Verständnis Nietzsches
I
II
III
Zur Erkenntnistheorie der Religion
I
II
Zur Psychologie der Mode
Zur Psychologie des Geldes
Zur Soziologie der Familie
I
II
Zur Soziologie der Religion
Essays und Schriften, Band 5, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849617592
www.jazzybee-verlag.de
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Vom Wesen der Kultur
Den Begriff der Natur umgibt eine Verwirrung, durch die es geschehen kann, dass man im Zeitalter der exakten Empirie und der mathematischen Erkenntnisideale von der "Natur" wie von einer einheitlichen Macht spricht, die die einzelnen Erscheinungen "erzeugt", die "unbedingt wahrhaftig" wäre, deren Gesetze sich Befolgung "erzwingen".
Der Naturbegriff ist vielfach in die mystisch-mythologische Rolle des früheren Gottesbegriffes eingetreten.
Dieser Missbrauch scheint mir darauf begründet, dass die Natur als ein absolutes Wesen gilt, statt als eine Kategorie, unter der die Inhalte des Seins angesehen und angeordnet werden; wie diese Inhalte ein Reich der Natur bilden, so bilden sie auch ein Reich der Kunst, der Religion, der begrifflichen Systematik.
Von herrschenden Begriffen aus werden gewisse Seiten der Erscheinungen, gewisse Möglichkeiten, sie zu einheitlichen Reihen zu ordnen, erfasst, und der Begriff Natur - aus Elementen von Kausalität, Substanzen, Energien, Raum- und Zeitformen ic. bestehend - ist nur einer dieser Begriffe; er ist deshalb in seinem einheitlichen Wesen nur durch den Gegensatz oder die Beziehung zu den anderen Begriffen zu verstehen, die das gleiche Material zu jenen anderen Komplexen formen; von deren Gesamtheit wird der Bezirk unseres Lebens besetzt, das freilich nur fragmentarische und wechselnde Stücke ihrer sich aneignet und erlebt.
Dass nun ein jeder derartige Komplex nur eine Betrachtungsweise und Formierung der identischen Inhalte oder eines Ausschnittes dieser Inhalte ist, nicht aber als ein absolutes Dasein sie für sich monopolisiert, steht in Wechselwirkung mit der Tatsache, dass ein jeder seinen spezifischen Sinn und seine Rechtsgrenzen erst in der Relation zu einem anderen findet; d. h. erst wenn der gleiche Inhalt der einen wie der anderen Kategorie unterstellt wird, leuchtet die Bedeutung eben dieser unzweideutig hervor.
Auf diese Weise legt sich etwa erst auseinander, welche Vielheit von Begriffen der Begriff der Natur deckt.
Wenn eine Religion von der Natur als dem Werk des Teufels und dem Ort der Unreinheit spricht, weil sie hier der Idee eines göttlichen Reiches gegenübersteht, so ist diese Natur etwas völlig anderes, als die Natur, die etwa ein moderner Künstler als den Inbegriff seiner Werte feiert, weil er sie irgend welchen willkürlich ausgedachten, von vorgefassten Ideen abhängigen Kunstformen entgegensetzt.
Die Natur, die Kant als unsere Vorstellungswelt, als das Produkt unserer Sinne und unseres Verstandes bezeichnet, ist ersichtlich etwas ganz anderes als die Natur, die die Ethik entweder als das zu Überwindende in uns, oder als das Ideal aufstellt, das unserem Handeln die Richtlinien geben müsste.
Und eine neue Funktion ihrer offenbart sich, wenn ihr die Kategorie der Kultur entgegengehalten wird, die auch ihrerseits erst an diesem Gegensatz ihre Bedeutung entfaltet.
Alle Geschehensreihen, die von der menschlichen Aktivität getragen werden, können als Natur angesehen werden, d. h. als eine ursächlich bestimmte Entwicklung, in der jedes aktuelle Stadium aus der Kombination und den Spannkräften der vorangegangenen Lage verständlich sein muss.
In diesem Sinne braucht auch zwischen Natur und Geschichte kein Unterschied gemacht zu werden, insofern das, was wir Geschichte nennen, rein als Ereignisverlauf betrachtet, sich in die natürlichen Zusammenhänge des Weltgeschehens und seine kausale Erkennbarkeit einstellt.
Allein sobald irgend welche Inhalte dieser Reihen unter den Begriff der Kultur rücken, so verschiebt sich damit der Naturbegriff in eine engere und sozusagen lokale Bedeutung.
Denn nun geht die "natürliche" Entwicklung der Reihe nur bis zu einem bestimmten Punkte, an dem sie von der kulturellen abgelöst wird.
Der Holzbirnbaum trägt holzige und saure Früchte.
Damit ist die Entwicklung, zu der ihn sein wildes Wachstum bringen kann, an ihr Ende gelangt.
An diesem Punkte hat der menschliche Wille und Intellekt eingegriffen und den Baum durch allerhand Beeinflussungen zur Produktion der Essbirne geführt, d. h. ihn "kultiviert".
Nicht weniger denken wir uns die Entwicklung des Menschengeschlechts durch physisch-psychische Organisation, durch Vererbung und Anpassung zu bestimmten Formen und Inhalten der Existenz gelangt, an die nun erst teleologische Prozesse ansetzten, um die so vorgefundenen Energien zu einer ihren bisherigen Entwicklungsmöglichkeiten prinzipiell versagten Höhe zu führen.
Der Punkt, an dem diese Ablösung der Entwicklungskräfte stattfindet, bezeichnet die Grenze des Naturzustandes gegen den Kulturzustand.
Da nun aber auch dieser letzte aus seinen "natürlichen" Entstehungsbedingungen kausal abzuleiten ist, so zeigt sich erstens, dass Natur und Kultur nur zwei verschiedene Betrachtungsweisen eines und desselben Geschehens sind, zweitens, dass Natur ihrerseits hier in zwei verschiedenen Bedeutungen auftritt, einmal als der allumfassende Komplex der in kausalem Nacheinander verbundenen Erscheinungen, dann aber als eine Entwicklungsperiode eines Subjektes - nämlich diejenige, in der es die in ihm allein gelegenen Triebkräfte entfaltet, und die endet, sobald ein intelligenter, über Mittel verfügender Wille diese Kräfte aufnimmt und damit das Subjekt zu Zuständen führt, die es, jenen allein überlassen, nicht erreichen könnte.
Wenn indes der Kulturbegriff so mit dem der menschlichen Zwecktätigkeit überhaupt zusammenzufallen scheint, so bedarf dies einer Einschränkung, die sein besonderes Wesen erst bezeichnet.
Wenn ein Schuljunge einem anderen ein Bein stellt, damit er hinfällt und die Kameraden lachen, so ist dies sicher eine eminent teleologische Handlung, eine Ausnutzung natürlicher Begebenheiten durch Intellekt und Willen; aber man wird sie nicht unter den Gesichtspunkt der Kultur rücken.
So ruht dessen Anwendung vielmehr noch auf einer Reihe von - wenn man will: unbewusst wirksamen - Bedingungen, die sich erst aus einer nicht ganz selbstverständlichen Analyse ergeben.
Kultivierung setzt voraus, dass etwas da sei, was sich vor ihrem Eintreten in einem nicht kultivierten - eben dem "natürlichen" - Zustand befand; und sie setzt nun weiter voraus, dass die dann eintretende Änderung dieses Subjektes irgendwie in dessen natürlichen Strukturverhältnissen oder Triebkräften latent sei, wenngleich nicht von diesen selbst, sondern eben nur durch die Kultur zu realisieren; dass die Kultivierung ihren Gegenstand zu dem für ihn determinierten, in der eigentlichen und wurzelhaften Tendenz seines Wesens angelegten Vollendung führe.
Darum erscheint uns der Birnbaum selbst kultiviert, weil die Arbeit des Gärtners schließlich nur die in der organischen Anlage seiner Naturform schlummernden Möglichkeiten entwickelt, ihn zu der vollkommensten Entfaltung seiner eigenen Natur bringt.
Wenn dagegen ein Baumstamm zu einem Segelmast verarbeitet wird, so ist auch dies sicher eine Kulturarbeit, allein keine "Kultivierung" des Baumstammes, weil die Form, zu der die Arbeit des Schiffsbauers ihn gestaltet, nicht in seiner eigenen Wesenstendenz liegt; sie wird ihm vielmehr rein von außen, von einem seinen eigenen Anlagen fremden Zwecksystem hinzugefügt.
Alle Kultivierung also ist, wenn wir auf den mit dem Worte anklingenden Sinn hören, nicht nur die Entwicklung eines Wesens über die seiner bloßen Natur erreichbare Formstufe hinaus, sondern nun auch Entwicklung in der Richtung eines inneren ursprünglichen Kerns, Vollendung dieses Wesens gleichsam nach der Norm seines eigenen Sinnes, seiner tiefsten Triebrichtungen; aber diese Vollendung ist in dem Stadium, das wir das natürliche nennen und das in der rein kausalen Entfaltung der dem Wesen von vornherein innewohnenden Kräfte besteht, nicht erreichbar; sie entsteht vielmehr durch deren Zusammenwirken mit den neuen teleologischen Eingriffen, die aber in jenen Anlagerichtungen des Wesens selbst erfolgen und insoweit seine Kultur heißen.
Daraus ergibt sich, genau genommen, dass nur der Mensch der eigentliche Gegenstand der Kultur ist; denn er ist das einzige uns bekannte Wesen, in dem von vornherein die Forderung einer Vollendung liegt; seine "Möglichkeiten" sind nicht nur die einfache Zuständlichkeit ruhender Spannkräfte oder die Reflexionen und ideellen Hinzufügungen eines Zuschauers - wie dies die vom Holzbirnbaum auszusagenden "Möglichkeiten" der Gartenbirne sind - sondern sie haben gleichsam schon eine Sprache; das, wozu die Seele sich überhaupt entwickeln kann, liegt schon in ihrem jeweiligen Zustand als etwas Drängendes, wie mit unsichtbaren Linien in sie Eingezeichnetes, es ist, wenn gleich in seinem Inhalt oft undeutlich und fragmentarisch realisiert, doch ein positives Gerichtetsein; das Sollen und Können der vollen Entwicklung ist mit dem Sein der menschlichen Seele untrennbar verbunden.
Nur sie enthält die Entwicklungsmöglichkeiten, deren Ziele rein in der Teleologie ihres eigenen Wesens beschlossen liegen - nur dass auch sie diese Ziele nicht durch ihr bloßes Wachstum von innen her, das wir als das natürliche bezeichnen, erreicht, sondern dazu von einem bestimmten Punkte an einer Technik, eines willensmäßigen Verfahrens bedarf.
Wenn wir deshalb von "Kultivierung" niederer Organismen, der Pflanzen und Tiere sprechen, - für nicht-organische Wesen lässt schon der Sprachgebrauch diesen Begriff nicht zu - so ist dies ersichtlich nur eine Übertragung nach der Analogie, die irgendwie zwischen dem Menschen und den anderen Organismen besteht; denn wenn auch der Zustand, zu dem die Kultur derlei Wesen führt, in ihrer Organisation angelegt und schließlich mittels ihrer Kräfte herbeigeführt ist, so liegt er doch niemals so in dem eigenen Sinne ihrer Existenz, ist in ihrem natürlichen Stadium niemals so, als eine Art Aktivität, determiniert, wie in der menschlichen Seele die Vollendung, zu der sie gelangen kann.
Nun wird aber gerade von hier aus eine neue Verengerung des Begriffes erforderlich.
Wenn auch die Kultur eine Vollendung des Menschen ist, so ist keineswegs jede Vollendung seiner schon Kultur.
Es gibt vielmehr Entwicklungen, die die Seele rein von innen heraus oder als ein Verhältnis zu transzendenten Mächten oder in einer unmittelbaren ethischen, erotischen, suggestiven Beziehung zu anderen Personen vollzieht, und die sich der Einstellung unter den Kulturbegriff entziehen.
Religiöse Aufschwünge, sittliche Selbsthingaben, die strenge Bewahrung der Persönlichkeit für die nur ihr eigene Existenzart und Aufgabe - alles das sind Werte, die der Seele aus den Instinkten einer Genialität oder aus der Arbeit an sich selbst zuwachsen.
Sie mögen durchaus jenen Begriff erfüllen: dass damit die Anlagen der Person, aus dem natürlich zu nennenden Stadium zu einem Höhepunkt entwickelt werden, der zwar in der eigensten Richtung der Person und ihrer Idee liegt, zu dem aber doch nur das Eingreifen der höchsten seelischen Energien jene Kräfte führen kann - aber doch ist der Begriff der Kultur damit nicht erfüllt.
Denn zu diesem gehört nun noch: dass der Mensch in eine solche Entwicklung etwas, das ihm äußerlich ist, einbezieht.
Gewiss ist Kultiviertheit ein Zustand der Seele, allein ein solcher, der auf dem Wege über die Ausnutzung zweckmäßig geformter Objekte erreicht wird.
Diese Äußerlichkeit und Objektivität braucht nicht nur im räumlichen Sinn verstanden zu werden.
Die Formen des Benehmens etwa, die Feinheit des Geschmackes, die sich in Urteilen offenbart, die Bildung des sittlichen Taktes, die den Einzelnen zu einem erfreulichen Mitglied der Gesellschaft macht - dies alles sind Kulturformationen, die die Vollendung des Einzelnen über reale und ideale Gebiete jenseits seiner selbst führen, diese bleibt hier nicht ein rein immanenter Prozess, sondern vollzieht sich in einer einzigartigen Ausgleichung und teleologischen Verwebung zwischen Subjekt und Objekt.
Wo keine Einbeziehung eines objektiven Gebildes in den Entwicklungsprozess der subjektiven Seele vorliegt, wo sie nicht über ein solches, als über ein Mittel und Stadium ihrer Vollendung, zu sich selbst zurückkehrt, mag sie Werte des höchsten Ranges in sich oder außer sich realisieren, aber es ist nicht der Weg der Kultur in deren spezifischem Sinne, den sie zurücklegt.
Daher begreifen wir aber auch, dass sehr innerliche Naturen, die jeden Umweg der Seele über ein Außerhalb-ihrer auf dem Suchen nach ihrer eigenen Vollendung perhorreszieren, einen Hass auf die Kultur haben können.
Diese notwendige Zweiheit der Elemente zeigt der Kulturbegriff nicht weniger von der Seite des Objekts her.
Wir sind gewohnt, die großen Reihen der künstlerischen und der sittlichen, der wissenschaftlichen und der wirtschaftlichen Produktion ohne weiteres als Kulturwerte zu bezeichnen.
Mag sein, dass sie es durchgehend sind; aber keineswegs sind sie es ihrer rein sachlichen, sozusagen autochthonen Bedeutung nach, und keineswegs ist die Kulturbedeutung des einzelnen Produktes genau derjenigen entsprechend, die es innerhalb seiner eigenen, durch seinen Sachbegriff, sein Sachideal bestimmten Reihe einnimmt.
Ein Kunstwerk etwa untersteht ganz anderen Rangierungen und Normierungen, wenn es innerhalb der kunstgeschichtlichen oder der ästhetischen Reihe und Kategorie betrachtet wird, als wenn sein Kulturwert in Frage steht.
Während jede jener großen Reihen einerseits als Endzweck gelten kann, so dass jedes einzelne Produkt in ihnen einen mit seinem unmittelbaren Genossenwerden und Sichbewähren erwiesenen Wert darstellt, kann alles dies anderseits in die Kulturreihe eingestellt, d. h. auf seine Bedeutung für die Gesamtentwicklung der einzelnen Individuen und ihrer Summe hin angesehen werden.
Auf ihrem eigenen Boden stehend, sträuben sich all diese Werte gegen die Unterbringung in die Kulturreihe: das Kunstwerk fragt nur nach seiner Vollendung an dem Maßstab rein künstlerischer Forderungen, die wissenschaftliche Forschung nur nach der Richtigkeit ihrer Ergebnisse, das wirtschaftliche Produkt nur nach seiner zweckdienlichsten Herstellung und seiner einträglichsten Verwertung.