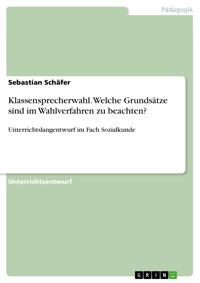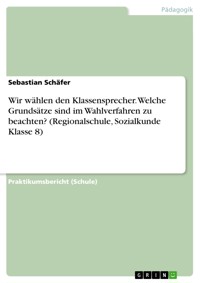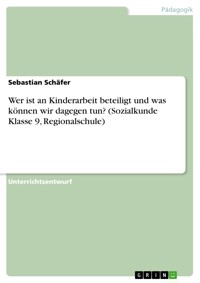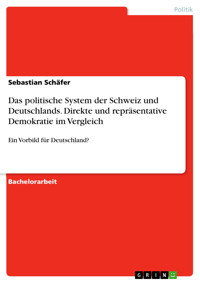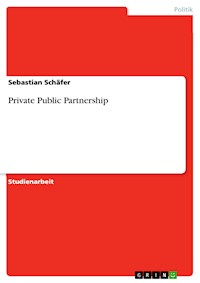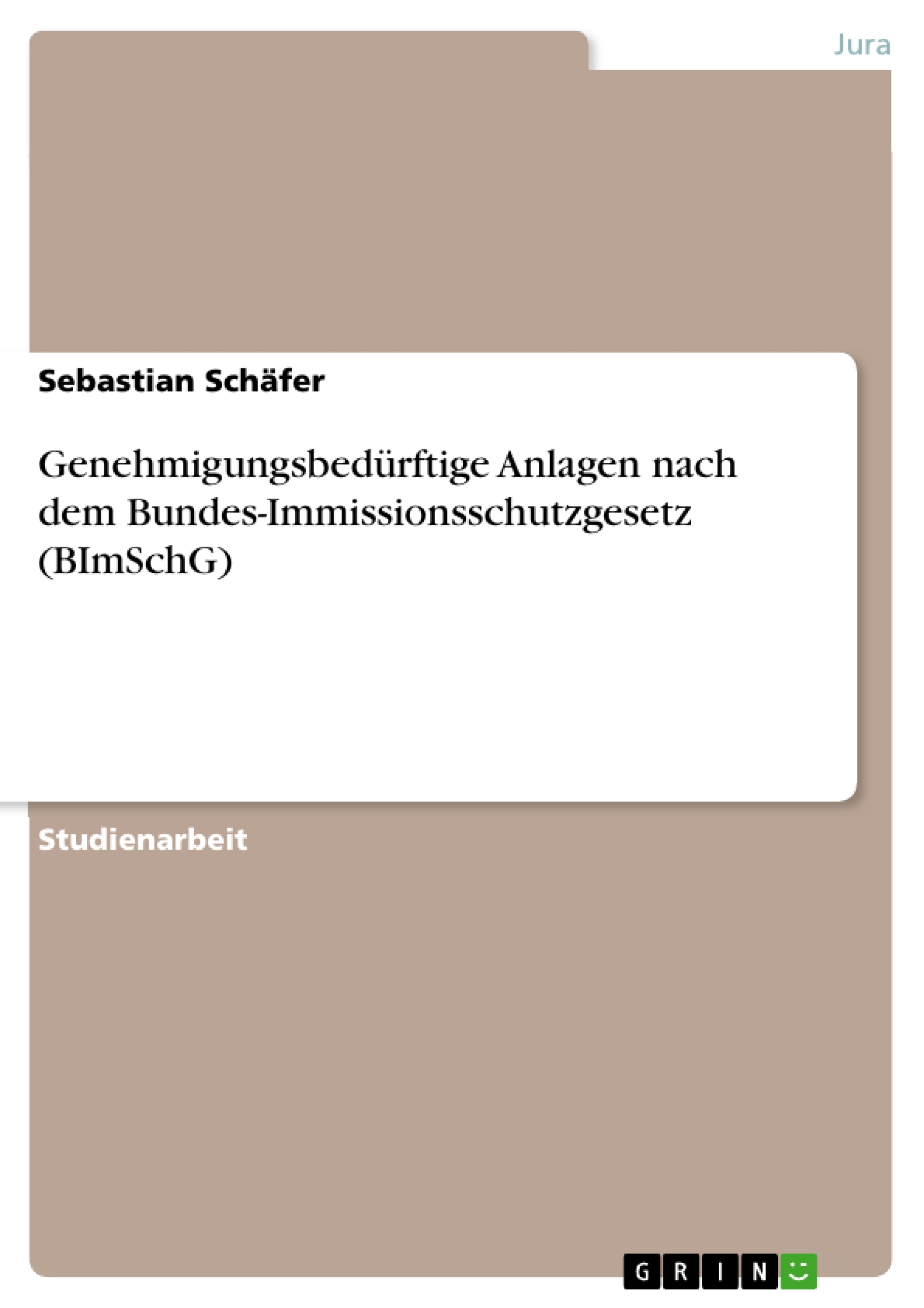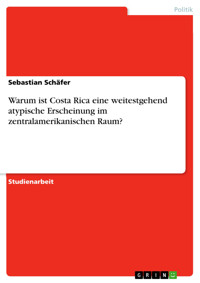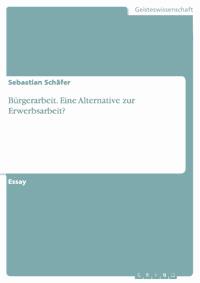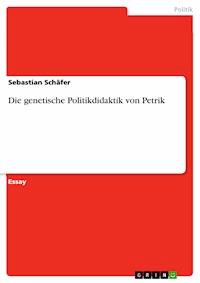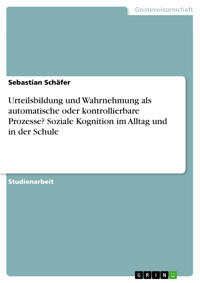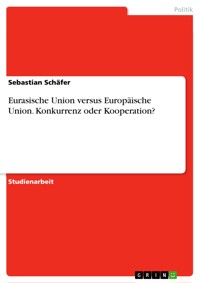
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Politik - Region: Russland, Note: 1,3, Universität Rostock, Sprache: Deutsch, Abstract: Nach dem Niedergang der Sowjetunion 1991 sind im postsowjetischen Raum eine Reihe von Organisationen und Abkommen entstanden. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit (OVKS), die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG) oder die Zollunion zu nennen. Im Oktober 2011 stellte Putin das neue Integrationsprojekt „Eurasische Union“ vor. Hierbei betonte er, dass er keine Wiederbelebung der Sowjetunion anstrebe, sondern eine mächtige supranationale Organisation selbständiger Staaten, die imstande ist eine wichtige Stütze der heutigen Welt und ein Bindeglied zwischen Europa und der asiatisch-pazifischen Region zu werden. Am 01.01.2015 wurde das zuvor ausgehandelte Abkommen der Staaten Russland, Belarus und Kasachstan über die Eurasische Union wirksam. Dabei wäre es falsch diese Integrationsprojekt trotz aller Kompliziertheit einfach als „Integrationstheater“ abzutun, denn die Teilnehmerstaaten verfügen über eine Reihe von günstigen Bedingungen: untrennbare historische Erfahrungen, politische und kulturelle Bindungen sowie mächtige Naturressourcen. Das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland wird in vielerlei Hinsicht als strategische Partnerschaft bezeichnet, die von Kooperation und Konflikt geprägt sind. In Anbetracht dessen wird in der vorliegenden Arbeit folgender Fragestellung nachgegangen: Ist die Eurasische Union ein Konkurrenz- oder Kooperationsmodell zur Europäischen Union? Um die Frage zu beantworten, ist diese Hausarbeit in folgende Kapitel unterteilt: Zunächst rücken die Eurasische Union und die Europäische Union in den Fokus. Hier werden Grundzüge der Geschichte, die grundlegende Struktur sowie verschiedene Handlungsfelder näher betrachtet. Im darauf folgenden Gliederungspunkt stehen verschiedene postsowjetische Staaten im Mittelpunkt. Hierbei werden unterschiedliche Ansichten und Standpunkte die im Zusammenhang mit der Eurasischen- und Europäischen Union stehen, aufgezeigt. Dabei geht es insbesondere um Integrationbemühungen von Russland und der Europäischen Union. Der darauf folgende Abschnitt befasst sich damit, ob ein Dialog zwischen Europäischer und Eurasischer Union zu befürworten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Eurasische Union
2.1 Geschichte der Eurasischen Union
2.2 Die Grundstruktur der Eurasischen Union
2.3 Handlungsfelder der Eurasischen Union
3. Die Europäische Union
3.1 Geschichte der Europäischen Union
3.2 Die Grundstruktur der Europäischen Union
3.3 Politik- und Handlungsfelder der Europäischen Union
4. Integrationswettstreit Russland - Europäische Union
4.1 Russland
4.2 Belarus und Kasachstan
4.3 Armenien
4.4 Ukraine
4.5 Georgien
5. Dialog zwischen Europäischer und Eurasischer Union
6. Zukunftsfähigkeit der Eurasischen Union
Quellenverzeichnis
1. Einleitung
In einer Rede vor der Föderalen Versammlung vor ungefähr zehn Jahren hob Wladimir Putin den Zerfall der Sowjetunion als „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ hervor.[1]
Nach dem Niedergang der Sowjetunion 1991 sind im postsowjetischen Raum ein Reihe von Organisationen und Abkommen entstanden. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit (OVKS), die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG) oder die Zollunion zu nennen. Im Oktober 2011 stellte Putin das neue Integrationsprojekt „Eurasische Union“ vor. Hierbei betont er, dass er keine Wiederbelebung der Sowjetunion anstrebe, sondern eine mächtige supranationale Organisation selbständiger Staaten, die imstande ist eine wichtige Stütze der heutigen Welt und ein Bindeglied zwischen Europa und der asiatisch-pazifischen Region zu werden.[2] Am 01.01.2015 wurde das zuvor ausgehandelte Abkommen der Staaten Russland, Belarus und Kasachstan über die Eurasische Union wirksam. Dabei wäre es falsch diese Integrationsprojekt trotz aller Kompliziertheit einfach als „Integrationstheater“ abzutun, denn die Teilnehmerstaaten verfügen über eine Reihe von günstigen Bedingungen: untrennbare historische Erfahrungen, politische und kulturelle Bindungen sowie mächtige Naturressourcen.[3]
Das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland wird in vielerlei Hinsicht als strategische Partnerschaft bezeichnet, die von Kooperation und Konflikt geprägt sind.[4] In Anbetracht dessen wird in der vorliegenden Arbeit folgender Fragestellung nachgegangen: Ist die Eurasische Union ein Konkurrenz- oder Kooperationsmodell zur Europäischen Union?
Um die Frage zu beantworten, ist diese Hausarbeit in folgende Kapitel unterteilt: Zunächst rücken die Eurasische Union und die Europäische Union in den Fokus. Hier werden Grundzüge der Geschichte, die grundlegende Struktur sowie verschiedene Handlungsfelder näher betrachtet. Im darauf folgenden Gliederungspunkt stehen verschiedene postsowjetische Staaten im Mittelpunkt. Hierbei werden unterschiedliche Ansichten und Standpunkte die im Zusammenhang mit der Eurasischen- und Europäischen Union stehen, aufgezeigt. Dabei geht es insbesondere um Integrationbemühungen von Russland und der Europäischen Union. Der darauf folgende Abschnitt befasst sich damit, ob ein Dialog zwischen Europäischer und Eurasischer Union zu befürworten ist.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema erfolgt mittels Monografien, Sammelwerken, Zeitschriften und Internetquellen. Die Darstellung der Eurasischen Union geschieht insbesondere mit Zeitschriften- und Onlineartikeln. Wichtige Autoren sind z.B. Halbach (2011), Thielicke (2012), Siwizkij (2014) und Satpajew (2014).Um die Europäische Union mit ihren verschiedenen Facetten näher zu betrachten, rücken die Monografien von Weidenfeld und Wessels (2014), Hartmann (2009) sowie Schmuck und Unser (2016) in den Mittelpunkt. Im Analyseteil wird der Konkurrenz- und Kooperationsgedanken aufgegriffen und diskutiert. Dafür werden u.a. folgende Autoren herangezogen: Adomeit (2012), Atilgan und Feyerabend (2015), Siwizkij (2014) und Batura (2016).
Die Begriffe Eurasische Union und Eurasische Wirtschaftsunion (EWU) werden in dieser Arbeit gleichbedeutend verwendet.
2. Die Eurasische Union
In den nachfolgenden Ausführungen rückt die Eurasische Union in den Mittelpunkt.
2.1 Geschichte der Eurasischen Union
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 vereinbarte Russland mit vielen seiner postsowjetischen Nachbarn zahlreiche integrative Maßnahmen. Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) stellt hierbei das älteste Integrationsprojekt im postsowjetischen Raum dar. Viele Maßnahmen, wie beispielsweise das Vorhaben bis zum Jahr 2000 gemeinsame Streitkräfte aufzustellen, wurden jedoch nicht umgesetzt. In den 1990er Jahren sind nur ungefähr zehn Prozent der gemeinsamen Vereinbarungen von den GUS-Ländern tatsächlich realisiert worden. Der Kreml strebte bis hierhin offenbar nicht an, sich eine eurasische Option zu bewahren bzw. zu schaffen. Mit dem Amtsantritt von Wladimir Putin im Jahre 2000 änderte sich die Zusammenarbeit im postsowjetischen Raum deutlich.
Die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft wurde im Jahre 2000 geschaffen. Diesem Bündnis gehören Russland, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Belarus an. 2003 verständigte sich Russland mit Kasachstan, Belarus und der Ukraine einen einheitlichen Wirtschaftsraum zu schaffen, der in Anbetracht Russlands zum Kernstück eines neuen Integrationsprozesses werden sollte, einer „Ost-EU“.[5] Im Jahre 2012 wurde dieses Vorhaben, jedoch ohne die Ukraine, umgesetzt.[6] Als weiteres Abkommen trat 2010 die Zollunion zwischen Russland, Belarus und Kasachstan in Kraft.[7] Zudem wurde 2012 die Eurasische Wirtschaftskommission gegründet. Diese verschiedenen Abkommen ebneten die Gründung der Eurasischen Wirtschaftsunion durch Russland, Belarus und Kasachstan am 1. Januar 2015.[8] Im Anschluss traten Armenien und Kirgistan der Union bei. Die Eurasische Union basiert auf den Grundsätzen: Gleichstellung der Mitgliedstaaten, Achtung der Kultur und Geschichte von Teilnehmerstaaten, Wirtschaftswachstum, ökonomische Integration, globale Konkurrenzfähigkeit, Orientierung an den Normen und Regelungen der Welthandelsorganisation und des Völkerrechts und Offenheit für die Aufnahme weiterer Staaten in die Union.[9]
Es bleibt festzuhalten, dass es seit dem Amtsantritt von Wladimir Putin eine Hinwendung zu Formaten der Kooperation unterhalb der an Bedeutung verlierenden GUS, zu beobachten ist.[10]
Russland agiert hierbei als Hauptinitiator und Motor im eurasischen Integrationsprozess.[11]
2.2 Die Grundstruktur der Eurasischen Union
Bei dem primär ökonomischen Projekt der Eurasischen Union treten die Mitglieder wirtschaftliche Souveränität an die supranationale Ebene ab. Alle Entscheidungen auf den höchsten Ebenen werden im Konsens nach dem Prinzip „Ein Land – Eine Stimme“ gefasst.[12] Organe der Union sind der Eurasische Wirtschaftsrat, der Eurasische Zwischenstaatliche Rat, die Eurasische Wirtschaftskommission (EWK) mit Sitz in Moskau, und das Gericht der Eurasischen Wirtschaftsunion in Minsk. Dem Eurasischen Wirtschaftsrat gehören die Präsidenten und dem Zwischenstaatlichen Rat die Ministerpräsidenten der Teilnehmerstaaten an. Die seit 2012 bestehende Eurasische Wirtschaftskommission bleibt das wichtigste Exekutivorgan der Union.[13] Die Beschlüsse der Kommission werden mit Zweidrittelmehrheit angenommen und gelten als verbindliche Rechtsakte für alle Teilnehmerstaaten.[14] Während die höheren Entscheidungsgremien der Kommission paritätisch besetzt sind, dominieren in der Organisations- und Personalstruktur des EWK-Apparats mit 84% der Mitarbeiter die russischen Vertreter, was auf bevölkerungsorientierte Quoten zurückzuführen ist. Die Gremien der Eurasischen Union werden anteilig von den Mitgliedsstaaten finanziert, wobei Russland mit ca. 88 % den größten Anteil beisteuert (Gesamtbudget 2014 ca. 140 Mio. Euro).[15] Somit besitzt Russland innerhalb der Institutionen mehr organisatorische und finanzielle Ressourcen, womit auf die Entstehung und Durchsetzung von Vorhaben besser Einfluss genommen werden kann. Darüber hinaus ist die Amtssprache in allen Organen russisch.[16] Die von Russland empfohlenen Elemente einer politischen Integration der Mitgliedsstaaten wie z.B. die Schaffung eines Eurasischen Parlamentes, werden von Belarus und Kasachstan abgelehnt. Der Argumentationslogik, jeder wirtschaftlichen Integration folgt auch eine politische Zusammenführung, wie am Beispiel der EU, wird nicht unterstützt. Bei ihnen dominiert das ökonomische Kalkül. Darüber hinaus sehen sie ihre nationale Souveränität in Gefahr.[17]
2.3 Handlungsfelder der Eurasischen Union
Der Vertrag der Eurasischen Wirtschaftsunion reguliert 19 Bereiche wirtschaftlicher Tätigkeiten zwischen den Mitgliedsstaaten. Dazu zählen u.a. Zollvorschriften, Außenhandel, technische Bestimmungen, Regulierung der Finanzmärkte, Steuern, Energie und Transport. Damit schafft die Union die Voraussetzungen für den freien Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Arbeit zwischen den Teilnehmerstaaten. Alle internationalen Aktivitäten der Eurasischen Union, einschließlich der Eurasischen Kommission, werden der Kontrolle des Obersten Eurasischen Wirtschaftsrates unterworfen. Nur mit dessen Zustimmung können internationale Verträge abgeschlossen werden.[18] Darüber hinaus verpflichtet sich die Eurasische Union zum fairen Wettbewerb und untersagt die Förderung von Monopolen. Wirtschaftliche Grundfreiheiten, wie beispielsweise Berufs- und Eigentumsfreiheit, werden wiederum nicht zuverlässig gewährleistet.[19]
3. Die Europäische Union
Im folgenden Kapitel wird die Europäische Union näher betrachtet.
3.1 Geschichte der Europäischen Union
Gemeinsame historische Erfahrungen und interessenorientierte Politik waren von Beginn an die Eckpfeiler der europäischen Integration. Insbesondere nach dem 2. Weltkrieg sahen sich die europäischen Staaten in einer geschichtlichen Sondersituation, gekennzeichnet durch den eigenen Niedergang und der Frontstellung der Sowjetunion. Aus dieser Ausgangslage heraus starteten die Europäer das Experiment der Integration.[20]
Von Anfang an waren gemeinsame Verträge die Grundlage des Kooperierens. Am 18.4.1951 unterzeichneten die Staaten Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande den Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Mit diesem Abkommen sollte ein gemeinsamer Markt für Kohle und Stahl geschaffen sowie die Kontrolle dieses kriegswichtigen Industriezweigs ermöglicht werden. Den notwendigen Rahmen hierfür legten die „Hohe Behörde“ (Exekutivrechte) und der “Besondere Ministerrat“ (Richtlinien- und Legislativrechte) fest. Der elfköpfige Gerichtshof wachte über das Vereinbarte. Mit der umfangreichen ökonomischen Integration des Wirtschaftssektors Kohle und Stahl war es erstmals gelungen nationalstaatliche Kompetenzen auf eine supranationale Ebene zu übertragen. In den folgenden Jahren schritt die wirtschaftliche Integration mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Euratom (Aufbau und Entwicklung der Nuklearindustrie) weiter voran. Auch die Idee der politischen Integration wurde weiter verfolgt. Am 1. Juli 1967 wurden die Organe (Kommission, Ministerrat, Gerichtsof und Versammlung) der drei Europäischen Gemeinschaften per Fusionsvertrag integriert. Im Jahre 1979 konnten die Bürger der Europäischen Gemeinschaft durch die Wahl des Parlaments erstmals direkt Einfluss auf die Gestaltung der europäischen Politik nehmen.[21] Verschiedene Integrationswerke haben in den darauffolgenden Jahrzehnten weiter an Bedeutung gewonnen.[22]
Im Vertrag von Maastricht wird erstmals von einer „Europäischen Union“ gesprochen. Durch die Gründung der Europäischen Union am 7. Februar 1992 wurde die bisher hauptsächlich wirtschaftlich integrierte Gemeinschaft weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit erfolgte nun auch in der Justiz- und Innenpolitik sowie in der Außen- und Sicherheitspolitik. Darüber hinaus wurden die Kompetenzen des Europäischen Parlaments z.B. durch Mitentscheidungsrechte in den Bereichen Binnenmarkt, Verbraucherschutz und Umwelt deutlich verstärkt. Zudem erhielt das Parlament Untersuchungs- und Petitionsrechte.[23] Es stand „[…] nun ein Instrumentarium zur Verfügung, das der bisherigen Koordinierung im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit gefehlt hatte“.[24] Der Vertrag von Lissabon von 2009 stellt den vorläufigen Endpunkt der Reform der Europäischen Union dar.[25]
3.2 Die Grundstruktur der Europäischen Union
Wie unter Gliederungspunkt 3.1 beschrieben ist die institutionelle Ausdifferenzierung der Europäischen Union als Prozess zu verstehen, der in seiner Gesamtheit schon über 60 Jahre andauert.
In Hinblick auf die aktuelle Struktur des EU-Systems ist festzustellen, dass mehrere Organe die Angelegenheiten der Union regeln. Dies sind der Europäische Rat, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union (Ministerrat), der europäische Gerichtshof, der Europäische Rechnungshof und die Europäische Zentralbank. Darüber hinaus gibt es beratende Ausschüsse, z.B. Ausschuss der Regionen und Einrichtungen mit Sonderstatus z.B. Europol. Die Europäische Union verfügt über ein komplexes Entscheidungsgefüge in verschiedenen Bereichen.[26] Der Europäische Rat, bestehend aus den 28 Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten, muss in der Regel einstimmig entscheiden. Jedoch gibt es Ausnahmen, in denen er mit Mehrheit votieren kann. In diesem Gremium werden allgemeine Zielvorstellungen und Prioritäten der EU-Politik bestimmt. Darüber hinaus legt er die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union fest. Im Ministerrat werden Gesetzgebungsakte und andere wichtige Angelegenheiten wie z.B. der EU-Haushalt beschlossen. In vielen Bereichen, insbesondere bei der Gesetzgebung, darf das Parlament allerdings gleichberechtigt mitentscheiden.
Die europäische Kommission besitzt bei der Gesetzgebung das Initiativmonopol.[27] Darüber hinaus sorgt sie für die Umsetzung der erlassenen Verträge und Maßnahmen (Exekutivfunktion).[28] Alle Entscheidungen, wie beispielsweise die Verhängung von Geldstrafen bei Missachtung von Wettbewerbsregeln, werden von der Kommission mit Mehrheit gefasst. Da das Parlament die Kommission kontrolliert und auch absetzen kann, ist das Verhältnis nicht immer spannungsfrei. Insbesondere beim Entscheidungsprozess in der Gesetzbebung wird das Zusammenspiel von Rat, Parlament und Kommission deutlich. Ob ein Gesetz zustande kommt oder nicht hängt von verschiedenen Mehrheitsentscheidungen (z.B. qualifizierte Mehrheit) in den Organen ab.[29]
Im Jahre 2005 arbeiteten in den Organen Rat, Parlament, Kommission und Gerichtshof ca. 28.000 Personen.[30]
3.3 Politik- und Handlungsfelder der Europäischen Union
Die Europäische Union darf nur im Rahmen ihrer zustehenden Kompetenzen tätig werden. Hierbei werden ausschließliche, konkurrierende und unterstützende Zuständigkeiten unterschieden. Zu den ausschließlichen Zuständigkeiten gehören jene Politikbereiche, in denen die Europäische Union die Gesetzgebungskompetenz hat. Dazu zählen u.a. folgende Bereiche: Zollunion, Wettbewerbsregeln, Währungspolitik und gemeinsame Handelspolitik.
Konkurrierende Zuständigkeiten, dass heißt Europäische Union und Mitgliedsstaaten haben eigene Kompetenzen, lassen sich u.a. in diesen Bereichen verorten: Teilbereiche der Sozialpolitik, Verkehrspolitik, Verbraucherschutz, Energiepolitik sowie wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt.[31] Jenseits der Verfahren zur Gesetzgebung gibt es im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik besondere Entscheidungsverfahren.[32]
4. Integrationswettstreit Russland - Europäische Union
Im folgenden Abschnitt rücken zunächst Russland, Belarus, Kasachstan und Armenien als Vertreter der Eurasischen Union in den Fokus. Im Anschluss wird die Ukraine als Stellvertreter des Westrandes des postsowjetischen Raumes näher betrachtet. Schließlich steht Georgien als Land im Südkaukasus im Mittelpunkt. Hierbei werden verschiedene Sichtweisen die im Zusammenhang mit der Eurasischen- und Europäischen Union stehen, aufgezeigt.
4.1 Russland
Für Russland stellt die Eurasische Union nicht nur ein ökonomisches, sondern vor allem ein wichtiges geopolitisches Projekt dar. Dafür spricht die Tatsache, dass Russland seit Bildung der Eurasischen Union beharrlich versucht zwischen den Teilnehmerstaaten den Prozess der politischen Integration zu beschleunigen.[33] Ein weiteres Argument hierfür ist, dass seit der Einführung der Zollunion 2010 der Außenhandel Russlands mit den EAWU-Staaten nur zwischen 7 und 7,5% liegt.[34] Russland sorgt sich um die eigene Position im postsowjetischen Raum. Für Russland ist die Beteiligung an der Gründung der Eurasischen Union weniger der Versuch die Sowjetunion wiederzubeleben, als vielmehr das Ersuchen einen regionalen Block zu bilden, denn die geopolitische Konkurrenz und die damit verbundene Umverteilung von Einflusssphären ist im vollen Gange.[35] Die Eurasische Union soll hierbei eine gefragte Alternative zur Assoziation mit der Europäischen Union darstellen, die mit der Gründung der Östlichen Partnerschaft (ÖP) im Jahre 2009, die Nachbarschaftspolitik mit den kaukasischen Staaten Armenien, Aserbaidschan und Georgien sowie mit Belarus, Moldau und der Ukraine erweitern und vertiefen will. Den Teilnehmerländer der Östlichen Partnerschaft offeriert die Europäische Kommission bilaterale Verhandlungen über Assoziierungsabkommen, die umfangreiche Freihandelsabkommen beinhalten. Darüber hinaus werden Demokratie, gute Regierungsführung und wirtschaftliche Integration akzentuiert. Hierbei betonte Brüssel mehrmals, dass diese Initiative nicht gegen Russland gerichtet ist und Moskau von Fall zu Fall in anstehende Projekte einbezogen werden kann.[36] Während die EU die Östliche Partnerschaft als Teil eines erweiterten Europas ansieht, mit deren Hilfe Werte und Normen der EU übertragen werden sollen, betrachtet Russland die Teilnehmerländer als „nahes Ausland“. Der postsowjetische Raum gilt in Russland als „nahes Ausland“ und wird in Moskau als eigene Einflusssphäre betrachtet, in der andere Staaten und Staatengemeinschaften wie die EU nicht erwünscht sind.[37]
Aus aktueller Sicht stehen den drei westlich orientierten Nachbarn Ukraine, Georgien und Moldau, die alle Assoziierungsabkommen mit der EU haben, die Länder Belarus, Armenien und Aserbaidschan gegenüber. Armenien und Belarus sind bereits Mitglieder der russisch dominierten Eurasischen Union.[38]
Hervorzuheben ist hierbei, dass aus russischer Sichtweise Belarus der engste Partner im eurasischen Raum ist und die Ukraine ein Land ohne die die Integration äußerst unvollkommen wäre.[39]
4.2 Belarus und Kasachstan
Aufgrund der Spannungen zwischen der Führung Belarus und den westlichen Ländern bleibt der europäische Markt für belarussische Produkte verschlossen.[40]
Für Belarus, ist der russische Absatzmarkt von großer Bedeutung. Hier werden ca. 90% der Nahrungsmittel und 70% aller Industrieprodukte verkauft. Im Zuge der Verhandlungen hin zu einer Eurasischen Union betonte Weißrussland explizit, dass es um eine reine wirtschaftliche Integration in verschiedenen Wirtschaftssektoren geht. Deshalb wurden alle Bereiche die über eine wirtschaftliche Integration hinausgehen, ausgeschlossen. Das sind beispielsweise der Grenzschutz und die Sicherheitspolitik. Weiterhin handelte Belarus mit Russland einen ermäßigten Gaspreis und eine Reihe von Krediten heraus, die u.a. zur Vertiefung der Industriekooperation zwischen belarussischen und russischen Unternehmen genutzt worden.[41] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ein gleicher Zugang zu Pipelines und gleiche Preise in Hinblick auf den Transport von Energieressourcen bestehen. Dabei wird auch die Kooperation mit Kasachstan hervorgehoben.[42] Dementsprechend bestehen die Ziele Belarus darin, den Zugang zum Gesamtmarkt zu erweitern und die garantierten Energiepräferenzen mit Russland zu erhalten.[43]
Für Kasachstan beruht der Beitritt in die Eurasische Union ebenfalls auf wirtschaftlichen Pragmatismus. Ferner sieht der Präsident Kasachstans Nursultan Nasarbajew die Eurasische Union als persönlichen Triumph, da er diese bereits im Jahr 1994 formuliert hatte. Ebenso wie Belarus besteht das Land auf seine politische Souveränität und lehnt jegliche Einmischung diesbezüglich ab. Als Mitglied in der Union sieht Kasachstan die Möglichkeit u.a. folgende wirtschaftliche Ziele zu erreichen: Marktöffnung für kasachische Unternehmen, Aktivierung des grenzüberschreitenden Handels mit Russland, geringere Transportkosten, Erhöhung der Attraktivität für Investoren, vereinfachte Verfahren zur Aufnahme einer Beschäftigung in den Ländern der EAWU und Schaffung regionaler und globaler Logistikrouten, die die Handelsströme Europas und Asiens über Kasachstan miteinander verbinden.[44]
4.3 Armenien
In Bezug auf Armenien ist eine Schaukelpolitik zwischen Russland und dem Westen zu erkennen. Zwar verhandelte das Land im Rahmen der Östlichen Partnerschaft über längere Zeit mit der EU über ein Assoziierungsabkommen, entschied sich aber kurz vor der Unterzeichnung des Abkommens dazu der Eurasischen Union beizutreten.[45] Auch im Fall des Beitritts von Armenien offerierte Russland diverse Sonderbedingungen, wie z.B. Ermäßigungen für russisches Erdgas und russische Investitionen für die Modernisierung des armenischen Eisenbahnnetzes.[46] Hierbei hat Armenien allerdings nicht die Absicht sich vollends von der EU abzuwenden, sondern eine Zusammenarbeit mit Brüssel fortzusetzen, sofern sie mit der Mitgliedschaft der Eurasischen Union vereinbar ist. Die mit der EU ausgehandelte besondere Variante eines Assoziierungsabkommens (AA Light) mit Armenien ist ein Testfall für die Vereinbarkeit der Mitgliedschaft in der Eurasischer Union und gleichzeitiger selektiver Annäherung an die Europäische Union.[47]
4.4 Ukraine
Im Integrationswettstreit zwischen EU und Russland stellt die Ukraine das wichtigste Land dar. Dies beruht insbesondere auf der strategisch wichtigen Lage zwischen mehreren EU-Mitgliedsstaaten und Russland sowie der mit 46 Millionen Einwohnern vergleichsweise großen Bevölkerung. Für Russland ist die Ukraine nicht nur ein wichtiges Transitland für Gaslieferungen in EU-Länder, sondern ein Land das über Jahrhunderte eine gemeinsame Staatsangehörigkeit mit Russland inne hatte.[48]
Die nachfolgende Grafik zeigt das Verständnis der Russländischen Bevölkerung zur Ukraine. Es wird deutlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Ukraine nicht als Ausland betrachtet.
Abb.1: Halten sie die Ukraine für Ausland? Quelle: http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/RusslandAnalysen283.pdf [Zugriff: 15.03.16].
Der Kreml unter Führung Wladimir Putins weist auf die zentrale Bedeutung der Ukraine für das Integrationsprojekt Eurasische Union hin. So wäre die Union ohne die Ukraine eher eine zentralasiatische als eine euroasiatische Union.[49] Wie unter Gliederungspunkt 4.1 erwähnt, bot die EU im Rahmen der Östlichen Partnerschaft der Ukraine ein Assoziierungsabkommen an, welches auch eine Freihandelszone umfasste.
Im Januar 2013 sollte dieses Abkommen verhandelt und unterschrieben werden. Die von Wladimir Putin initiierte Eurasische Union sah ebenfalls eine Freihandelszone vor, die aber mit der Freihandelszone der EU nicht verträglich war. Die Ukraine war somit gezwungen sich festlegen. In der entscheidenden Phase verweigerte der ukrainische Präsident Janukowitsch unter Druck von Russland die Unterschrift unter das Assoziierungsabkommen mit der EU. Dies führte zu monatelangen Protesten und zu einer innenpolitischen Zerreißprobe für das Land.[50]
Nichtdestotrotz gelang es Putin nicht die Ukraine zum Beitritt in die Eurasische Union zu bewegen, stattdessen wurde im Rahmen der Östlichen Partnerschaft die Freihandelszone mit der EU ab 01.01.2016 umgesetzt.[51]
4.5 Georgien
Die noch sehr junge Demokratie in Georgien misst der Annäherung an die EU einen hohen Stellenwert bei. Im Juni 2014 hat Georgien ein Assoziationsabkommen mit der EU unterzeichnet. Diese Vereinbarung beinhaltet eine „tiefe und umfassende“ Freihandelszone. Überdies hat Georgien deutlich gemacht, dass es eine Vollmitgliedschaft in der EU anstrebt. Neben einer wirtschaftlichen und demokratischen Stabilisierung erhofft man sich insbesondere vor dem Hegemonialstreben Russlands sicher zu sein.[52]
5. Dialog zwischen Europäischer und Eurasischer Union
Seit der Ukraine Krise sind die Formate des Dialogs zwischen EU und Russland verringert worden. Insbesondere wirtschaftliche Beziehungen wurden mit der Einführung der Sanktionen gegen Russland den politischen Beziehungen untergeordnet. Dennoch ist der Beibehalt eines Dialogs unerlässlich, um zumindest langfristig zum Aufbau gegenseitigen Vertrauens beizutragen. Das EU-EWU Format ist hierbei ein geeignetes Format, in dem Russland und die EU über ihre wirtschaftlichen Interessen diskutieren können. Vorteilhaft ist, dass im Rahmen der EWU noch andere Länder an den Gesprächen teilnehmen können. Dabei sind besonders Armenien und Kasachstan daran interessiert die Differenzen zwischen Russland und der EU zu verringern. Da Russland das Ziel hat, die EWU funktionsfähig zu halten, ist das Land bereit Zugeständnisse gegenüber den kleineren Mitgliedstaaten zu machen, was sich im Dialog mit der EU positiv auswirken kann.
Andererseits kann ein Austausch auf dieser Ebene vom russischen Regime als Zeichen der Anerkennung der politischen Macht verstanden werden. Jeder Dialog mit Russland ist diesem Risiko ausgesetzt. Da die EWU keine Institution mit starker ideologischer Ausrichtung ist, ist dieses Risiko allerdings als relativ gering einzuschätzen. Auch für die anderen Mitgliedsstaaten bestehen Anreize mit der EU im Gespräch zu bleiben. Ohne einen Dialog können die Länder aufgrund der Mitgliedschaft in der EAU ihre Handelsbeziehungen mit der EU nicht weiterverfolgen. Der EU wiederum, würde ein beständiger Dialog besonders dann zu Gute kommen, wenn es zum Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen mit der EWU kommen sollte.[53]
Im Januar 2015 offerierte der russische Botschafter Wladimir Tschischow der EU eine gemeinsame Freihandelszone mit der Eurasischen Wirtschaftsunion zu bilden und auf das Freihandelsabkommen (TTIP) mit den USA zu verzichten.[54]
6. Zukunftsfähigkeit der Eurasischen Union
Die in der Einleitung formulierte Fragestellung: „Ist die Eurasische Union ein Konkurrenz- oder Kooperationsmodell zur Europäischen Union? schließt auch die Zukunftsfähigkeit der Eurasischen Union mit ein. Basierend auf den Ergebnissen im Hauptteil werden im Folgenden verschiedene Aspekte dargestellt. Da sich die Eurasische Union in vielem ein Vorbild an der Europäischen Union nimmt, wurde in einigen Punkten ein Vergleich mit dieser Institution vorgenommen. Es stellte sich heraus, dass die Anfänge der Europäischen Union, als supranationale Organisation, bereits auf das Jahr 1951 zurückführen. Die Eurasische Union, der eine Reihe von Abkommen vorausgingen, wurde hingegen erst im Jahr 2015 gegründet und umfasst mit derzeit fünf Mitgliedsstaaten wesentlich weniger Teilnehmer als die Europäische Union. Die Organisatorische Struktur der Eurasischen Union ist der Europäischen Union in vielem ähnlich. So besitzt sie ebenfalls wie die EU supranationale Elemente. Auffällig ist jedoch, dass die EAU ein rein wirtschaftliches Integrationsprojekt ist. Dementsprechend wird die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Organe, wie z.B. Eurasische Wirtschaftskommission oder Eurasischer Wirtschaftsrat, betont. Jeder russische Vorschlag einer politischen Integration, z.B. durch Schaffung eines Eurasischen Parlamentes, wird besonders von den Teilnehmerstaaten Belarus und Kasachstan abgelehnt. Der Argumentationslogik, jeder wirtschaftlichen Integration folgt auch eine politische Zusammenführung, wie am Beispiel der EU, wird nicht unterstützt. Hierbei sehen sie ihre nationale Souveränität in Gefahr. Dies untermauert auch die Tatsache, dass es keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gibt, die bei der EU hervorgehoben und umgesetzt wird. Ob sich die EAU bewährt, ist auch davon abhängig, ob in Zukunft diverse wirtschaftliche Grundfreiheiten wie beispielsweise Berufs- und Eigentumsfreiheit zuverlässig gewährleistet werden können. Es ist deutlich geworden, dass Russland im Integrationswettstreit mit der EU steht. Für Russland ist die EAU vorwiegend ein geopolitisches Projekt, um seine Vormachtstellung in Eurasien zu betonen. Um die heutigen Teilnehmerländer wie beispielsweise Belarus, Kasachstan und Armenien von der EAU zu überzeugen, wurden ihnen umfangreiche Kredite und Gaspreissenkungen versprochen. Momentan profitiert vor allen Dingen Belarus von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der EAU. Für Russland hingegen liegt der Außenhandel mit den EAWU-Staaten nur zwischen 7 und 7,5%. Somit ist der wirtschaftliche Nutzen für Russland marginal. Im vorhandenen Integrationswettstreit mit der EU ist auffällig, dass Russland den postsowjetischen Raum als eigene Einflusssphäre betrachtet und dabei andere Staaten und Staatengemeinschaften nicht akzeptiert. Dies betrifft auch das Projekt der Östliche Partnerschaft (ÖP) der EU, mit dessen Hilfe die Nachbarschaftspolitik mit den kaukasischen Staaten Armenien, Aserbaidschan und Georgien sowie mit Belarus, Moldau und der Ukraine erweitert und vertieft werden soll. Aus aktueller Sicht stehen den drei westlich orientierten Nachbarn Ukraine, Georgien und Moldau, die alle Assoziierungsabkommen mit der EU haben, die Länder Belarus, Armenien und Aserbaidschan gegenüber. Armenien und Belarus sind bereits Mitglieder der russisch dominierten Eurasischen Union. Dennoch ist ein Dialog zwischen EU und EWU zu befürworten. Da Russland daran interessiert ist die EWU funktionsfähig zu halten, ist es bereit Zugeständnisse gegenüber den kleineren Mitgliedstaaten zu machen. Darüber hinaus würde der EU ein kontinuierlicher Austausch zu Gute kommen, falls es zum Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen mit der EWU kommen sollte.
Die umfangreichen Ausführungen zur EWU und EU haben insgesamt deutlich gemacht, dass vielmehr die Konkurrenz- als die Kooperationsthese zu unterstützen ist.
Schlussgedanken
Quellenverzeichnis
Literaturquellen:
Adomeit, Hannes (2012): Integrationskonkurrenz EU-Russland. Belarus und Ukraine als Konfliktfelder. In: Osteuropa 62 (6-8).
Halbach, Uwe (2011): Wladimir Putins Eurasische Union. Ein neues Integrationsprojekt für den GUS- Raum? In: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (51).
Halbach, Uwe (2012): Russlands Ambitionen einer Eurasischen Union. In: Erler, Gernot/Schulze. Peter W. (Hg.), Die Europäisierung Russlands: Moskau zwischen Modernisierungspartnerschaft und Großmachtrolle.
Hartmann, Jürgen (2009): Das politische System der Europäischen Union. Eine Einführung. Frankfurt/New York: Campus Verlag.
Heinemann-Grüder, Andreas (2014): Politik als Krieg: Die Radikalisierung des Putinismus. In: Osteuropa 64 (9-10).
Schladebach, Marcus/Kim, Vitaliy (2015): Die Eurasische Wirtschaftsunion: Grundlagen, Ziele, Chancen. In: WIRO (6).
Schmuck, Otto/Unser, Günther (2016): Die Europäische Union. Aufgaben, Strukturen und Chancen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Thielicke, Hubert (2012): Die Eurasische Union. Postsowjetischer Traum oder weitreichendes Integrationsprojekt? In: Welt Trends (8).
Weidenfeld, Werner (2013): Die Europäische Union. 3. Auflage. München: Wilhelm Fink.