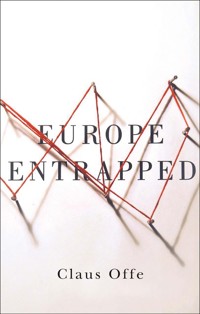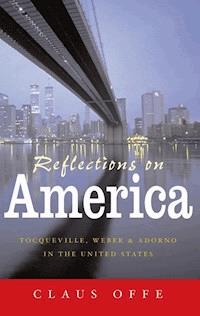15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Krise zeigt, wie unbedacht es war, einem heterogenen Wirtschaftsraum eine Einheitswährung zu verordnen, ohne ihn politisch zu einen. Die Eurozone ist nun gespalten in Gewinner und Verlierer. Der Süden ächzt unter dem verheerenden Spardiktat, rechtspopulistische Kräfte machen im Norden mobil. Wir haben es mit einer Krise des Krisenmanagements zu tun: Die Technokraten in Brüssel haben kein demokratisches Mandat, während nationale Regierungen andere Ziele verfolgen als das europaweite Gemeinwohl. Claus Offe kartographiert die Zwickmühlen, in denen die EU steckt. Er plädiert für eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik, die die Bürger für Europa gewinnen und das Gefälle in der Eurozone abflachen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die Krise zeigt, wie unbedacht es war, einem heterogenen Wirtschaftsraum eine Einheitswährung zu verordnen, ohne ihn politisch zu einen. Die Eurozone ist nun gespalten in Gewinner und Verlierer. Der Süden ächzt unter dem verheerenden Spardiktat, rechtspopulistische Kräfte machen im Norden mobil. Wir haben es mit einer Krise des Krisenmanagements zu tun: Die Technokraten in Brüssel haben kein demokratisches Mandat, während nationale Regierungen andere Ziele verfolgen als ein europaweites Gemeinwohl.
Claus Offe kartografiert die Zwickmühlen, in denen die EU steckt. Er plädiert für eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik, die die Bürger für Europa gewinnen und das Gefälle in der Eurozone abflachen könnte.
Claus Offe
Europa in der Falle
Die Originalausgabe dieses Buches erschien 2014 unter dem Titel Europe Entrapped bei Polity Press (Cambridge).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2691.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept
von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
Für Zygmunt Bauman
den Gelehrten und europäischen Bürger
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
I.
Demokratischer Kapitalismus und Europäische Union
II.
Die Natur der Krise
III.
Wachstum, Schulden und Teufelskreise
IV.
Kein Zurück zum Ausgangspunkt
V.
Auf der Suche nach politischer Handlungsfähigkeit
VI.
Motive für das politische Projekt der EU-Integration
VII.
Politische Kräfte und Interessen
VIII.
Die deutsche Führungsrolle? Eine Scheinlösung
IX.
Ausgedünnte demokratische Rechte: Die hässliche Seite des EU-Herrschaftssystems
X.
Umverteilung zwischen Staaten, Klassen und Generationen
Literatur
Abkürzungsverzeichnis
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
EP
Europäisches Parlament
ER
Europäischer Rat
ESM
Europäischer Stabilitätsmechanismus (auch: Europäisches Sozialmodell)
EuGH
Europäischer Gerichtshof
Eurostat
Statistisches Amt der Europäischen Union
EVP
Europäische Volkspartei
EZB
Europäische Zentralbank
IWF
Internationaler Währungsfonds
OMT
Outright Monetary Transactions
PIIGS
Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Spanien
S&D
Sozialisten und Demokraten (Fraktion des EP)
UKIP
United Kingdom Independence Party
VAEU
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
VEU
Vertrag über die Europäische Union
WWU
Wirtschafts- und Währungsunion
Vorwort
Die Krise und die Ungewissheiten, die der Euro ausgelöst hat, haben in der ganzen Eurozone und darüber hinaus zu hitzigen Debatten und tiefgehenden nationalen und internationalen Konflikten geführt. In diesem schmalen, im Original auf Englisch verfassten Band versucht der Verfasser, die Turbulenzen, die der Euro für Staaten und Gesellschaften der EU und der Eurozone verursacht hat, verständlich zu machen. Der Fokus liegt auf dem Problem der politischen Handlungsfähigkeit: Gibt es soziale und politische Kräfte, inspirierende Ideen oder mit ausreichenden Ressourcen ausgestattete Akteure, die die Europäer aus der Falle, in die sie der Euro geführt hat, befreien könnten? Deutschland ist der Mitgliedsstaat, mit dem der Verfasser am besten vertraut ist; das ist nicht der einzige Grund, warum das Land in dieser Analyse eine besondere Rolle spielt. Das Buch beruht auf einem Aufsatz mit demselben Titel, der 2013 zunächst in den Blättern für deutsche und internationale Politik und dann erweitert 2013 im European Law Journal erschienen ist. Eine Reihe von Kollegen hat mich ermutigt, diesen Aufsatz zu aktualisieren und zu einem Buch auszuarbeiten. Da das Original auf Englisch verfasst wurde, sind Verweise auf die reichhaltige deutschsprachige Literatur zum Thema auf ein Minimum beschränkt.
Viele der hier angestellten Überlegungen haben von den Arbeiten von und Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen profitiert: Albena Azmanova, Angelo Bolaffi, Hauke Brunkhorst, Manuel Castells, Alessandro Cavalli, Stefan Collignon, Christoph Deutschmann, Henrik Enderlein, Gerd Grözinger, Ulrike Guérot, Jürgen Habermas, Anke Hassel, Christian Joerges, Otto Kallscheuer, Alexander E. Kentikelenis, Ivan Krastev, Agustín J. Menéndez, Ulrich K. Preuß, Fritz W. Scharpf, Wolfgang Streeck, John Thompson, Reinhard Ueberhorst, Jonathan White und Lutz Wingert. Ihnen gilt mein Dank. Dieser gilt in besonderem Maße auch meiner Mitarbeiterin Ines André-Schulze für ihre Hilfe bei der Bearbeitung des Textes.
Berlin, im Oktober 2015
Claus Offe
Einleitung
Die Europäische Union befindet sich an einem Scheideweg: Entweder gelingt eine erhebliche Verbesserung ihrer institutionellen Struktur oder es kommt zu ihrem Zerfall. Der Status quo lässt sich jedenfalls nicht fortschreiben. Darüber, dass es nicht weitergehen kann wie bisher, sind sich so gut wie alle einig, sowohl in Europa selbst wie auch die auswärtigen Beobachter der Situation. Ich stehe insofern keineswegs allein mit der Auffassung da, dass die gegenwärtige Krisensituation – die sich zusammengebraut hat aus einer Finanzmarktkrise, einer Staatsschuldenkrise, einer Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise und einer Institutionenkrise der EUund ihrer demokratischen Qualität – wegen ihrer Komplexität und Ungewissheit beispiellos und dauerhaft besorgniserregend ist.[1] Wenn es nicht schnell (wobei niemand weiß, was in diesem Fall »schnell genug« bedeutet, weil wir nicht wissen, ob wir uns »am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Krise« befinden[2]) gelingt, die Probleme durch eine institutionelle Generalüberholung der EU zu lösen, werden sowohl das Projekt der europäischen Integration als auch die Weltwirtschaft erheblichen Schaden nehmen – von den schweren sozialen Leiden, die die Gesellschaften der europäischen Peripherie schon durchstehen mussten, ganz zu schweigen.
Es erscheinen pro Monat Dutzende akademische Artikel, policy papers und journalistische Beiträge, in denen die Frage erörtert wird, was man tun könne, um die Krise zu »lösen«. Diese Analysen operieren häufig mit den Alternativen »Rückbau oder Vertiefung der europäischen Integration«.[3] Sie präsentieren zwei oder mehr vorgestellte Auswege aus der Krise und sortieren diese dann nach ihrer vermuteten Machbarkeit und den politischen Präferenzen der Verfasser.
Während diese erste Diagnose einer vielgesichtigen Krise weithin geteilt wird, ist eine zweite Beobachtung eher kontrovers: nämlich die, dass die Krise diejenigen Kräfte weitgehend gelähmt und zum Schweigen gebracht hat, die überhaupt fähig wären, Lösungen zu konzipieren, durchzusetzen und so konstruktive Auswege zu eröffnen. Anders als manche marxistische Denker ebenso wie selbstgewisse Technokraten behaupten, bringen Krisen die Kräfte zu ihrer Überwindung nicht immer selbst hervor. Wir beobachten heute das Gegenteil: Solche Kräfte werden durch die Krise nicht geweckt, sondern blockiert. Anstatt eine positive Dynamik des Lernens und des Widerstandes zu entfalten, werden potentielle Akteure der Veränderung durch die Auswirkungen der Krise selbst deaktiviert und entmutigt. Während es Hoffnungen (z. B. auf einen wirtschaftlichen Aufschwung) und Visionen (z. B. die einer föderativen europäischen Republik) oder auch rückwärtsgewandte Voten für eine Rückkehr zum Nationalstaat bzw. den Ausschluss wirtschaftlich schwacher Mitgliedsstaaten aus der Eurozone zuhauf gibt, bleibt doch die Frage offen, ob überhaupt irgendjemand (und ggf. wer) ausreichend legitimiert und mit genügend politischen und wirtschaftlichen Ressourcen ausgestattet ist, um eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die Europa in eine wünschbare und nachhaltige Zukunft führen könnte. Auch gibt es keinen Konsens darüber, nach welchen Verfahrensregeln dies geschehen könnte. Man kann insofern von einer »Krise des Krisenmanagements« sprechen (wie ich es vor vierzig Jahren in einem anderen Kontext getan habe[4]). Selbst wenn Einigkeit darüber bestünde, was zu tun ist, so bliebe die zweite und schwierigere Frage unbeantwortet: Wer kann die notwendigen Schritte umsetzen? Das Identifizieren wünschenswerter strategischer Ziele hilft uns wenig, wenn niemand bereit und in der Lage ist, sie anzugehen. Solange wir keine Antwort auf diese Frage haben, befinden wir uns nicht nur in einer Krise – wir stecken in einer Falle. Eine Falle lässt sich als eine Situation definieren, die für jene, die darin gefangen sind, unerträglich ist, während gleichzeitig jeder Rück- oder Ausweg blockiert ist, weil es an den hierzu erforderlichen Kräften und Akteuren fehlt.
Eine Lage, von der wir alle passiv betroffen sind, kann nicht aktiv gestaltet und unter Kontrolle genommen werden, weil es auf europäischer Ebene an einer Instanz fehlt, die mit ausreichender legitimer Macht ausgestattet wäre. Mario Draghi und andere träumen z. B. öffentlich von einem »europäischen Finanzminister« – aber es gibt keinen europäischen Gesetzgeber mit umfassendem Budgetrecht, der befugt wäre, dessen Haushalt zu verabschieden. Die Diskrepanz zwischen der Reichweite von (europaweiten) Kausalketten und der Reichweite national bzw. »intergouvernemental« befangener Kontrollmöglichkeiten betrifft vor allem die Mitglieder der Eurozone: Sie wurden auf der einen Seite geldpolitisch entmachtet, weil sie ihre nationalen Währungen aufgegeben haben; auf der anderen Seite waren sie nach dem Wortlaut der Verträge daran gehindert, die gemeinsame Regierungsfähigkeit und wirtschaftspolitische Gestaltungskapazität aufzubauen, die ihnen erlauben würde, ihre Interdependenz in einer allerseits erträglichen Weise zu regeln und gleichzeitig die Macht der Finanzmärkte zu kontrollieren. Die Eurozone ist heute ein missgebildetes System aus neunzehn Staaten ohne eigene Zentralbank und einer Zentralbank ohne Staat. Soziologisch betrachtet geht der Horizont der »funktionalen« Integration und der Interdependenzen weit über den der »sozialen« Integration und der Beherrschbarkeit durch Akteure hinaus.
Mit dieser Problematik beschäftigt sich dieser Essay, auch wenn die hier entwickelten Lösungen hauptsächlich (wenn auch nicht ausschließlich) negative sind. Ich versuche zu zeigen, dass es eine Reihe von Akteuren gibt, deren Ideen und Ressourcen sich definitiv nicht als aussichtsreiche Krisenlösungen empfehlen. Zu ihnen gehören die EZB, der Europäische Rat, der Rat der Europäischen Union, die deutsche Bundesregierung, renationalisierte Regierungen der Mitgliedsstaaten, die Bewegung der europafeindlichen politischen Parteien und die Technokraten der Europäischen Kommission. Wenn die dramatischen Verhandlungen der Mitglieder der Eurogruppe vom Juli 2015 über die Bewältigung der griechischen Schulden- und Wirtschaftskrise eines überdeutlich demonstriert haben, dann ist es die Unfähigkeit der versammelten Regierungen, Lösungen zu finden, die zugleich effektiv und nachhaltig sind (im Gegensatz zu absehbar kontraproduktiven und kurzlebigen Scheinlösungen) und die zudem von allen Beteiligten als legitim anerkannt werden können (im Gegensatz zu einer unverhohlenen Nötigung eines Mitgliedsstaates durch einen anderen).
Die Tiefe der aktuellen Krise ist einem zentralen Widerspruch geschuldet: Die Dinge, die im Interesse der Stabilisierung von Union und Eurozone dringend angegangen werden müssen, sind innerhalb der Mitgliedsstaaten gleichzeitig in hohem Maße und offenbar zunehmend unpopulär. Das, was zu tun geboten ist (und worüber sich »im Prinzip« alle einig sind, nämlich irgendeine Art der Neuverteilung von Bürden und Zuständigkeiten innerhalb der EU), können die nationalstaatlichen Eliten, sowohl im Zentrum als auch an der Peripherie, ihren Wählern nicht »verkaufen«, d. h. erklären und akzeptabel machen. Schließlich sind die politischen Parteien, die diesen »Verkauf« zu organisieren hätten, nach wie vor wesentlich nationale Machterwerbsorganisationen, die im Geiste eines positivistischen Opportunismus den (vermeintlich) »gegebenen« und unabänderlichen Präferenzen der Wähler folgen, anstatt sich veranlasst zu sehen, diese Präferenzen zu prägen, einen Konsens zu bilden und grenzüberschreitende Vertrauensbeziehungen und Solidaritäten zu schaffen. Politische Parteien (und ebenso die Medien) müssten in der Lage sein, argumentativ Präferenzen zu bilden; dann wären sie imstande, verbreitete Ängste, Verdächtigungen, Anschuldigungen der Verlierer und die Deutung von Konflikten in nationalen Kategorien ein Stück weit zu neutralisieren. Eine verbreitete Einstellung, die politische Parteien eher noch bekräftigt als neutralisiert haben, besteht in einer reflexhaften Verdächtigung: Wenn »wir« für »die anderen« solidarische Opfer bringen, dann werden »die« unsere Großzügigkeit nur ausnutzen, sich selbst nicht weiter anstrengen und sich so auf »unsere« Kosten einen unfairen Vorteil verschaffen. Anders gesagt, die »anderen« werden pauschal nicht nur der mangelnden Leistungsfähigkeit, sondern darüber hinaus der bedenkenlosen Selbstbereicherung bezichtigt – eine bequeme Rahmung bzw. Unterstellung, die sich perfekt eignet zur Abweisung von Solidarpflichten. Die Wirtschaftswissenschaften stellen für diese Rahmung das Theorem des moral hazard zur Verfügung: Hilfe verdirbt den Charakter dessen, dem geholfen wird. Die kognitive Voreingenommenheit des Publikums, die von politischen Parteien noch ermutigt wird, läuft auf den Befund hinaus, dass die Probleme auf dem falschen Verhalten der »anderen« beruhen und sich nicht etwa aus der institutionellen Struktur der Eurozone und der EU ergeben; würde dies anerkannt und vermittelt, dann würden sich die Probleme als Probleme darstellen, die »wir alle« zu bewältigen haben.
Woran es demnach in entscheidender Weise fehlt, ist nicht so sehr Geld wie Konsens und geeignete institutionelle Mechanismen der Konsensbildung und der Mobilisierung politischer Unterstützung. Die Diskrepanz zwischen dem, was aus wirtschaftlicher Sicht notwendig ist, und dem, was politische Akteure strategisch für politisch durchsetzbar halten, führt auf beiden Seiten der sich vertiefenden Spaltung Europas zu der inzwischen viel beschworenen »Unregierbarkeit«. Wenn die Eurozone auseinanderbricht, weil deren Eliten dieses Dilemma nicht lösen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch die gesamte Union scheitern wird. Insofern ist der deutschen Kanzlerin zuzustimmen, wenn sie auch die Tatsache unerwähnt lässt, dass die ungezügelte, außer institutionelle Kontrolle geratene Dynamik der Wirtschafts- und Währungsunion selbst es ist, welche die Gefahr einer europäischen Desintegration heraufbeschwört.
[1] Das gilt selbst dann, wenn man (wie es hier geschieht) die neuen Krisen des Jahres 2015 aus der Betrachtung ausklammert, nämlich die militärischen Konflikte in der Ukraine und in Syrien, die Flüchtlingskrise und die terroristischen Angriffe islamistischer Kämpfer.
[2] Thompson (2012), S. 61; Rachman (2014) berichtet, dass einige Beobachter aufgrund der neuesten Haushalts- und Finanzdaten Griechenlands schon das Ende der Krise feiern, während andere, wie einer von Europas einflussreichsten Politikern, auf die Frage, ob die Krise wirklich zu Ende sei, antwortete: »Nein, es bewegt sich jetzt von der Peripherie ins Zentrum«; dies bedeute, dass »Sorgen um Italien oder sogar Frankreich jetzt größer werden müssten«.
[3] Platzer (2014).
[4] Offe (1976).
I. Demokratischer Kapitalismus und Europäische Union
Fünfundzwanzig Jahre nach dem Ende des Staatssozialismus stellen uns die Geschichte der Integration Europas und der Erweiterung der EU sowie ihre bislang tiefste Krise vor die Aufgabe, neue Antworten auf eine klassische Frage der Soziologie und der politischen Theorie zu finden: Wie verhalten sich politische Demokratie und kapitalistische Marktwirtschaft zueinander? Wodurch wurde das vermeintlich definitive institutionelle Gleichgewicht zwischen beiden Polen, die »soziale« Marktwirtschaft, wie sie das dritte Quartal des 20. Jahrhunderts in Deutschland und anderswo bestimmt hat, erschüttert? Und wie kann dieses Gleichgewicht (wenn überhaupt) auf der supranationalen Ebene der EU, eines historisch beispiellosen politischen Gemeinwesens, wiederhergestellt werden?
Nach dem Ende des Staatssozialismus begann für die EU der (noch nicht abgeschlossene) Prozess der Osterweiterung, bei dem nicht weniger als dreizehn neue Mitglieder (bei denen es sich, abgesehen von anderthalb kleinen Mittelmeerinseln, um postkommunistische Staaten handelt) unter den Schirm der Verträge und den Besitzstand (acquis) gemeinschaftlicher europäischer Rechtsnormen traten. Sechs dieser Länder sind der Eurozone bereits beigetreten, und die anderen haben sich mit ihrem EU-Beitritt dazu verpflichtet, diesen Schritt zu gegebener Zeit zu vollziehen und so die WWU zu komplettieren. Der Übergang von der »Kommandowirtschaft« des Staatssozialismus zur Marktwirtschaft des demokratischen Kapitalismus ist historisch ohne Beispiel. Die binäre begriffliche Gegenüberstellung von Markt versus Staat hat jedoch die fällige Beachtung des generell anzutreffenden Sachverhaltes behindert, der sowohl die postkommunistische Transformation als auch die europäische Integration kennzeichnet: Der Markt als Modus Operandi der kapitalistischen Ökonomie ist einerseits das Gegenteil des Staates und seiner Handlungsweisen; andererseits sind jedoch die Existenz von Märkten selbst und ihre Dynamik das Ergebnis staatlicher Politiken; sie werden durch staatliches Handeln geschaffen und kontinuierlich am Leben erhalten. Nach Hayeks berühmter Unterscheidung basiert die »Kommandowirtschaft« auf dem Prinzip der táxis, also der willkürlichen Einrichtung und zwangsweisen Durchsetzung einer von Menschen geschaffenen gesatzten Ordnung. Den Markt dagegen begreift Hayek als Beispiel für kósmos, eine soziale Ordnung, die absichtslos aus evolutionären Kräften hervorgeht und sich menschlichem Planen (sogar menschlichem Verstehen) entzieht.
Keine Frage: Der binäre Code von táxis und kósmos, Staat und Markt, »künstlicher« und »natürlicher« Ordnung, staatlichem Zwang und Freiheit des Marktes ist seit den siebziger Jahren, d. h. seit die neoliberale Lehre Politik und Wirtschaft(s-wissenschaften) auf beiden Seiten des Atlantiks zu dominieren begann, zu einem hegemonialen gedanklichen Konstrukt geworden. Doch die beiden genannten Fälle – die politisch-ökonomische Transformation nach dem Ende des Staatssozialismus und die europäische Integration – können eindeutig als empirische Belege dafür gelten, dass Märkte nichts anderes sind als Ergebnisse von mittels Staatsgewalt durchgesetzten politischen Entscheidungen – und nicht Resultate einer angeblichen »natürlichen« Evolution oder »normaler« Bedingungen. Wie andere Institutionen der kapitalistischen Gesellschaft werden Märkte von angebbaren Akteuren zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten geschaffen, lizensiert und in ihrem Bestand gesichert. Sie sind daher nicht weniger politisch »veranstaltet«, als es die Wirtschaftspläne im Staatssozialismus und anderen autoritären Regimes sind, keine irgendwie »natürliche« Gegebenheiten. Wenn man sich einmal auf diese Perspektive einlässt, dann ergibt sich die Notwendigkeit, das Hayek'sche begriffliche Gerüst umzubauen und komplexer anzulegen. Das möchte ich in aller Kürze mit den folgenden vier Punkten tun.
Erstens muss der Unterschied zwischen den beiden Arten des politisch-ökonomischen Regimes von Gesellschaften anders bestimmt werden. Der klassischen libertären Lehre zufolge betreibt ein staatssozialistisches Regime (für Hayek der Inbegriff von táxis) seine Ökonomie mit den Mitteln des Kollektiveigentums, der Planung, des Befehls, der hierarchischen Kontrolle und im Namen eines spezifischen Konzepts sozialer Gerechtigkeit, das durch präskriptive Regeln und Handlungsgebote eingelöst wird. Demgegenüber betreiben kapitalistische Staaten ihre Wirtschaft, indem die spontane Selbstkoordination rational-interessengeleiteter Eigentümer über Preismechanismen lizensiert wird, d. h., indem Marktteilnehmern durch Verbotsregeln, die negative rechtliche Pflichten festlegen, durch staatliches Eigentums- und Vertragsrecht der Handlungsspielraum zur Verfügung gestellt wird, ihren Interessen entsprechend über die Ressourcen frei zu verfügen, die sie rechtmäßig besitzen, und in staatlich beaufsichtigten Wettbewerb mit anderen zu treten, die ebenso handeln.
Kapitalistische Marktwirtschaften sind das Resultat eines erfolgreichen politischen Projekts einer (»kapitalistischen«) Staatsgewalt und der sie tragenden sozialen Kräfte.[1] Das Projekt besteht darin, die Wirtschaft mit den Organisationsmitteln der Eigentums- und Vertragsfreiheit zu steuern und damit der privaten Interessenverfolgung freien Lauf zu lassen. Dabei ist die »Spontanität« des ungeplanten Marktgeschehens etwas, das selbst institutionalisiert und zudem lizensiert, reguliert und politisch in Bewegung gesetzt wird, ebenso wie der Planungsapparat einer Staatspartei und ihre zwangsförmige Disposition über die wirtschaftlichen Ressourcen einer Nation politisch veranstaltet sind. Die konstitutive Rolle politischer Gewalten für eine kapitalistische Marktwirtschaft wird evident, wenn wir uns klarmachen, dass, bevor die erste Markttransaktion zwischen einem Käufer und einem Verkäufer stattfinden kann, bereits ein Staat existierten muss, der (zumindest) drei Dinge verbürgt: Eigentumsrechte, Vertragsrechte (mitsamt den Einrichtungen zu ihrer gerichtlichen Durchsetzung) sowie eine Währung als »gesetzliches Zahlungsmittel«, das es den Marktteilnehmern erst erlaubt, miteinander in Austausch zu treten. Nichts davon kann allein durch Verbotsregeln etabliert werden.
Generell ist das Handeln von »freien«, ihre Interessen verfolgenden Marktteilnehmern von politischen Programmen und gesetzlichen Normen lizensiert, mandatiert, reguliert, gefördert, garantiert, subventioniert, abgesichert, juristisch formalisiert etc. Dasselbe trifft auf die Erwerbsgelegenheiten zu, die durch marktrelevantes staatliches Handeln eröffnet werden, z. B. durch Handelspolitik, die Bereitstellung und Instandhaltung der Infrastruktur, Bau- und Flächennutzungspläne, Schulen, Forschungseinrichtungen, Gerichte und vieles mehr.[2] Die kapitalistische Marktwirtschaft ist eine politische Ökonomie, ein staatlich institutionalisiertes Arrangement von Erwerbsinteraktionen. Wie Karl Polanyi gezeigt hat,[3] ist kósmos im Sinne von Hayek nicht das Gegenteil, sondern ein bloßer Sonderfall von táxis – eine Ordnung, in der die Staatsgewalt die Freiheit von Eigentümern auf das Wirtschaftsleben loslässt und nicht die Macht von Planungsbürokraten.
Mein zweiter Punkt ist, dass der Marktwettbewerb, wie schon Adam Smith wusste, stets die Tendenz aufweist, sich selbst zu untergraben. Da Wettbewerb immer Verlierer erzeugt und die Profitchancen der Gewinner limitiert, gibt es ein beständiges Interesse der Marktteilnehmer auf der Angebotsseite, solche widrigen Wirkungen des Wettbewerbs durch Kartell- und Monopolbildung abzuschwächen. Zudem sind sie bestrebt zu verhindern, dass potentielle Konkurrenten Zugang zum Markt erhalten, oder sie greifen im Konkurrenzkampf auf Methoden zurück, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die nicht zu den beiden einzig legitimen gehören – nämlich niedrigere Preise oder bessere Qualität bzw. Neuigkeit der angebotenen Leistungen. Zu den weniger legitimen Mitteln des »Wettbewerbs« gehören demnach die Anwendung oder Androhung von individueller oder kollektiver (einschließlich militärischer) Gewalt, Lobbyarbeit für Subventionen und protektionistische Handelsbeschränkungen usw., also Strategien, die nicht zu den beiden »zivilisierten« und effizienzsteigernden Methoden des Konkurrenzkampfes zählen. Weiterhin können Marktteilnehmer bestrebt sein, sich (vermeintlich) »kostenlose« Güter, die vom Staat bereitgestellt werden (wie öffentliche Infrastruktur oder subventionierte Faktorleistungen), anzueignen und die sozialen Kosten der Produktion für den Markt (Umweltschäden, Beschäftigungsrisiken usw.) zu externalisieren, d. h. auf nicht kompensierte Dritte abzuwälzen. Bekanntlich erzeugen Markttransaktionen negative Externalitäten, die anderen aufgebürdet werden, ohne dass diese dafür kompensiert würden. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn ein Markt dauerhaft einen unverfälschten Wettbewerb realisieren soll, dann muss er kontinuierlich von staatlicher Seite (z. B. von Monopolbehörden) überwacht und bei Abweichungen korrigiert werden. Es ist eine ständige Aufgabe aller Ebenen der staatlichen Politik, nicht zuletzt des Wettbewerbskommissars der Europäischen Kommission, wettbewerbsbeschränkende und -verfälschende Strategien von im Konkurrenzkampf stehenden Anbietern überwachend und korrigierend zu verfolgen. Dabei ergibt sich für staatliche Akteure typischerweise das Dilemma, dass eine allzu rigorose Bekämpfung wettbewerbswidriger Praktiken Investoren abschrecken und damit die Steuerbasis dezimieren, Beschäftigungschancen schmälern und Wählerstimmen kosten kann. Die reale Wettbewerbsintensität hinge demnach davon ab, wie die staatliche Politik dieses Dilemma jeweils löst. Märkte sind jedenfalls keineswegs autarke und sich selbst erhaltende, sondern extrem fragile Gebilde, die durch die staatliche Wirtschaftspolitik am Leben erhalten, gepflegt und kontrolliert werden müssen und sich andernfalls selbst abschaffen.
Die dritte Eigenschaft des Modells der kapitalistischen politischen Ökonomie, das ich in diesem Essay verwende, ist die Tatsache, dass Investoren und Arbeitgeber, also die Hauptakteure und Initiatoren eines Großteils wirtschaftlicher Aktivitäten in kapitalistischen Gesellschaften, nicht nur andauernd den Wettbewerb, sondern auch, in scheinbar paradoxer Weise, jenen politisch-institutionellen Ordnungsrahmen einschließlich des Wohlfahrtsstaates und der Sozialpolitik untergraben und mit den Mitteln ihrer Verbandsmacht bekämpfen, der einen relativ reibungslosen Verlauf der Marktwirtschaft erst ermöglicht und diese am Leben erhält.[4] Obwohl sie in ihrer Gesamtheit auf den Staat als eine Art Meta-Manager des Wettbewerbs und als Organisator funktionierender Märkte angewiesen sind, lehnen individuelle Investoren und Arbeitgeber staatliche Eingriffe typischerweise als interventionistische »Übergriffe« staatlicher Politik vehement ab. Die Repräsentanten von privaten Investoren und Arbeitgebern sind, ermutigt durch neoliberale Ideologen, beständig darauf bedacht, die Märkte gegen »exzessive« Eingriffe seitens des Staates und demokratischer Politik abzuschirmen. Sie beklagen in der Regel zwei angeblich »kontraproduktive« und »ineffiziente« Methoden, durch die staatliche Akteure die Marktkräfte stören und verzerren: überhöhte Belastung durch Steuern und Abgaben sowie übermäßige Regulierung. Vereinfacht gesagt: Anstatt den Staat und seine Aktivitäten, die den Markt sowohl ermöglichen wie seine zerstörerischen Potentiale einhegen, als eine Art »geschäftsführenden Ausschuss« im Dienste ihrer kollektiven Interessen zu würdigen und anzuerkennen, begegnen Vertreter des Kapitals ihm mit Argwohn und bekämpfen seine gesetzgeberischen Aktivitäten oftmals mit ihren eigenen politischen Mitteln.
Hier komme ich zur vierten Komponente meiner knappen und allzu schematischen Darstellung meines Modells des demokratischen Kapitalismus in der EU. Innerhalb der Grenzen des Nationalstaates und seines demokratischen Gemeinwesens sind die Möglichkeiten für Investoren und Arbeitgeber, Besteuerungen und Regulierungen zu umgehen, die sie als ihren Interessen zuwiderlaufend ansehen, relativ beschränkt. Demokratie und Sozialstaat sind historisch das Ergebnis eines Klassenkompromisses, dessen Bedingungen innerhalb des nationalstaatlichen Rahmens auch für die Kapitalseite einzuhalten sind. Auf der Ebene des europäischen Binnenmarktes dagegen kann sich das Kapital unerwünschter steuerlicher Belastungen und mitgliedsstaatlicher politischer Regulierung sehr viel leichter entziehen. Dort gelten nicht nur die durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union garantierten vier ökonomischen Grundfreiheiten (freier Warenverkehr, Personenfreizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit, freier Kapital- und Zahlungsverkehr) und ein System von Regulierungen, an das sich wirtschaftliche Akteure in den Mitgliedsstaaten halten müssen, sondern es gibt auch (wenn auch einstweilen nur in der Eurozone) eine gemeinsame Währung. Dank des EU-Binnenmarktes können Unternehmen und Investoren sehr viel besser wirtschaftliche Macht dadurch ausüben, dass sie mit Abwanderung an einen anderen Investitions- und Beschäftigungsstandort (exit) drohen und damit einen fiskalischen und regulatorischen Unterbietungswettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten anregen; denn diese sind aus internen fiskalischen und beschäftigungspolitischen Gründen in der Regel bestrebt und darauf angewiesen, solcher Abwanderung nach Kräften vorzubeugen. Die Abwanderungsoption, wie sie vom Binnenmarkt geboten wird, macht den Gebrauch von eigentlich politischen Machtmitteln, die auf Widerspruch (voice) beruhen – die Machtausübung durch Verhandlungen, durch Versprechungen, Drohungen, Warnungen, Forderungen, Kampagnen usw. –, großenteils entbehrlich. Das Kapital argumentiert nicht; es geht stumm seiner Wege.
Aus Sicht großer Investoren (wenn auch nicht aller, siehe unten) und marktliberaler Politiker bietet die europaweite Wirtschaftszone vier Vorteile gegenüber einer Wirtschaft, die innerhalb nationalstaatlicher Grenzen operieren muss:
(a) Aufgrund positiver Skaleneffekte, die sich durch den vergrößerten Markt und niedrigere Transaktionskosten einstellen, ist mit Wettbewerbsvorteilen zu rechnen.
(b) Wenn auch die EU in großem Umfang regulative Politik betreibt, die sich auf Zehntausenden von Seiten von Rechtsvorschriften zur Produktstandardisierung und zum Schutz von Arbeitnehmern, Verbrauchern und Umweltgütern niedergeschlagen hat, so ist doch aus der Sicht von Investoren die Einheitlichkeit der Regulierung, die alle Anbieter eines bestimmten Produkts im EU-Europa denselben Regeln unterwirft und abweichende nationale Regulierungen aufhebt, von großem Interesse für Investoren – jedenfalls für diejenigen, die ohne nationalstaatliche Protektion und Förderung auskommen. Der EU-weite Markt ist damit zwar nicht dereguliert, aber der Modus der Regulierung ist entpolitisiert, d. h. gegen demokratische Interventionen nationalstaatlicher Politik abgeschirmt.
(c) Da die EU kein demokratisches Gebilde mit gewählter und rechenschaftspflichtiger Regierung und parlamentarischer Haushaltshoheit ist, sind die Mitgliedsstaaten in ihrer Souveränität erheblich eingeschränkt. Wichtige Materien der Regulierung und der Wirtschaftspolitik befinden sich außerhalb der Reichweite mitgliedsstaatlicher politischer Einflussnahme. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Regeln und Programme, die auf der supranationalen Ebene initiiert werden, im Gegensatz zu wirtschaftlichen Interessen von Investoren stehen.
(d) Aufgrund der offenen Grenzen innerhalb der EU, welche die Mobilität von Kapital, Arbeitnehmern, Dienstleistungen und Gütern gewährleisten, wird die politische Rivalität zwischen den Mitgliedsstaaten institutionalisiert. Die Mitgliedsstaaten, insbesondere auch ihre Gewerkschaften und ihre linken Volksparteien, sind mit der ständigen Warnung konfrontiert, nichts zu unternehmen und alles zu unterlassen, was durch fiskalische Lasten, Entwicklung der Arbeitskosten und Niveau der Sozialausgaben ihre Standortattraktivität beeinträchtigen oder auch die Zuwanderung von Personen mit geringen Arbeitsmarktchancen ermutigen könnte.