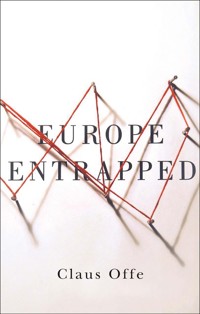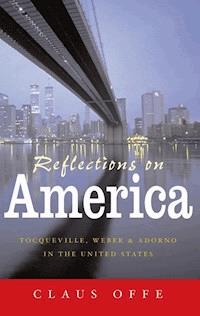Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Kritik
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Während sich in den letzten drei Jahrzehnten im Rest der Welt mehr Menschen als je zuvor an demokratischen Wahlen beteiligten, hat in vielen europäischen Ländern die Mehrheit der Bevölkerung den Glauben daran verloren, mit ihrer Stimme etwas bewirken zu können. Hier sinkt die Wahlbeteiligung seit langem, vor allem bei den Unterschichten - eine Entwicklung, die den Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet. Die Beiträge in diesem Heft beschäftigen sich mit der gegenwärtigen Malaise der Demokratie, sie versuchen, Diagnosen zu stellen und machen Therapievorschläge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Transit wird herausgegeben am Institut für die Wissenschaften vom Menschen
(IWM) in Wien und erscheint im Verlag Neue Kritik, Frankfurt am Main
Gründungsherausgeber: Krzysztof Michalski †
Redaktion: Klaus Nellen (Wien)
Mitherausgeber dieses Heftes: Ivan Krastev (Wien/Sofia)
Redaktionskomitee: Cornelia Klinger (Wien), János M. Kovács (Budapest/Wien), Ivan Krastev (Sofia/Wien), Timothy Snyder (Yale/Wien).
Beirat: Peter Demetz (New Haven), Timothy Garton Ash (Oxford), Elemer Hankiss (Budapest), Claus Leggewie (Essen), Petr Pithart (Prag), Jacques Rupnik (Paris), Aleksander Smolar (Warschau/Paris), Fritz Stern (New York).
Redaktionsanschrift: Transit c/o IWM, Spittelauer Lände 3, A-1090 Wien, Telefon (+431) 31358-0, Fax (+431) 31358-60, www.iwm.at
Website von Transit: Europäische Revue und Tr@nsit_online:www.iwm.at/transit
Anzeigenpreisliste wird auf Wunsch zugesandt.
Transiterscheint zweimal im Jahr. Jedes Heft kostet 14 Euro (D). Transit kann
im Abonnement zu 12 Euro (D) pro Heft (in D und A portofrei) über den Verlag bezogen werden.
Verlagsanschrift: Verlag Neue Kritik, Kettenhofweg 53, D-60325 Frankfurt/
Main, Telefon (069) 72 75 76, Fax (069) 72 65 85, E-mail: [email protected]
Textnachweise: Der Beitrag von Ivan Krastev basiert auf seinem Buch In Mistrust We Trust: Can Democracy Survive When We Don’t Trust Our Leaders? (TED Conferences 2013). Krzysztof Michalskis Bemerkungen erschienen zuerst in der Silvesterausgabe 2011 der Gazeta Wyborcza. Der Artikel von Pierre Rosanvallon geht auf die Jan Patoâka-Gedächtnisvorlesung zurück, die der Autor unter dem Titel »Rethinking Equality in an Age of Inequalities« am 24. November 2011 in Wien gehalten hat. Der Beitrag von Jacques Rupnik erschien zuerst unter dem Titel »How things went wrong« im Rahmen des Schwerpunkts »Hungary’s Illiberal Turn« im Journal of Democracy (Bd. 23, Nr. 3, 2012). Peter Pomerantsev war im Februar 2013 Gast im Rahmen des Russia in Global Dialogue-Programms des IWM; wir danken Open Society Foundations für ihre Unterstützung.
ISSN 0938
Transit ist Partner von Eurozine – the netmagazine (www.eurozine.com), einem Zusammenschluss europäischer Kulturzeitschriften im Internet. Transit is regularly listed in the International Current Awareness Services. Selected material is indexed in the International Bibliography of the Social Sciences.
© 2013 für sämtliche Texte und deren Übersetzungen Transit / IWM
Die Printausgabe erschien 2013 im Verlag Neue Kritik
E-Book-Ausgaben 2014:
ISBN 978-3-8015-0520-2 (epub)
ISBN 978-3-8015-0521-9 (mobi)
ISBN 978-3-8015-0522-6 (pdf)
Transit 44 (Herbst 2013)
Zukunft der Demokratie
(Mitherausgeber: Ivan Krastev)
Editorial
Ivan Krastev
Der Transparenzwahn
Nadia Urbinati
Zwischen Anerkennung und Misstrauen
Repräsentative Demokratie im Zeitalter des Internets
Claus Offe
Zweieinhalb Theorien über den demokratischen Kapitalismus
Sighard Neckel
Die Ordnung des Finanzmarktkapitalismus
Gesellschaftskritik und paradoxe Modernisierung
Jan-Werner Müller
Anläufe zu einer politischen Theorie des Populismus
Claus Leggewie und Patrizia Nanz
Neue Formen der demokratischen Teilhabe – am Beispiel der Zukunftsräte
Pierre Rosanvallon
Gleichheit im Zeitalter der Ungleichheit
Michael Sandel
Solidarität
Krzysztof Michalski
Patriotismus
Stefan Auer
Das Ende des europäischen Traums
Jiří Pehe
Tschechien: Vom Kommunismus zur Demokratie ohne Demokraten
Jacques Rupnik
Ungarns illiberale Wende
Nilüfer Göle
Gezi Park und die Politik des öffentlichen Raums
Peter Pomerantsev
Risse in der Kreml-Matrix
Postmoderne Diktatur und Opposition in Russland
Zu den Autorinnen und Autoren
Editorial
Das erste Heft der vorliegenden Zeitschrift erschien kurz nach der Wende von 1989 mit dem Titel »Osteuropa – Übergänge zur Demokratie?«. Das Fragezeichen signalisierte eine doppelte Skepsis gegenüber dem damals weit verbreiteten Wunschbild einer »Rückkehr nach Europa«: Würde ihre wiedergewonnene Freiheit die Gesellschaften Osteuropas auf diesen Weg führen? Und was wäre das Ziel, wenn doch »Europa« sich selbst in einer kritischen Übergangszeit befindet?1 Diese Fragen sollten das Institut, an dem Transit erscheint, bis heute beschäftigen.2
Bald nach 1989 wurde klar, dass die Vorstellung vom rückständigen »anderen Europa«, das zum »fortgeschrittenen« Westen aufschließt, nicht halten würde. Die Globalisierung, die Erweiterung der EU und die Wende selbst stellten das angestrebte Modell der modernen Gesellschaft als solches in Frage. Was zunächst wie die Antwort aussah, wurde zur Frage. Aus dem Übergang zur Demokratie wurde die Transformation der Demokratie, die die »östlichen« wie die »westlichen« Gesellschaften gleichermaßen betrifft.
Kaum jemand hatte vor 1989 den Zusammenbruch des Sowjetimperiums vorausgesehen und kaum jemand hatte in der euphorischen Zeit danach genug Phantasie, sich die Krise vorzustellen, die zwei Jahrzehnte später den ganzen Kontinent ergreifen würde – eine Krise, die auch an den Kern der Demokratie rührt.
Doch ist die Rede von der Krise der Demokratie nicht so alt wie diese selbst? Und müssen wir uns vor den Feinden der Demokratie fürchten, wenn das Modell doch unumstritten ist und überzeugende Alternativen nirgendwo in Sicht sind? Warum aber leiden dann die politischen Institutionen westlicher Demokratien – Parteien, Wahlen, Parlamente, Regierungen – unter einem so rasanten Vertrauensverlust? Während sich in den letzten drei Jahrzehnten im Rest der Welt mehr Menschen als je zuvor an demokratischen Wahlen beteiligten, hat in vielen europäischen Ländern die Mehrheit der Bevölkerung den Glauben daran verloren, mit ihrer Stimme etwas bewirken zu können. Hier sinkt die Wahlbeteiligung seit langem, vor allem bei den Unterschichten – eine Entwicklung, die den Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet. Die Beiträge in diesem Heft beschäftigen sich mit der gegenwärtigen Malaise der Demokratie, sie versuchen, Diagnosen zu stellen und machen Therapievorschläge.
Die Enttäuschung über die Demokratie und der Vertrauensverlust in die politische Elite haben allenthalben eine Euphorie für mehr Transparenz ausgelöst. Mehr Transparenz wird freilich kaum den Machtverlust der Wähler kompensieren und ist auch keine Alternative zu Demokratien ohne reale Wahlmöglichkeiten, vielmehr dient sie zu deren Rechtfertigung, meint Ivan Krastev in seinem einleitenden Essay. Nadia Urbinati untersucht das Paradox der allgemeinen Anerkennung der Demokratie bei gleichzeitigem Misstrauen gegenüber ihrer Praxis, das sich heute in heftigen Protesten auf der Straße und in der Abkehr von traditionellen Formen der Partizipation ausdrückt. Sie sieht darin keinen Verfall der Demokratie, sondern eine Metamorphose, deren Ende offen ist.
Die Regierungen haben die Oberhoheit über die Steuer- und Haushaltspolitik verloren; stattdessen werden sie von den Finanzmärkten getrieben. Als Folge erscheint immer mehr Bürgern demokratische Teilhabe als zwecklose Übung. Was also tun, wenn sich die wesentlichen Entscheidungen in Bereiche verlagern, die außerhalb der konventionellen demokratischen Politik liegen? Was uns fehlt, beklagt Claus Offe, ist eine Theorie, die der neuen Präponderanz der Märkte über soziale Rechte und öffentliche Politik Rechnung trägt. Auch Sighard Neckel konstatiert die Entstehung eines neuen Typs von Kapitalismus. Man könnte meinen, dieser stelle einen Rückfall in vordemokratische Zeiten dar. In Wahrheit handelt es sich um einen paradoxen ökonomischen Modernisierungsprozess in Gestalt einer »Refeudalisierung«.
Um die Demokratie besser gegen populistische Angriffe wie derzeit in Ungarn zu schützen, muss man sich zum einen von hartnäckigen Stereotypen über den Populismus verabschieden und zum anderen sowohl die theoretischen Schwächen unserer Vorstellungen von Demokratie beheben als auch die wunden Punkte der real existierenden Demokratien in Europa bloßlegen. Dafür bietet Jan Werner Müller Bausteine zu einerpolitischen Theorie des Populismus. Dieser profitiert von dem Argwohn der Bürger gegenüber den herkömmlichen Formen politischer Teilhabe. Zugleich hat sich aber auch eine Vielfalt neuer Partizipationsformen herausgebildet. Bürgerbeteiligung ist keine Modeerscheinung, sondern Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels, meinen Claus Leggewie und Patrizia Nanz. Allerdings stellen uns Probleme wie etwa die Energiewende vor neue Herausforderungen. Helfen könnte hier die Einrichtung von »Zukunftsräten«. Sie würden dialogorientierte Agendabildung betreiben, einen kollektiven Lernprozess ermöglichen und als Konsultative für die Politik fungieren.
Seit den 1980er Jahren erleben wir die Umkehrung einer Anfang des 20. Jahrhunderts einsetzenden Entwicklung zu mehr Gerechtigkeit: Wir leben in einer Zeit der Konterrevolution, in der die Idee der Gleichheit der Logik des Marktes geopfert wurde, schreibt Pierre Rosanvallon. Was wir brauchen, ist ein neues Modell der Solidarität und eine neue, universale Definition von Gleichheit – als demokratische Qualität und nicht nur als Maß der Wohlstandsverteilung. Mit dem Niedergang der Idee der Solidarität3 beschäftigt sich auch Michael Sandel. Was bleibt von der Tradition der Solidarität in einer Zeit, in der der Markt sie als Organisationsprinzip der Gesellschaft abgelöst hat, aber offensichtlich deren Zusammenhalt untergräbt? Ist Solidarität als moralisches und zivilgesellschaftliches Ideal heute noch tragfähig? Krzysztof Michalskis Notizen zum Patriotismus, ursprünglich für die Gazeta Wyborcza geschrieben, thematisieren, ähnlich wie Sandel hinsichtlich der Solidarität, die Gefahr des Partikularismus: Patriotismus als Bindung an eine lokale Gemeinschaft kann seine Aufgabe nur erfüllen, wenn er auch eine universale Dimension erhält – heute vielleicht durch Einbindung in das europäische Projekt.
So, wie dieses Projekt heute Gestalt angenommen hat, scheint es aber gerade diese Funktion nicht zu erfüllen. Der europäische Traum war es, die Effizienz der kapitalistischen Marktwirtschaft mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden. Heute steht die Europäische Union hinsichtlich beider Elemente ziemlich angeschlagen da. Stefan Auer analysiert die gegenwärtigen politischen und intellektuellen Anstrengungen, das Projekt zu retten, und lässt uns wenig Hoffnung.
Am Ende des Heftes stehen Momentaufnahmen zur Krise der Demokratie in vier Ländern: in der Tschechischen Republik, in Ungarn, der Türkei und in Russland. Jiří Pehe erinnert an Masaryks Ausspruch von 1918: »Nun haben wir eine Demokratie, was wir noch brauchen, sind Demokraten.« Die lassen auch mehr als zwanzig Jahre nach der »Samtenen Revolution« noch auf sich warten. »Sowohl die Politiker als auch die Regierten in den Ländern, die sich 1989 auf den Weg in die Demokratie gemacht haben,« schreibt Pehe, »scheinen sich nicht länger sicher, worin das Ziel eigentlich besteht.« Jacques Rupnik versucht, die illiberale Wende zu erklären, die Ungarn, lange ein Musterschüler unter den Beitrittsländern, heute vollzieht – in einer Zeit, in der sich die Europäische Union in einer tiefen Krise befindet. Ist Orbáns Ungarn Symptom dieser Krise oder ist es Teil einer breiteren Tendenz zum Autoritarismus, die den östlichen Teil des Kontinents bis hin zur Ukraine, zu Weißrussland und Russland befallen hat? Nilüfer Göle berichtet über die vielfältigen Protestformen der Gezi Park-Bewegung, die uns einen empirischen Schlüssel für die Erkundung der weltweit zu beobachtenden neuen Formen öffentlichen politischen Handelns liefert. Mit der Phantasie der Protestierenden können die »Polittechnologen« des Kreml durchaus konkurrieren, wie Peter Pomerantsev zeigt. Ihr Repertoire, perfekte Demokratie zu simulieren, um echte Demokratie zu verhindern, scheint unerschöpflich. Doch die russische Matrix zeigt in letzter Zeit zunehmend Risse.
Ergänzende Artikel zur Thematik dieses Heftes finden sich auf der Transit-website: www.iwm.at/transit
Wien, im August 2013
1Transit: Europäische Revue, Nr. 1 (Herbst 1990), Editorial, S. 5-9.
2Seit 2011 ist die »Frage der Demokratie« Gegenstand systematischer Forschung am IWM, siehe www.iwm.at/research/focus-iii-democracy-in-question. Der Forschungsschwerpunkt wird geleitet von dem bulgarischen Politologen Ivan Krastev, Mitherausgeber dieses Heftes.
3Mit dieser Idee beschäftigt sich das IWM seit vielen Jahren. Im April 2013 fand in Wien die achte Konferenz zur Frage der Solidarität statt: On Solidarity VIII: Inequality and Social Solidarity. Ausgewählte Beiträge aus dieser Reihe sind in Transit erschienen.
Ivan Krastev
DER TRANSPARENZWAHN
Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten.
Johann Wolfgang Goethe
Ein bekannter französischer Kupferstich von 1848, dem Jahr, in dem die Franzosen das allgemeine Wahlrecht erhielten, bringt die Dilemmata der europäischen Demokratien in ihrer Geburtsstunde auf den Punkt: Er zeigt einen Arbeiter mit einer Flinte in der einen und einem Stimmzettel in der anderen Hand. Die Botschaft ist unmissverständlich: Kugeln für die Feinde der Nation, Wählerstimmen für (oder besser gegen) den Klassenfeind. Wahlen waren als Instrument für Inklusion und Nationwerdung gedacht. Die Arbeiterschaft sollte in die Nation integriert werden, indem man sie durch Wahlen an der politischen Macht teilhaben ließ.
Der Mann mit der Flinte und dem Stimmzettel symbolisiert die Ankunft der Demokratie in Frankreich, ist er doch zugleich Franzose und Arbeiter, Vertreter der Nation und Angehöriger einer Klasse. Ihm ist klar, dass der Mensch, der an einer der Barrikaden neben ihm stehen würde, ebenfalls Franzose und Arbeiter sein und genau wissen würde, wo der Feind steht. Seine Flinte ist nicht nur Symbol seiner konstitutionellen Rechte, sondern auch ein Beweisstück dafür, dass der neue demokratische Citoyen bereit ist, sowohl sein Vaterland als auch seine Klasseninteressen zu verteidigen. Er weiß, dass die Macht seines Stimmzettels nicht zuletzt von der Feuerkraft seiner Waffe abhängt. Der Zettel ist eine zusätzliche Waffe, weil Wahlen eine zivilisierte Form des Bürgerkriegs darstellen. Sie sind nicht bloß ein Mechanismus zur Herbeiführung eines Regierungswechsels. Sie sind ein Werkzeug für die Neuordnung der Welt.
Das heute allgegenwärtige Smartphone ist keine Feuerwaffe, eignet sich aber für Schüsse anderer Art. Man kann damit Machtmissbrauch dokumentieren und ihn öffentlich machen; es kann Menschen miteinander verbinden und ihnen so Macht verleihen; es kann helfen, die Wahrheit zu verbreiten. Dass die jüngste Welle von Massenprotesten gegen autoritäre Regime in aller Welt zeitlich mit der Verbreitung von Smartphones zusammenfällt, dürfte wohl kaum ein Zufall sein. Unverfängliche Fotos, in sozia-len Netzwerken gepostet, haben politische Skandale ins Rollen gebracht. In China gehören »Bruder Uhr« und »Onkel Haus« zu den jüngsten Opfern mit Smartphones bewaffneter Bürgern. Beide sind subalterne Staatsbeamte, die in der ersten Jahreshälfte 2013 durch Internet-Kampagnen als Empfänger von Bestechungsgeldern angeprangert wurden. »Bruder Uhr« trug auf mehreren ins Web gestellten Schnappschüssen sehr teure Armbanduhren, von denen einige mehr kosten, als er in einem Jahr verdient. »Onkel Haus«, Leiter eines Stadtentwicklungsbüros im südchinesischen Bezirk Guangzhou, wurde als Eigentümer von 22 Immobilien enttarnt. Die Smartphone-Community schoss beide ab. In Russland nahm das Ansehen der russisch-orthodoxen Kirche Schaden, als Blogger verbreiteten, dass ein von der Pressestelle des Patriarchen Kyrill veröffentlichtes Foto von einem Treffen mit dem russischen Justizminister manipuliert war: Die teure Armbanduhr des Geistlichen war wegretuschiert worden, jedoch nicht ihre Spiegelung auf dem polierten Tisch, an dem die beiden saßen. In Syrien dokumentierten Bürger mit ihren Smartphones die abscheulichen Verbrechen des Regimes. Und in den Vereinigten Staaten überlieferten mit einem Smartphone gemachte Aufnahmen die berüchtigte Bemerkung des Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney über die »47 Prozent«, die große Teile der amerikanischen Öffentlichkeit empörten (und hoffentlich auch einen Teil der gemeinten 47 Prozent).
Ein Smartphone kann übrigens auch von jedermann als Lügendetektor benutzt werden. So kann ein Wähler alle erdenklichen Behauptungen von Politikern im Nu überprüfen – von den gewichtigsten politischen Fragen bis hin zu trivialen persönlichen Anekdoten. Als Paul Ryan, einer der Präsidentschaftsbewerber der Republikaner, die Zeit, die er in seinem ersten Marathonlauf erreicht hatte, »versehentlich« falsch erinnerte – er behauptete, er sei das Rennen in unter drei Stunden gelaufen, während es in Wirklichkeit über vier Stunden gewesen waren –, entzündete sich an seinem »Irrtum« sogleich die Frage nach seiner allgemeinen Glaubwürdigkeit. Es ist nicht so, dass Politiker die Leute nicht mehr zum Narren halten könnten, aber sie tun es heute mit dem stark erhöhten Risiko, sich selbst zum Narren zu machen. Der intensive Gebrauch und immense Einfluss von Websites, die helfen, Fakten zu überprüfen, im zurückliegenden US-Präsidentschaftswahlkampf illustriert schlagend den Anspruch der neuen Medien, die Wahrheit zutage zu fördern.
Das Smartphone versetzt die Bürger auch in die Lage, ihre Ansichten und Meinungen kundzutun. Sie können ihre Meinung telefonisch, per E-Mail und auf Twitter absetzen und somit in Echtzeit an einer breiten politischen Diskussion teilnehmen. Jede der drei Debatten zwischen den beiden Kandidaten bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl im November 2012 generierte über sieben Millionen Tweets allein während der Dauer der Debatte. Das Leben mag im Twitter-Zeitalter nicht intelligenter sein, auf jeden Fall ist es unterhaltsamer.
Am wichtigsten ist jedoch vielleicht, dass die Bürger heute ihr Smartphone einsetzen können, um öffentliches Handeln in Gang zu setzen, um ihre Mitbürger zu mobilisieren, gemeinsam auf die Straße zu gehen und kollektiv ihre Interessen geltend zu machen. Der arabische Frühling demonstrierte, dass Smartphone-Power die Bürger sogar in die Lage versetzt, Tyrannen zu stürzen und Geschichte zu schreiben. Smartphones können niemanden töten oder verstümmeln, aber sie machen es für den Staat riskanter, diese Dinge zu tun. Zugleich zeigte der arabische Frühling aber auch die Grenzen der Macht dieser neuen Waffe auf. Der Nutzer oder die Nutzerin wissen nie, wer auf ihre oder seine Aufrufe zu politischer Aktion antworten wird. Er oder sie haben ihre Facebook-Freunde, aber es fehlt ihnen an einer echten politischen Gemeinschaft und politischen Führern. Eine Revolution kann man vielleicht herbeitwittern, den darauffolgenden Umbau der Gesellschaft sicher nicht. Es waren islamistische Parteien mit ihren traditionellen organisatorischen Strukturen und klar formulierten Ideologien, welche die Wahlen nach den vollzogenen Umstürzen im arabischen Raum für sich entschieden.
Heute ist es die Figur mit dem Smartphone in der einen und dem Stimmzettel in der anderen Hand, die die aktuelle Verfassung unserer Demokratie symbolisiert. Diese Figur ist nicht als Mitglied einer Klasse oder ethnischen Gruppe erkennbar, und der Stimmzettel ist keine Macht verleihende Waffe mehr. Barrikaden kommen in unseren politischen Phantasien nicht mehr vor, und wir haben allenfalls eine vage Vorstellung davon, wer unsere »Genossen« und wer unsere Feinde sind. Sowohl der Stimmzettel als auch das Smartphone sind Instrumente der Steuerung, nicht Instrumente der Entscheidung. Die aktuelle Angst des Smartphone-Nutzers und Wählers ist die, dass die Politiker, denen er seine Stimme gibt, nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Der Smartphone-Bürger sucht nicht die großen ideologischen Herausforderungen, vor die seine Vorgänger sich gestellt sahen. Während sich für den Bürger als Verbraucher die Wahlmöglichkeiten in den zurückliegenden Jahrzehnten enorm vermehrt haben, gilt in der Politik das Umgekehrte: Für den politisch engagierten Staatsbürger von gestern war das Überwechseln von einem politischen Lager in ein anderes so undenkbar wie ein Übertritt zu einer anderen Religion. Wenn sich heute jemand politisch von links nach rechts bewegt, ist das so leicht wie der Grenzübertritt von Deutschland nach Frankreich – auf der Autobahn geht das, ohne dass man vom Gas gehen und einen Pass vorzeigen muss.
Verkörpert der Smartphone-Bürger also die Macht, die uns zugewachsen ist, oder die Macht, die wir verloren haben? Sollten wir darüber trauern, dass Politik im Zeichen der Ideologie passé ist, oder uns freuen, von dieser Last befreit zu sein? Und können wir darauf vertrauen, dass das Smartphone ein wirksames neues Instrument für die Verteidigung unserer Interessen ist?
Transparenz ist die neue Religion
Ist der Smartphone-Bürger derjenige, der unser Vertrauen in Demokratie und demokratische Institutionen wiederherstellen kann? Ich bin da skeptisch. Das Smartphone macht es uns zwar einfacher, unsere Politiker zu kontrollieren, aber wie steht es um das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit von Institutionen, die man als Bürger nicht direkt überwachen und kontrollieren kann? Wir schenken unserer Familie und unseren Freunden nicht deshalb Vertrauen, weil wir sie kontrollieren können. Die zunehmenden Möglichkeiten, die wir haben, unsere politischen Vertreter zu kontrollieren, schlagen sich nicht ohne weiteres in einem größeren Vertrauen in die Demokratie nieder. Lenin pflegte zu sagen: »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.« Der bolschewistische Titan ist freilich nicht als Vorreiter einer vorbildlichen demokratischen Kultur bekannt. Die Vertrauenskrise von heute ist wahrscheinlich weniger dramatisch, als die Umfrageergebnisse es anzeigen (und als die öffentliche Diskussion es nahelegt), doch andererseits ist Vertrauen, wie der Soziologe Niklas Luhmann geschrieben hat, ein Grundelement des gesellschaftlichen Lebens, ohne das man morgens das Bett nicht verlassen würde. Andererseits ist es offensichtlich, dass die gesteigerte Fähigkeit der Bürger, ihre Regierung zu kontrollieren, nicht zu mehr Vertrauen in die Demokratie geführt hat. Die meisten der Initiativen, die den Anspruch erheben, das Vertrauen in den Staat wiederherzustellen, helfen in Wirklichkeit mit, eine Demokratie des Misstrauens zu kultivieren. Dieser Trend tritt nirgendwo deutlicher hervor als bei der allgemeinen Obsession für Transparenz.
Transparenz ist die neue politische Religion vieler bürgerschaftlich Engagierter und einer wachsenden Zahl demokratischer Regierungen. Die Transparenz-Bewegung verkörpert die Hoffnung, eine Kombination aus neuen Technologien, öffentlich zugänglichen Daten und einem frischen staatsbürgerlichen Aktivismus werde die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Bürger ihre politischen Vertreter wirksamer kontrollieren können. Was »Transparenz« für engagierte Bürger so attraktiv macht, ist die Annahme, dass die Menschen, wenn sie nur »Bescheid wissen«, zur Tat schreiten und ihre Rechte einfordern werden. Fairerweise muss man anerkennen, dass die Transparenz-Bewegung in vielen Bereichen eindrucksvolle Resultate gezeitigt hat. Gesetze, die Unternehmen verpflichten, die mit der Nutzung ihrer Produkte verbundenen Risiken offenzulegen, haben den Verbraucher gestärkt und unser Leben sicherer gemacht. (Wir schulden dem heute so oft gescholtenen Ralph Nader als einem der Vorkämpfer dieser Entwicklung Dank.) Die Forderung nach Offenlegung hat auch das Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten, Lehrern und Schülern verändert. Für Patienten ist es heute eher möglich, Ärzte zur Verantwortung zu ziehen, und Eltern verfügen über bessere Entscheidungsgrundlagen für die Wahl der richtigen Schule für ihre Kinder. Die neue Bewegung für Transparenz hat die Verbraucher aus ihrer Ohnmacht befreit.
Die Annahme erscheint logisch zwingend, dass der Staat seinen Charakter unwiderruflich verändern wird, sobald man ihm das Privileg der Verschwiegenheit und des Amtsgeheimnisses nimmt. Er wird ehrlicher werden. Wo Regierungen zu viel im Geheimen tun, wird die Demokratie brüchig, auch wenn Wahlen prinzipiell unvorhersehbare Resultate zeitigen. Nur informierte Bürger können von Regierungen Rechenschaft fordern. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass demokratische Aktivisten so viel Hoffnung in Transparenz und die mit ihr einhergehende Wiederherstellung von Vertrauen in demokratische Institutionen setzen. Wie der US-amerikanische Rechtsgelehrte und Aktivist Lawrence Lessig in seinem Essay »Against Transparency« schreibt: »Wie kann irgendjemand gegen Transparenz sein? Ihre Segnungen und Nutzanwendungen erscheinen so überwältigend offensichtlich.«1 Doch so offensichtlich die Segnungen der Transparenz sein mögen, so klar ist auch, wie Lessig überzeugend darlegt, dass wir ihre Risiken nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Die Annahme, Transparenz könne das Vertrauen der Bürger in die Demokratie wiederherstellen, stützt sich auf mehrere problematische Prämissen, zuallererst auf den Glauben daran, dass alles anders wäre, wenn »die Menschen nur Bescheid wüssten«. So einfach ist die Sache nicht. Die Offenlegung von Politik bringt nicht zwangsläufig den informierten Bürger hervor, und mehr Kontrolle erzeugt nicht unbedingt mehr Vertrauen in staatliche Institutionen. Ein Beispiel: Nachdem die amerikanischen Wähler erfahren hatten, dass ihr Land einen Krieg gegen den Irak geführt hatte, ohne dass es einen Beweis für die behaupteten Massenvernichtungswaffen in irakischer Hand gab, wählten sie den dafür verantwortlichen Präsidenten trotzdem wieder. Und die italienischen Wähler waren in den mehr als zehn Jahren, in denen sie Silvio Berlusconi an der Macht hielten, ausgiebig über alle möglichen Missetaten des Mannes informiert. In den Augen der aktiven Gegner Berlusconis hätte dieses Wissen mehr als ausreichen müssen, um ihm den politischen Garaus zu machen. Doch »alles zu wissen« bedeutet in der Politik eben nicht, dass alle dasselbe wissen. Die bloße Tatsache, dass Regierungen heute gezwungen sind, Informationen preiszugeben, führt nicht notwendigerweise dazu, dass die Bürger generell mehr wissen oder die Dinge besser begreifen. Menschen mit Informationen zu überschütten, ist ein bewährtes Mittel, sie in Unwissenheit zu belassen. Ihr Steuerberater wird Ihnen verraten, wie man am besten verhindert, dass Steuerprüfer sich zu intensiv mit den Geschäften Ihrer Firma befassen: indem man ihnen alle verfügbaren Informationen zur Verfügung stellt, anstatt nur die für ihre Arbeit notwendigen und brauchbaren. Was nun das Verhältnis zwischen Vertrauen und Kontrolle betrifft, so liegen die Dinge hier noch komplizierter. Schafft Kontrolle automatisch Vertrauen oder ist sie einfach nur ein Ersatz dafür? Verstärken autoritäre Regierungen ihre Kontrolle über die Gesellschaft, um den Bürgern besser vertrauen zu können?
Während die Befürworter von Transparenz beteuern, es sei möglich, die Forderung nach einem transparenten Staat mit dem Schutz der Privatsphäre der Bürger zu versöhnen, vertrete ich die Auffassung, dass ein gänzlich transparentes Staatswesen einen gänzlich transparenten Bürger produziert. Wir können den Staat nicht voll transparent machen, ohne unsere Privatsphäre zu opfern. Anders als jene, die glauben, eine Politik der totalen Offenlegung werde die Qualität der öffentlichen Debatte verbessern, bin ich der Meinung, dass die Einspeisung großer Informationsmengen in die öffentliche Diskussion diese nur verwickelter macht und den Schwerpunkt von der moralischen Kompetenz der Bürger auf ihre Fachkenntnis in dem einen oder anderen Politikbereich verschiebt. Die Transparenz-Bewegung vertraut darauf, eine volle Offenlegung staatlicher Informationen werde die öffentliche Debatte rationaler und weniger paranoid machen; im Gegensatz dazu meine ich, dass die Konzentration auf Transparenz Verschwörungstheorien fördert. Es gibt nichts Verdächtigeres als die Forderung nach absoluter Transparenz. Und niemand kann ehrlich behaupten, unsere öffentlichen Debatten seien mit zunehmender Transparenz unserer Regierungen weniger paranoid geworden. Der Vormarsch der Transparenz-Bewegung hat das Potential, die demokratische Politik zu erneuern, aber wir sollten sicherstellen, dass wir uns über die Richtung einig sind, in die der Wandel gehen soll. Ist die Transparenz-Bewegung in der Lage, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen wiederherzustellen, oder wird sie das Misstrauen zum offiziellen Idiom der Demokratie machen?
Eine Gesellschaft von Spionen
Unsere extreme Fokussierung auf Transparenz beeinflusst das Funktionieren der Demokratien tiefgreifend. Sie trägt vielleicht sogar zu einem Prozess bei, der auf die Ablösung der repräsentativen Demokratie durch ein politisches Regime hinausläuft, bei dem nur noch die Bürger selbst die Exekutive kontrollieren. Im Gegensatz zu ihrem erklärten Ziel, das Vertrauen in die Institutionen der Demokratie wiederherzustellen, könnte die Transparenz-Bewegung den Prozess der Transformierung demokratischer Politik in eine Bewirtschaftung des Misstrauens beschleunigen. Die Politik der Transparenz ist keine Alternative zu einer Demokratie ohne Wahlmöglichkeiten, sie ist vielmehr deren Rechtfertigung und verwischt den Unterschied zwischen Demokratie und der neuen Generation marktfreundlicher autoritärer Regime. Es ist nicht verwunderlich, dass chinesische Führer der Transparenz-Idee enthusiastisch applaudieren. Was sie verhindern wollen, ist die Konkurrenz politischer Parteien und Ideen und die Suche nach politischen Alternativen zur Herrschaft der kommunistischen Partei.
Im späten 18. Jahrhundert entwarf der britische Philosoph und Gesellschaftstheoretiker Jeremy Bentham ein institutionelles Modell, das er als panopticon bezeichnete. Der Grundgedanke war der, dass eine Aufsichtsperson alle Insassen einer Institution – sei es ein Gefängnis, eine Schule oder ein Krankenhaus – überwacht, ohne dass die Betroffenen erkennen können, ob sie beobachtet werden oder nicht. Das panopticon wurde alsbald zum Symbol unseres modernen Verständnisses von Macht als Kontrolle über Individuen oder Gruppen. Die berühmten negativen Utopien des 20. Jahrhunderts – wie Aldous Huxleys Schöne neue Welt, Jewgeni Samjatins Wir oder George Orwells 1984 – handeln von transparenten Gesellschaften, in denen die Regierung über die Mittel zur totalen Kontrolle verfügt. Alles zu wissen, ist das Rezept dieser Regierungen für absolute Macht.
Wenn das Konzept einer »nackten» Gesellschaft der Traum der Regierungen ist, verkörpert das Konzept eines »nackten« Staates und entblößter Unternehmen das Ideal vieler Demokratie-Aktivisten. Initiativen wie Publish What You Pay oder die Open Government Initiative und radikale politische Plattformen wie WikiLeaks sind die besten Beispiele für die These, dass die Menschen, wenn sie nur mit den »richtigen« Informationen versorgt werden, Staaten und Regierungen rechenschaftspflichtig machen können. Der oft zitierte Ausspruch des US-amerikanischen Bundesrichters Louis Brandeis, »Sonnenlicht soll das beste Desinfek-tionsmittel sein«, bringt die Philosophie der Transparenz-Bewegung treffend auf den Punkt: Diese Bewegung ist bestrebt, ein panopticon mit umgekehrten Vorzeichen zu errichten, bei dem nicht die Regierung die Gesellschaft überwacht, sondern die Gesellschaft die Mächtigen. An die Stelle der totalitären Utopie eines Staates, der die Bürger ausspionieren lässt, tritt die progressive Utopie einer Bürgerschaft, die den Staat ausspioniert.
Das Problem dabei ist, dass Spionage Spionage bleibt, ganz gleich, wer wen ausspioniert. Sollten wir unser Recht auf Privatsphäre aufgeben, um bessere staatliche Dienstleistungen zu erhalten? Wo liegt der grundlegende Unterschied zum Verzicht auf die individuelle Wahlfreiheit, den totalitäre Regime ihren Bürgern im Interesse nationaler Größe oder als Gegenleistung für mehr soziale Gleichheit zumuten? Die Debatte über die Veröffentlichung staatlicher Geheimdepeschen durch WikiLeaks hat die moralische Dimension des Kampfes gegen die Vertraulichkeit staatlicher Politik ans Licht gebracht. Im Allgemeinen überwachen Staaten ihre Bürger. Doch wenn man dies anhand konkreter Beispiele öffentlich macht, wird man auch die Bürger, die der Regierung Informationen geliefert haben oder von ihr überwacht worden sind, an die Öffentlichkeit zerren. Es ist unmöglich, staatliche Akten zu öffnen, ohne dass man die darin gesammelten Informationen über die Bürger zu sehen bekommt. Die Öffnung geheimpolizeilicher Akten in postkommunistischen Gesellschaften ist das klassische Beispiel für die Dilemmata, die sich mit jeder Politik gezielter Enthüllungen verbinden. Sollte jeder erfahren können, wie sich seine Mitbürger in der kommunistischen Ära verhalten haben? Sollten nur die Akten über Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses geöffnet werden? Wie verlässlich sind von der Geheimpolizei zusammengetragene Informationen? Wird das Wissen über andere zu einer moralischen Katharsis in der Gesellschaft führen oder wird es einfach als »Kompromat« (kompromittierendes Material) in schmutzigen Machtspielen verwendet? Das sind keine leicht zu beantwortenden Fragen.
Die moderne Gesellschaft ist auf die Hoffnung gegründet, dass wir eines Tages Fremden und Institutionen so vertrauen können, als wären sie Mitglieder unserer Familie. Die Erfahrungen aus jüngerer Zeit zeigen freilich, dass es eher umgekehrt ist. Wir sind dabei, unserer Familie mit einem Misstrauen zu begegnen, das in früherer Zeit Verbrechern vorbehalten blieb. Wir erleben, dass die Kombination aus Misstrauen und neuen Technologien unser Privatleben umkrempelt. Misstrauen ist jetzt selbst in den innerfamiliären Beziehungen zur Standardeinstellung geworden. Von Anwälten ist zu hören, die moderne Technik könne ein Scheidungsverfahren heute zu einem Wettrüsten machen: Küchen und Schlafzimmer würden verwanzt wie in den Tagen des Kalten Krieges die US-Botschaft in Moskau. Versprach die Transparenz-Bewegung ursprünglich die Wiederherstellung des Vertrauens in die Institutionen der Gesellschaft, so ist es in Wirklichkeit zu einer Invasion des Misstrauens in die Sphäre des Privatlebens gekommen.
Transparenz und Verschwörung
Der verstorbene US-Senator und Intellektuelle Daniel Patrick Moynihan war einer der ersten, die die Auswirkungen staatlicher Geheimhaltung auf das Vertrauen der Gesellschaft in ihre Institutionen analysierten. Die von ihm initiierte und nach ihm benannte Commission on Government Secrecy legte überzeugend dar, dass Geheimhaltung eine Form staatlicher Regulierung ist, dass exzessive Geheimhaltung nationalen Interessen schaden kann, dass sie die Rechenschaftspflicht der Regierung untergräbt und eine voll informierte Debatte verhindert. Nach Moynihans Auffassung beeinträchtigten in der Ära des Kalten Krieges diejenigen, die in den USA an den Schaltstellen der Macht saßen und ein hohes Maß an Geheimhaltung praktizierten, die Leistungsfähigkeit der Regierung. Geheimpolitik sei für die paranoiden Tendenzen in der amerikanischen Politik in den Zeiten McCarthys verantwortlich gewesen und habe der Bereitschaft der Bürger, ihrer Regierung zu vertrauen, Abbruch getan.
Das Argument Moynihans, der Bürger müsse ein vollständiges Bild von der Regierung haben, um ihr vertrauen zu können, ist schwer zu kontern. Die Forderung nach Transparenz hat eine Menge für sich, aber andererseits ist die Vorstellung, alles könne offengelegt werden, auch nicht unproblematisch. Ist nicht jede Enthüllung zugleich auch in anderer Hinsicht eine Verhüllung? Sind Informationen, die der Staat in dem Wissen erhebt, dass sie unverzüglich der Öffentlichkeit zugänglich sein werden, ebenso verlässlich wie Informationen, die dazu bestimmt sind, geheim zu bleiben? Wären die Pentagon Papers der Renner geworden, der sie waren, wenn die Regierung sie von sich aus veröffentlicht hätte?
Die Verfügbarkeit von Informationen ist keine Garantie dafür, dass die Menschen größeres Vertrauen in den Prozess der Entscheidungsfindung haben, denn Informationen gehen immer Hand in Hand mit Interpretationen. Aus denselben Rohdaten werden Republikaner und Demokraten in den USA oder Säkularisten und Vertreter der Moslem-Bruderschaft in Ägypten ganz unterschiedliche Aussagen destillieren, schon weil politische Willensbildung grundsätzlich nicht unabhängig von den Interessen und Werten der Entscheidungsträger stattfindet. »Unser Zeitalter steht offenbar ganz im Zeichen von Obsessionen«, schreiben die Anthropologen Jean und John Comaroff im Nachwort zu der Anthologie Transparency and Conspiracy. »Es ist ein Zeitalter, in dem die Menschen allem Anschein nach fast überall auf Transparenz und Verschwörung zugleich fokussiert sind.«2
Welche Zwiespältigkeiten eine Politik des Vertrauens offenbart, lässt sich am besten am Beispiel der jüngsten Präsidentschaftswahlen in Russ-land aufzeigen. Im Dezember 2011 hatte die landesweite Parlamentswahl eine Explosion von Bürgerprotesten ausgelöst. Hunderttausende waren in Moskau und anderen russischen Großstädten auf die Straße gegangen, um faire Wahlen und echte Alternativen zu fordern. Die sich verschärfende Legitimationskrise des Regimes zwang die Regierung, kreative Ideen zur Rechtfertigung ihrer Macht auszubrüten. Der zentrale Vorschlag für die Präsidentschaftswahl zeugte von besonderem Erfindungsreichtum: Um eine korrekte und faire Wahl zu gewährleisten, schlug der Kreml vor, in allen Wahllokalen des Landes Webcams zu installiert werden. Das werde jedem Bürger die Möglichkeit eröffnen, die Korrektheit der Wahl persönlich zu überwachen. Die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete euphorisch: »Von der Kamtschatka bis nach Kaliningrad, von Tschetschenien bis nach Tschukotka registrierten sich mehr als 2,5 Millionen Netzsurfer, um Livestreams von mindestens 188 000 Webcams in mehr als 94 000 Wahllokalen auf dem Staatsgebiet Russlands zu verfolgen.« Ein finnischer Beobachter feierte diesen technischen Kraftakt als eine Lehrstunde in Transparenz: »Ein Meilenstein in der Geschichte der Demokratie und demokratischer Wahlen.«
Allerdings ist unter den vom Regime Wladimir Putins gesetzten Bedingungen – die Regierung entscheidet darüber, wer bei Wahlen kandidiert und wer nicht – die Installierung von Webcams nicht viel mehr als eine Farce. Noch bedenklicher stimmt die Zwiespältigkeit dieses flächendeckenden Einsatzes von Webcams. Aus dem Blickwinkel Moskaus und des Westens mögen die Webcams als ein Kontrollinstrument erscheinen, das den Bürgern erlaubt, der Regierung auf die Finger zu sehen. Doch für den postkommunistischen russischen Wähler irgendwo in der tiefsten Provinz vermittelten sie eine andere Botschaft: Die Regierung schaut uns beim Wählen über die Schulter. Putin trug auf diese Weise einen doppelten Sieg davon: Er konnte sich gegenüber dem Westen als Vorkämpfer der Transparenz profilieren, zugleich aber die Mehrheit seiner Bürger einschüchtern. Die für die Wahl Putins eingerichteten Webcams waren zwei Dinge zugleich: Werkzeuge der Transparenz und der Überwachung.
In Bulgarien kam im Sommer 2009 eine neue Regierung an die Macht. Das Versprechen, für mehr Transparenz zu sorgen, stand ganz oben auf ihrer Agenda. Gleich nach seiner Amtsübernahme erklärte der Premierminister, alle Kabinettssitzungen würden nach spätestens 48 Stunden auf der Website der Regierung abrufbar sein. Die für Bürgerrechte kämpfenden Organisationen jubelten. Doch dann traten völlig unerwartete Folgewirkungen ein.
Angesichts der Aussicht, dass die Beratungen der Regierungsmitglieder fortan mit kurzer zeitlicher Verzögerung online gestellt werden würden, wurden die Minister extrem zurückhaltend in ihren Äußerungen, und überlegten genau, wie ihre Worte gedeutet oder missdeutet werden könnten. Nicht lange und die Regierung begann damit, die neue Politik der Offenheit als PR-Instrument einzusetzen. Der Premierminister nutzte die Kabinettssitzungen, um seine Gegenspieler zu attackieren oder um Fensterreden zu halten. Dazu kam, dass die meisten Beschlüsse ohne gründliche Diskussion gefasst wurden. Die perverse Folge der verordneten Transparenz war, dass die »wirklichen« Entscheidungen außerhalb des Kabinetts getroffen wurden und dass die neue Offenheit die persönliche Macht des Premierministers stärkte.
Am deutlichsten sichtbar wird das Zusammenspiel von Transparenz und Verschwörung vielleicht in der Mentalität der aktuellen großen Kämpfer gegen staatliche Geheimpolitik. Julian Assange, der Gründer von WikiLeaks, charakterisierte seine Organisation als einen »demokratischen Open-Source-Nachrichtendienst«. In mehr als einer Hinsicht erinnert Assange an eine Figur aus einem Verschwörungsroman von Joseph Conrad. Die in die Dutzende gehenden Bücher über Assange, die in jüngster Zeit erschienen sind – von seiner eigenen Autobiographie gar nicht zu reden –, lassen ihn als eine geheimnisumwitterte, paranoide, autoritäre Persönlichkeit erscheinen, als jemanden, den man bewundern kann, dem man aber nicht unbedingt vertrauen würde. Er hat die Täuschung zu seiner Passion und zu seinem Beruf gemacht. Er verfolgt mit Vorliebe die Strategie, keinen Unterschied zwischen demokratischen und autoritären Regierungen zu machen – nach seinem Verständnis sind alle Regierungen autoritär. Kann man sich vorstellen, dass Assanges Weltsicht eine Ausgangsbasis für die Wiederherstellung des Vertrauens in die Demokratie ist?
In dem Moment, in dem staatliches Wissen dazu bestimmt ist, ungeschmälert und unverzüglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden, wird sein Informationswert abnehmen und sein Wert als Instrument zur Manipulierung der Öffentlichkeit zunehmen. Erinnern wir uns nur daran, wie Gangster in Spielfilmen reden, wenn sie vermuten, dass sie abgehört werden. Sie sprechen klar und deutlich, aber nur über Banalitäten, und tauschen dabei unter dem Tisch bekritzelte Zettel aus. Auf diese Art werden auch Regierungen im Zeitalter der Transparenz arbeiten. Die Frage, die sich hier unausweichlich stellt, lautet: Weshalb bringt die Öffnung aller Informationsschleusen keine qualitativ bessere Demokratie? Michel Foucault weist in seinen späten Untersuchungen zur Wahrheitsproduktion im antiken Griechenland3 darauf hin, dass der Akt der parrhesia, des Wahrsprechens, sich nicht darauf reduzieren lässt, dass etwas ausgesprochen wird, das bis dahin nicht bekannt war. Paradoxerweise ist Wahrheit in der Politik etwas, das jeder kennt, das aber niemand auszusprechen wagt. Die Leute brauchen in der Regel keine neuen Informationen, um zu wissen, dass die Ungleichheit zunimmt oder dass Einwanderer diskriminiert werden. Die von WikiLeaks veröffentlichten Depeschen bewirkten nicht, dass wir etwas über die Politik der USA erfahren haben, das wir noch nicht wussten. Es ist in der Regel nicht irgendeine »neue« Wahrheit, die einer politischen Ansprache Kraft oder Brisanz verleiht, sondern die Entscheidung einer konkreten Person, unter Inkaufnahme persönlicher Risiken den Behörden oder der eigenen Gemeinschaft den Kampf anzusagen. Das »Leben in der Wahrheit« kommt nicht einem unbeschränkten Zugang zu allen Informationen gleich. Veränderungen herbeiführen wird letzten Endes der Mensch, der die Wahrheit zu sagen wagt, und nicht die Wahrheit als solche.
Transparenz und Anti-Politik