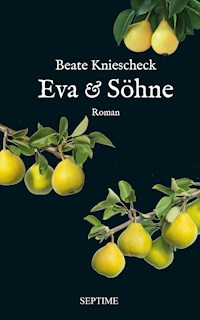
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eva führt einen kleinen Laden, den sie später an ihre Söh-ne übergeben wird. Was kaum jemand weiß: Sie ist auch Mutter einer Tochter, die als kleines Kind starb. Niemand spricht mehr über das Mädchen, schließlich wird sogar ihr Grab aufgelöst. Das Schweigen, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Evas ländlicher Heimat allgegenwärtig ist, wird zur bedrückenden Last, bis Eva schließlich ganz verstummt. Es bleiben Schmerz, Wunden, Geheimnisse, aber auch eine neu gefundene Kraft, die es der jungen Mutter ermöglicht, ihre Stimme wiederzufinden und nach dem Tod ihres Kindes weiterzuleben. Siebzig Jahre später stirbt Evas erstgeborener Sohn. Erst jetzt erfährt Evas Enkelin, dass ihre Großmutter eine Tochter hatte. Sie beschließt, der Unsichtbarkeit der Frauen in ihrer Familie etwas entgegenzusetzen, und macht sich auf die Suche nach dem verschollenen Grab von Evas Tochter. Eine Recherche beginnt, die mit einer unerwarteten Erkenntnis endet. Eva & Söhne erzählt von der Selbstermächtigung zweier sehr unterschiedlicher Frauen im 20. und 21. Jahrhundert. Es ist eine Geschichte über Tod, Wut und Trauer. Sie handelt von der Ungerechtigkeit der Geschlechterverhältnisse und des Schicksals, aber auch von der verbindenden Kraft der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autorin und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Epilog
Helmuts Brief an seine Schwester
Gedichte aus Evas Tagebuch
Antons Brief an den Pfarrer von Jenseits
Danksagung
© 2022, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung bei der Stadt Wien.
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-903061-95-8
Lektorat: Senta Wagner
Cover: Jürgen Schütz
Birnen auf dem Cover: © i-stock
Printversion: Hardcover
ISBN: 978-3-99120-013-0
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.instagram.com/septimeverlag
Beate Kniescheck
wurde 1975 in Oberösterreich geboren. Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität Wien, längere Reisen nach Kuba, Indien und Südostasien. Seit 2006 selbstständige Kommunikationsberaterin und Schreibtrainerin, zuvor Redakteurin bei österreichischen Tageszeitungen sowie Lizenzmanagerin bei einem deutschen Verlag. Schreibt seit vielen Jahren Kurzprosa und Gedichte, die in österreichischen und deutschen Anthologien und Literaturzeitschriften erscheinen. Eines ihrer Dramolette wurde im Schauspielhaus Wien aufgeführt, ein weiteres Dramolett von der Kulturinitiative Wies ausgezeichnet. Sie lebt mit ihrer Familie in Wien. Eva & Söhne ist ihr Romandebüt.
Klappentext:
Eva führt einen kleinen Laden, den sie später an ihre Söh-ne übergeben wird. Was kaum jemand weiß: Sie ist auch Mutter einer Tochter, die als kleines Kind starb. Niemand spricht mehr über das Mädchen, schließlich wird sogar ihr Grab aufgelöst. Das Schweigen, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Evas ländlicher Heimat allgegenwärtig ist, wird zur bedrückenden Last, bis Eva schließlich ganz verstummt. Es bleiben Schmerz, Wunden, Geheimnisse, aber auch eine neu gefundene Kraft, die es der jungen Mutter ermöglicht, ihre Stimme wiederzufinden und nach dem Tod ihres Kindes weiterzuleben.Siebzig Jahre später stirbt Evas erstgeborener Sohn. Erst jetzt erfährt Evas Enkelin, dass ihre Großmutter eine Tochter hatte. Sie beschließt, der Unsichtbarkeit der Frauen in ihrer Familie etwas entgegenzusetzen, und macht sich auf die Suche nach dem verschollenen Grab von Evas Tochter. Eine Recherche beginnt, die mit einer unerwarteten Erkenntnis endet.Eva & Söhneerzählt von der Selbstermächtigung zweier sehr unterschiedlicher Frauen im 20. und 21. Jahrhundert. Es ist eine Geschichte über Tod, Wut und Trauer. Sie handelt von der Ungerechtigkeit der Geschlechterverhältnisse und des Schicksals, aber auch von der verbindenden Kraft der Liebe.
Beate Kniescheck
Eva & Söhne
Roman | Septime Verlag
Für meine Mutter,
ein Fels in der Brandung
Alles vergeht: Auch die Gräber sterben.
Roland Barthes
»Gleich sind wir oben«, sagte meine Mutter und mit oben meinte sie das Krankenhaus. Sie legte ihre Handtasche wieder auf den Schoß und schaute geistesabwesend aus dem Fenster. Ich starrte auf die Fahrbahn, die grünen Wiesenstreifen am Straßenrand. Rhythmisch bewegten sich die Scheibenwischer, Regentropfen zeichneten Muster auf die Windschutzscheibe. Der Februar des Jahres 2019 war überdurchschnittlich warm gewesen, doch an diesem verregneten Tag hinterließen die frühlingshaften Temperaturen keine erkennbaren Spuren am Horizont. Die Sonne ließ sich nicht blicken und der Himmel war düster. Mein Vater war schon seit ein paar Tagen im Krankenhaus, sein Zustand hatte sich verschlechtert. Die Ärzte hatten ihn auf die Intensivstation verlegt und entschieden, ihn in künstlichen Tiefschlaf zu versetzen. Meine Mutter suchte etwas in ihrer Handtasche, dann sagte sie: »Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn wir oben sind.«
»Erzähl Papa doch vom Wetter«, empfahl ich.
»Das wird keine schöne Geschichte«, sagte sie. Beide lachten wir, erleichtert für einen Moment.
Im Krankenhaus fuhren wir mit dem Lift in den vierten Stock. Der Raum, in dem wir warten mussten, war grell ausgeleuchtet, ein septischer Schock für die Augen. Ich nahm den Geruch von Orange und Zimt wahr, in einer Duftlampe brannte eine Kerze. Ein Regal war schütter mit Ratgeberliteratur bestückt, auf den Buchrücken stand Lebensmut in schwerer Zeit, Wege zur Heilung und Trost und Trauer. Ich nahm Trost und Trauer zur Hand, wegen des Titels, den ich abstoßend fand.
Die automatische Tür zur Intensivstation öffnete sich. »Sie können jetzt hinein«, sagte die Krankenpflegerin. Als wir am Bett meines Vaters standen, fiel mir auf, wie breit seine Hände waren, selbst die von der Arthrose verbogenen Finger wirkten kräftig. Auf seinen Beinen, die unter der Decke hervorschauten, hoben sich die blauen Krampfadern reliefartig von der Haut ab. »Besuch für Sie«, flüsterte sie meinem Vater ins Ohr und strich ihm über die grauen Haare, die ordentlich über seine Glatze gekämmt waren. Zu uns sagte sie, es gehe dem Vater den Umständen entsprechend gut. Sie warf einen Blick auf die Monitore, dann verließ sie den Raum. Ich stellte einen Sessel ans Bett, für meine Mutter. Sie blieb stehen und sah meinen Vater an. Schweigend nahm sie seine Hand.
Die Tage vergingen, aber der Zustand meines Vaters besserte sich nicht. Bei den häufigen Telefonaten mit meinem Onkel und meinen Brüdern sprachen wir über die medizinischen Details, die uns die Ärzte mitteilten. Die Grippe, eine echte Influenza, habe zu einer Lungenentzündung geführt, der Vater werde seit Tagen beatmet, auch seine Nieren hätten versagt, weshalb sein Blut jeden Tag gereinigt werde. Die Ärzte schienen in einer fremden Sprache zu sprechen, ich verstand kein Wort. Nach bangen Tagen des Wartens teilten sie mit, dass er vielleicht bald wieder selbstständig atmen könnte. Wie verlässlich diese Aussage denn sei, wollte ich wissen. »Man wird sehen«, sagte der Chefarzt.
Schließlich hatten sie meinen Vater aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt. Bei unserem Besuch waren seine Augen geschlossen, er murmelte unverständliche Dinge. Nur die folgenden Worte waren klar und deutlich zu verstehen: »Unterste Lade. Unterste Lade. Unterste Lade.« Er warf den Kopf von einer Seite auf die andere und versuchte, die Hände zu heben. Eine Pflegerin kam ins Zimmer und prüfte die Infusionsbehälter, aus denen Flüssigkeit in die Venen meines Vaters tropfte. Sie sah auf professionelle Weise besorgt aus und erklärte, es könne sich um einen Fiebertraum handeln. Dann begann sie, mit meinem Vater zu sprechen, während sie ihm den Kopf streichelte: »Alles ist gut, Herr Anzgruber, alles ist gut.« Seine Gesichtszüge waren verzerrt, ganz so, als wäre er sehr verzweifelt. Deshalb sagte ich irgendwann zu ihm: »Sobald ich in eurer Wohnung bin, schaue ich in alle untersten Laden.« Er beruhigte sich und schlief ein.
Unterste Lade. Die Worte meines Vaters gingen mir nicht aus dem Kopf. In der folgenden Nacht durchkämmte ich systematisch die Wohnung meiner Eltern. Ich fand alte Zeitungsausschnitte, Zeitschriften und Bücher, blätterte rasch ein paar durch und stellte sie wieder zurück. Mein Vater schätzte seine Zeitungslektüre beim Frühstück. Berichte, die ihn interessierten, hob er auf. Manchmal las er ein Buch, als Jugendlicher hatte er Karl May gemocht. Sein Lieblingsbuch: Winnetou III. Als Erwachsener sah er häufiger fern. Ich erinnerte mich, dass er abends in seinem wuchtigen Ledersessel Platz nahm, die Füße hochlegte und den Fernseher einschaltete. Wenn mein kleiner Bruder und ich zu laut waren, nahm er seine schweren Pantoffeln und schleuderte sie mit Wucht durchs Zimmer. Einmal fiel dabei eine Vase krachend zu Boden. Uns Kinder traf er nie. »Schon komisch, wie schlecht er zielt«, sagte mein Bruder. »Wo er doch so gut Tischtennis spielt.«
Beim Herumstöbern erwartete ich, etwas zu finden, gleichzeitig fürchtete ich mich vor diesem Fund. Gab es vielleicht Unterlagen, die er für den Fall seines Begräbnisses vorbereitet hatte? War es das, was er mit unterste Lade sagen wollte? Mein Großvater hatte eine Mappe mit detailreichen Anweisungen hinterlassen. Er hatte sogar eine Skizze für den Trauerzug gezeichnet, um festzulegen, in welcher Reihenfolge die örtlichen Vereine aufmarschieren sollten: zuerst die Blasmusik, dahinter Kirchenchor und Seniorenbund, dann die Goldhaubengruppe, der Kriegsopferverband und die Sportvereine. Mein Großvater war Schuldirektor, Stabführer der Blasmusik und Leiter des Kirchenchors, somit eine wichtige Persönlichkeit im Ort. Er rechnete mit einer schönen Leich.
In einer Ecke des Arbeitszimmers meines Vaters entdeckte ich sogenannte Herrenhefte, Ausgaben von Playboy und Penthouse. Irgendwann setzte ich die nächtliche Suchaktion in seinem Schlafzimmer fort. Im Kleiderkasten fand ich in der untersten Lade einen Wollpullover, der uralt sein musste, ich glaube mich zu erinnern, dass meine Großmutter ihn für meinen Vater gestrickt hatte. Es war ein unangenehm kratziges Ding, und trotzdem mochte mein Vater den Pullover und trug ihn jahrelang unter dem Skianzug, weil er gut warmhalte, wie er sagte. In den letzten Jahren war er nicht mehr Ski gefahren, er hatte auch den Pullover nicht mehr getragen. Die Wolle verströmte einen unangenehm scharfen Geruch, eine Mischung aus Mief und Mottenkugeln. Abgesehen vom Pullover schien die Lade leer zu sein. Ich schloss den Kasten und öffnete die oberen Laden der Kommode. Sie waren vollgestopft mit Socken und Unterhosen, in der untersten befanden sich Unterhemden aus Angorawolle, die er im Winter oft anhatte. Ich nahm sie heraus und entdeckte am Boden der Lade ein Kuvert: Nach meinem Tod zu öffnen stand darauf und eine Jahreszahl, 1994. Er hatte das schon vor langer Zeit geschrieben, vor fünfundzwanzig Jahren. Auf der Rückseite, wo der Umschlag zugeklebt war, hatte ihn mein Vater mit seinem Namen gezeichnet: Rudolf.
Am nächsten Tag besuchten wir meinen Vater erneut im Krankenhaus, dieses Mal gemeinsam mit meinen Brüdern. Anschließend trafen wir den Chefarzt zu einer weiteren Besprechung. »Rudolf Anzgruber … Ich werfe nur kurz einen Blick in den Akt«, sagte der Arzt mehr zu sich selbst. Er sah uns an, biss sich auf die Unterlippe, wählte seine Worte mit Bedacht und formulierte schlussendlich Sätze, die glasklar waren. »Falls sich die Nieren nicht bald erholen, gibt es kaum noch Hoffnung.«
Meine Mutter, die bei jedem der bisherigen Gespräche Fragen gestellt hatte, sagte nichts. Sie saß da und nickte. Ich fuhr mit ihr nach Hause, wieder suchte sie etwas in ihrer Handtasche, ohne es zu finden.
Später beim Mittagessen meinte sie, der Vater solle ein schönes Begräbnis bekommen, das schönste überhaupt. Ich wusste, dass ich ihr von dem Kuvert erzählen musste, das ich gefunden hatte. Vorsichtig äußerte ich meinen Verdacht, dass er möglicherweise Vorbereitungen für sein eigenes Begräbnis getroffen hatte. Ich hätte einen Umschlag gefunden, auf dem stehe Nach meinem Tod zu öffnen, sagte ich und holte ihn. Meine Mutter öffnete den Umschlag, nahm einen handgeschriebenen Brief heraus und las ihn. Dann gab sie ihn mir.
Höhenhart, 30. August 1994
Lieber Toni! Lieber Thomas!
Ihr habt große Absichten und bringt diese auch zu einem guten Ende. Ihr seid tüchtig unterwegs auf Eurem Lebensweg, aber seid Euch darüber im Klaren, dass der Abschnitt, der hinter Euch liegt, nur einer von vielen ist. Wichtiges kann noch vor Euch liegen – beruflich, aber auch privat.
Bleibt, wie Ihr seid, entwickelt Euch aber trotzdem weiter zu starken Männern und aufrechten Persönlichkeiten. Lasst neue Eindrücke in Euch einströmen. Seid neugierig und schaut auch hinter die Kulissen. Lernt immer wieder dazu. Wer nichts weiß, muss alles glauben!
Schließt echte Freundschaften und verzichtet auf die falschen. Achtet auf Eure Gesundheit und darauf, dass sich die Seele entfalten kann. Versucht nicht, alles auf einmal zu erreichen, seid aber dennoch fleißig und macht Eurer Familie Ehre.
Seid sparsam, aber nicht knauserig. Ihr habt unsere wirtschaftlich richtigen Ansichten geerbt. Finanziell konnten Eure Mutter und ich eine gute Grundlage für Euch schaffen, wenn es auch keine Reichtümer sind. Aber einiges ist möglich, wenn man das Geld nicht zum Fenster hinauswirft, sondern dort investiert, wo es Sinn ergibt.
Und denkt daran: Der berufliche Weg ist nie einfach, egal, ob man selbständig ist oder angestellt. Es gibt Neid und Konkurrenz, Missgunst kann überall entstehen. Lasst Euch dadurch nicht entmutigen!
In diesem Sinn noch ein paar Wünsche für die Zukunft des Geschäfts: Führt es mit Anstand, Weisheit und Fleiß, und falls sie es möchte, so überlegt, ob Ihr im Unternehmen auch eine Aufgabe für Katharina findet.
Ich wünsche Euch, dass Ihr den erfolgreichen Weg, den Eure Mutter und ich begonnen haben, weiterführen könnt. Aber vor allem wünsche ich Euch viel Glück, große Freuden, gute Freunde und eine stabile Gesundheit.
Euer Papa
Als ich fertiggelesen hatte, waren die Sorge und Traurigkeit der letzten Tage wie weggeblasen, ich empfand nur noch Wut. Mein Vater hatte also einen Abschiedsbrief an meine Brüder geschrieben, aber keinen an mich. Ich legte ihn auf den Tisch und sah, dass meine Mutter mich beobachtete. Am liebsten hätte ich den Brief weggeworfen oder noch besser verbrannt. Aber die Tage waren schwer genug für meine Mutter, ihr Blick war glasig. Daher beschloss ich zu ignorieren, dass ich ignoriert wurde. »Du musst Toni und Thomas diesen Brief geben«, sagte ich, »er ist für sie bestimmt.«
Am nächsten Tag gab es neue Nachrichten aus dem Krankenhaus, das Telefonat mit dem diensthabenden Arzt versprach nichts Gutes. Meine Mutter und ich saßen wieder im Wagen, sie hatte diesen Gesichtsausdruck, den die Leute gefasst nennen. Im Krankenhaus traten wir ans Bett meines Vaters, er öffnete die Augen ein wenig, drehte den Kopf leicht zu meiner Mutter. Es sah aus, als würde es ihn seine ganze Kraft kosten. Aus seinem rechten Auge lief eine Träne über das Gesicht, das eine gute Farbe habe, wie meine Mutter bei jedem Besuch betonte. Sie hatte die linke Hand auf seine Stirn gelegt, während sie mit der rechten seinen Arm streichelte. Das Stehen zwang sie in eine schiefe Haltung. Ich sah, wie sehr sie sich anstrengen musste, gleichzeitig lehnte sie es ab, sich zu setzen. Sie sprach ihn mit seinem Namen an und strich ihm dabei mehrmals über die Haare. Dann berichtete sie vom Umsatz, den ihre Firma am Vortag gemacht hatte. Sie hatte vor unserer Abfahrt noch die aktuellen Zahlen abgerufen und erzählte ihm, dass alles gut lief, dass er sicher Freude hätte am Geschäft. Schließlich fiel ihr nichts mehr ein, sie drehte sich suchend nach mir um. »Sag du etwas«, bat sie mich.
Ich schilderte meinem Vater, was ich beim Blick aus dem Fenster erkennen konnte. Dass es sonnig war nach einigen regnerischen Tagen, dass wir sehr froh wären, wenn der Frühling käme, dass es draußen roch, als wäre bereits Ostern, klar und frisch, und dass man schon bald einen Duft von Bärlauch und Maiglöckchen in der Nase haben würde. Ich sagte nichts von faulem Laub, feuchtem Moos und modriger Erde, obwohl es diese Gerüche waren, die man jetzt – bevor Bäume und Sträucher frühlingshaft austrieben – wahrnehmen konnte. Dann fiel auch mir nichts mehr ein. »Erzähl du wieder etwas«, sagte ich zu meiner Mutter.
Sie dachte nach, dann sah sie meinem Vater in die Augen. Ausgiebig schilderte sie, wie bauschige Wolken sich draußen auftürmten und es dann doch zuließen, dass Sonnenstrahlen sich zwischen sie schoben. Sie erzählte von Morgendämmerungen mit warmen Lichtspielen und solchen mit düsterer Stimmung. Von Tagen mit wilden Stürmen und von lauen Abenden, an denen die Luft so klar war, dass man die Gipfel am Horizont erblickte. Sie sprach, ohne dabei auch nur ein einziges Mal aus dem Fenster zu sehen. Bei ihren letzten Sätzen schlossen sich die Augen meines Vaters. Er starb nachts im Krankenhaus, allein.
Am Tag, an dem die Kremation angesetzt war, bat mich meine Mutter, zur Kirche und zum Friedhof zu gehen. Ich solle schauen, wie weit die Vorbereitungen fortgeschritten waren, die private Trauerfeier sollte ja noch am selben Abend stattfinden, die große Bestattung am nächsten Tag. Ich betrat die Kirche, die Mesnerin stellte gerade frischen Blumenschmuck auf den Altar. Der Bestatter hatte davor bereits die kleine Stellage platziert, auf der die Urne stehen würde. Oben am Presbyterium hantierte jemand mit einer Videokamera, mit der später das Begräbnis via Livestream in den Turnsaal der örtlichen Schule übertragen werden sollte, weil die Kirche zu klein für alle Trauergäste sein würde. Meine Mutter wollte ein schönes Begräbnis für meinen Vater, und dass es eine große Leich sein würde, davon gingen alle aus. Ich hatte eine Presseinformation verfasst, die wenige Stunden nach seinem Tod ausgesendet wurde, sodass wir mit unangekündigten Teilnehmern rechnen mussten, die aus der Zeitung davon erfahren hatten.
Der Videotechniker winkte mir, als er mich sah, senkte dann aber wieder die Hand. Ich nickte ihm stumm zu, verließ die Kirche und ging zum Grab. Die Sonne stand tief, mein Körper warf einen langen Schatten auf die frische Erde. Ein Loch war schon gegraben worden, genau an jener Stelle, an der mein Vater seine Urne haben wollte, wie er einmal im Scherz erwähnt hatte. Ich setzte meinen Weg zur Aufbahrungshalle fort, in der mein Vater in den Stunden vor der Kremation aufgebahrt lag. Unter meinen Füßen knirschten die Kieselsteine, eine Frau kam mir entgegen: »Letzte Gelegenheit, sich zu verabschieden«, sagte sie. Ein Satz, der mich an den Einlass ins Zirkuszelt erinnerte: Hereinspaziert! Manege frei! So kamen die Vorbereitungen mir jetzt vor, wie für eine große Leistungsschau begnadeter Artisten. Ich warf der Frau einen bösen Blick zu. Sie meine es nur gut, hätte meine Mutter sicher gesagt, wenn sie dabei gewesen wäre, oder ihren Lieblingssatz: Der Wille gilt fürs Werk.





























