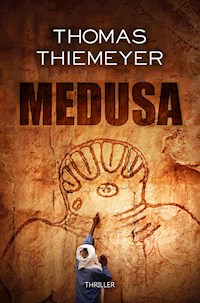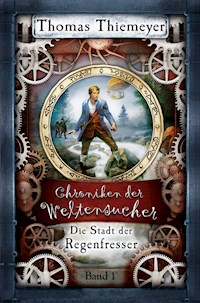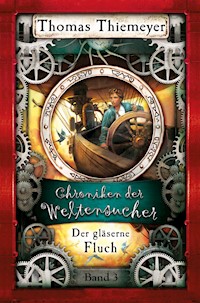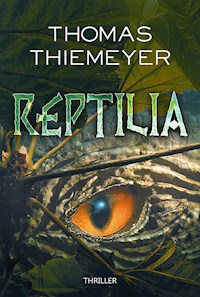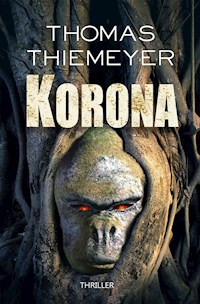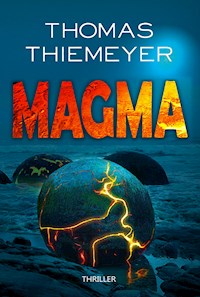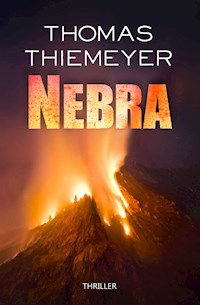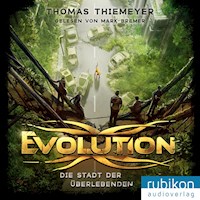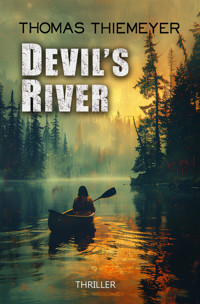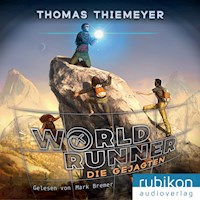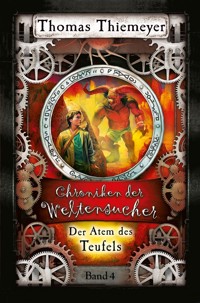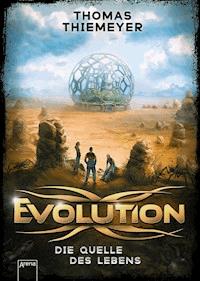
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Evolution-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Endlich am Ziel! Nach einer strapaziösen Flucht durch Sümpfe und Wüsten erwacht Jem in der Oase der Zeitspringer. Doch wie ist er hierher gekommen und wo sind seine Freunde? Katta ist verschwunden, Lucie und der kleine Squid liegen im Koma. Als Anführerin GAIA sich seiner annimmt, keimt in Jem Hoffnung: auf Rückkehr, auf ein neues Leben. Aber dann erwacht Lucie und den Freunden wird klar, in welch perfides Spiel sie geraten sind. Ein Spiel, das die Zukunft der Erde bedroht. In einer finalen Schlacht müssen die Jugendlichen sich entscheiden: Stehen sie auf der Seite der Tiere oder der Menschheit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Thomas Thiemeyer
DIE QUELLE DES LEBENS
Bücher von Thomas Thiemeyer im Arena Verlag: Evolution. Die Stadt der ÜberlebendenEvolution. Der Turm der GefangenenEvolution. Die Quelle des Lebens
Thomas Thiemeyer,geboren 1963, studierte Geologie und Geographie, ehe er sich selbstständig machte und eine Laufbahn als Autor und Illustrator einschlug. Mit seinen preisgekrönten Wissenschaftsthrillern und Jugendbuchzyklen, die mittlerweile in dreizehn Sprachen übersetzt wurden, ist er eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsliteratur. Seine Geschichten stehen in der Tradition klassischer Abenteuerromane und handeln des Öfteren von der Entdeckung versunkener Kulturen und der Bedrohung durch mysteriöse Mächte. Der Autor lebt mit seiner Familie in Stuttgart.
www.thiemeyer.dewww.thiemeyer-lesen.de
Für Steffi
1. Auflage 2017 © Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen Coverillustration: Jann Kerntke Einbandgestaltung: Johannes Wiebel ISBN 978-3-401-80635-8
www.arena-verlag.dewww.twitter.com/arenaverlagwww.facebook.com/arenaverlagfans
Inhaltsverzeichnis
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Epilog
»Die Wissenschaft ist wie ein Messer. Ob ein Chirurg oder ein Mörder, jeder gebraucht es auf seine Weise.«
Wernher von Braun – deutscher und US-amerikanischer Raketeningenieur
»Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden.«
Der deutsch-amerikanische Physiker Albert Einstein über die Erfindung der Atombombe
0
Was zuvor geschah …
Während eines Linienflugs von Frankfurt nach Los Angeles gerät der voll besetzte Jumbojet LH-456 über der Polarregion in einen Zeitstrudel, der ihn mehrere Hundert Jahre in die Zukunft schleudert. Lucie und Jem, die im Rahmen eines Schüleraustauschs in Richtung Kalifornien unterwegs sind, müssen miterleben, wie die Maschine auf dem Denver International Airport notlandet. Dort angekommen, stellen sie fest, dass nichts mehr so ist, wie es mal war. Die Welt hat sich verändert.
Auf der Suche nach Antworten begeben sie sich, zusammen mit ihren Freunden Olivia, Katta, Zoe, Marek, Arthur und Paul, an Bord eines Schulbusses auf die gefahrvolle Reise in die entvölkerte Metropole. Beunruhigende Informationen erwarten sie. Ganz offensichtlich wurde die Erde in der Vergangenheit von einem Kometen getroffen. Fremde Lebensbausteine gelangten ins Meer, breiteten sich in Form von Wolken und Regen über die ganze Welt aus und verursachten einen zweiten großen Evolutionsschub. Die Menschheit ist am Ende. Eine neue Spezies strebt nach der Krone der Herrschaft: die Squids – Nachfahren der Tintenfische. Perfekt getarnt und mindestens ebenso intelligent wie Menschen, stellen sie eine übermächtige Bedrohung dar.
Nachdem die Jugendlichen versehentlich zwei dieser Kreaturen töten, überschlagen sich die Ereignisse. Als Opfer einer groß angelegten Treibjagd bleibt ihnen nur die Flucht in die Berge. In alten Schriften finden sie den Hinweis auf eine verborgene Stadt – eine letzte Zuflucht der Menschheit, verborgen inmitten von Eis und Schnee.
Dort angekommen, erfahren die Jugendlichen, dass sie offenbar nicht die ersten Menschen sind, die aus der Vergangenheit durch die Zeit geschleudert wurden. Deshalb beschließen sie, das Geheimnis der sogenannten Zeitspringer zu lüften. Vielleicht finden sie so endlich einen Weg zurück nach Hause. Doch die Fremden sind nach Süden gezogen, hin zu einem Ort namens Los Alamos, tief in der lebensfeindlichen Wüste New Mexicos.
Während ihrer langen und gefahrvollen Reise treffen Lucie, Jem und die anderen zum ersten Mal auf die neuen Herrscher der Erde und stellen fest, dass die Squids keineswegs so bösartig und grausam sind, wie es in den Geschichten heißt. Lucie freundet sich mit einem der kleineren Exemplare an und lernt durch ihn das Geheimnis der neuen Weltordnung kennen. Die Squids sind dank ihrer telepathischen Fähigkeiten in der Lage, mit jeder beliebigen Tiergattung zu kommunizieren. Auf diese Weise bilden sie ein weltumspannendes Netzwerk, dem nur der Mensch sich verweigert.
Als die Squids erfahren, dass die Freunde auf der Suche nach den Zeitspringern sind, mahnen sie zur Vorsicht. Ihrer Meinung nach schlummert ein dunkles Geheimnis in der Wüste. Irgendetwas Bedrohliches geht dort vor. Als ehemaligen Meeresbewohnern ist es ihnen unmöglich, selbst an diesen lebensfeindlichen Ort zu reisen, und so bieten sie den Jugendlichen einen Handel an: freies Geleit und die Aussicht auf eine zweite Chance gegen Informationen aus der Enklave.
Die Freunde begeben sich in die grausame Wüste und stoßen dort auf etwas, womit sie niemals gerechnet hätten.
1
Jem sah sie kommen. Mehrere Objekte, die von dem kugelförmigen Gebäudekomplex in die Höhe stiegen. Sie waren schwarz und wirkten irgendwie bösartig. Sie gewannen rasch an Höhe und nahmen dann Kurs auf sie. Sie sahen aus wie Vögel, doch es waren keine. Irgendwelche Maschinen vielleicht? Jetzt war auch ein Geräusch zu hören. Ein helles, widerwärtiges Summen.
Von seiner erhöhten Position aus verfolgte Jem, wie die Objekte einander umkreisten und dann Kampfformation einnahmen.
»Schau mal.« Er deutete darauf. »Was hältst du davon?«
»Keine Ahnung«, murmelte Zoe. »Aber ich habe ein mieses Gefühl bei den Dingern.«
»Geht mir genauso. Ich würde vorschlagen, wir hauen ab. Lass uns zu den anderen zurückkehren und gemeinsam überlegen, was wir jetzt unternehmen sollen.«
»Einverstanden.«
Zoe duckte sich und lief zwischen den Felsentürmen zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Jems Gedanken überschlugen sich. Der Anblick der Kuppel hatte ihn völlig unvorbereitet getroffen. Für eine Fata Morgana war die Vision zu scharf. Er hatte erwartet, ein paar Flachbauten und Parkplätze irgendwo im Nirgendwo zu sehen. Wenn überhaupt. Irgendetwas in der Art von Silicon Valley, wo sie diese Hochleistungscomputer herstellen. Aber eine riesige Glaskuppel? Er war sicher, dass dies die Enklave sein musste, von der so oft die Rede gewesen war. Eines der letzten Refugien der Menschheit und der Ort, zu dem es die Zeitspringer gezogen hatte. Doch was würden sie hier finden?
Das Ding sah tatsächlich aus wie die Smaragdstadt aus dem Zauberer von Oz. Vollkommen unwirklich und wunderschön.
Schlanke silberne Hochhäuser standen inmitten grüner Parks und Waldgebiete. Und natürlich gab es dort Menschen, irgendjemand musste diese Riesenkonstruktion ja am Laufen halten. Er meinte sogar, winzige Fahrzeuge zu erkennen, die im Inneren durch die Luft schwirrten. Eines war klar: So viele Pflanzen benötigten spezielle Bedingungen und ihn überkam die Erkenntnis, dass zumindest ihr Wasserproblem damit gelöst war. Doch was bedeuteten die beunruhigenden Worte der Squids in diesem Zusammenhang? Die riesenhaften Gestalten, auf die sie in der Sumpfzone gestoßen waren, hatten von einer Bedrohung gesprochen. Einem dunklen Geheimnis in der Wüste. Hatten sie etwa dieses wunderschöne schimmernde Ding gemeint? Welche Bedrohung sollte denn davon ausgehen? Jem dachte wieder an den Pakt, den sie mit den Squids ausgehandelt hatten. Ihr Leben und das der restlichen Passagiere von Denver gegen Informationen aus der grünen Enklave.
Sie verließen den Felsenberg und rannten hinunter in das Dünenmeer. »Meinst du, Lucie hat es geschafft?«, rief er nach vorne zu Zoe. »Es beunruhigt mich, dass wir sie nicht mehr eingeholt haben.«
»Mach dir nicht so viele Gedanken. Ihre Spuren führen genau in die Richtung. Vergiss nicht, sie hat eine knappe Stunde Vorsprung. Sie und Quabbel sind bestimmt längst in Sicherheit. Und jetzt komm. Diese Dinger sind mir echt unheimlich.«
Wie aufs Stichwort wurde das Surren hinter ihnen lauter. Jem warf einen gehetzten Blick über die Schulter. Er konnte sie zwar nicht sehen, aber dem Geräusch nach zu urteilen, waren die schwarzen Objekte gerade irgendwo zwischen den mächtigen Steintürmen unterwegs. Das Schwirren ihrer mechanischen Flügel hallte von den schroffen Felswänden wider.
Jem biss sich auf die Unterlippe. Mach dir nicht so viele Gedanken. Leichter gesagt als getan. Lucie hatte sich in letzter Zeit ganz schön verändert. Irgendwann hatte sie beschlossen, die Gruppe zu verlassen und alleine auf die Suche nach der Enklave zu gehen. War das wirklich ihre eigene Entscheidung gewesen oder hatte dieser Squid etwas damit zu tun? So viele Fragen und so wenig Zeit.
Ein Schatten raste über den Sand auf ihn zu. Das Surren schwoll zu einem Kreischen an.
Jem fuhr herum.
Eines der Dinger befand sich direkt hinter ihnen. Es war jetzt so nah, dass Jem Einzelheiten erkennen konnte. Es waren wirklich Maschinen. Drohnen. Allerdings anders als die, die er von zu Hause kannte. Das Ding maß etliche Meter und verfügte über ein bösartig leuchtendes rotes Auge direkt auf der Stirnseite. Statt mit Propellern wurde es durch mehrere Paare libellenartiger schwarzer Flügel in der Luft gehalten. Sie peitschte den Wind und verwirbelte den Sand zu gelben Staubfontänen.
Jem wollte Zoe eine Warnung zurufen, als er eine weitere Drohne über dem Dünenkamm vor ihnen auftauchen sah. An ihrer Unterseite ging eine Klappe auf, aus der ein ballonförmiges Objekt hervortrat.
»Achtung, Zoe, vor dir! Augen geradeaus!«
Zu spät. Ein Knall ertönte und ein schwarzer Blitz zischte auf sie zu. Er entfaltete sich, wurde groß und transparent.
Jem spürte, wie ihn das fein geflochtene Gewebe traf, wie es ihn von den Füßen hob und er meterweit in den Sand geschleudert wurde.
Ein Netz. Ein gottverdammtes Fangnetz!
Eine Wolke aus Staub und engmaschigen Schnüren hüllte ihn ein, raubte ihm die Sicht und den Atem. Er versuchte, sich zu befreien, doch das führte nur dazu, dass er sich noch mehr in dem zähen Gewebe verstrickte. Wie eine Fliege, die einer Spinne in die Falle getappt war. Er schrie und strampelte, doch genauso gut hätte er versuchen können, sich aus einer Zwangsjacke zu befreien. Nach einer Weile gab er auf. Er musste sich wohl oder übel eingestehen, dass ihre Reise hier zu Ende war.
Sayonara, muchachos!
Hasta la vista, baby.
Game over.
Sie waren Gefangene dieser verdammten Maschinen!
2
Ssssie haben Kontakt. Die Enklave hat ssssie gefunden.
Ist Mmmmeldung verlässlich?
Wurde ssssoeben bestätigt. Erst ROT und DUNKEL, jetzt Rest. Alle gefangen.
Dann nnnnichts mmmmehr für ssssie tun. Beobachten und auf Mmmmeldung warten.
Hoffen, dass ihnen nnnnichts zustößt.
3
Marek trat fester aufs Gaspedal. Mit einem Heulen fegte der Bus durch die Wüste. Das Pferd gab ein ängstliches Wiehern von sich, während Katta sich auf dem Beifahrersitz zusammenkauerte und nach draußen starrte.
Er konnte es immer noch nicht fassen. Sein Plan war wirklich aufgegangen. Der Gode würde stolz auf ihn sein. Wie einen Helden würden sie ihn in Niflheim willkommen heißen. Er – Marek – war der Einzige, der den Mut gehabt hatte, den Auftrag zu Ende zu führen. Der Einzige, der sich getraut hatte, in die glutheiße Hölle zu steigen, gegen die monströsen Squids zu kämpfen, den Verrätern den Bus unter dem Hintern zu stehlen und sie ihrem Schicksal zu überlassen. Und als krönenden Abschluss hatte er auch noch Katta entführt. Das war umso wichtiger, denn sie würde seine Heldentat bezeugen. Er hatte den Bus, er hatte das Mädchen, jetzt würde er seine Belohnung einstreichen. Marek hatte Nimrods Ehre gerettet und seinen guten Namen wiederhergestellt, und das würde sich der Gode einiges kosten lassen.
Marek war es noch immer unerklärlich, warum es seinen ehemaligen Freunden so wichtig war, diese bescheuerte Enklave zu finden. Hingen sie so an ihrer alten Welt, dass sie nicht erkannten, welche Chancen sich ihnen in der Zitadelle boten? Oder war es die lächerliche Hoffnung, doch noch in ihre Zeit zurückkehren zu können?
Marek wusste, dass es keine zweite Chance gab. Sie waren hier gefangen. Und in dieser neuen Welt zählte nur eines: der Kampf ums Überleben.
Nachdem er die sandigen Verwehungen hinter sich gelassen hatte, konnte er endlich richtig Gas geben. Wind wehte ihm ins Gesicht und vertrieb die letzten Gedanken an seine ehemaligen Freunde. Die Erinnerung an sie verblasste mit jedem zurückgelegten Meter. Hätte er jetzt noch ein bisschen coole Musik, der Tag wäre perfekt.
Doch statt Musik drang ein komisches Surren an seine Ohren. Wie das Summen eines gigantischen Bienenschwarms. Besorgt blickte er auf das Armaturenbrett. War etwas mit dem Motor nicht in Ordnung? Die Instrumente ließen nichts erkennen. Vorsichtshalber nahm er den Fuß vom Gas. Das Geräusch blieb unverändert. Es wurde sogar noch etwas lauter. Katta drehte ihren Kopf nach hinten und schrie.
Marek fuhr herum … »Himmel!«
Hinter dem Bus schwebte ein gewaltiges schwarzes Ding. Eine Drohne.
Schimmernd. Kantig. Gefährlich.
Ihre Flügelspannweite mochte vier oder fünf Meter betragen. Das Sonnenlicht spiegelte sich auf der schwarzen Oberfläche. Eine Ausgeburt der Hölle.
Marek trat aufs Gas und blickte dabei in den Rückspiegel.
Das Ding gewann an Höhe und nahm mit einem bösartigen Dröhnen die Verfolgung auf. In diesem Moment ertönte eine donnernde Stimme. »Stopp! Sofort anhalten. Sie befinden sich in einem Sperrgebiet. Halten Sie sofort an!«
Was zur Hölle war das? Woher kam diese Stimme?
In einem Anflug von Panik trat er das Gaspedal bis zum Boden durch. Der Motor kreischte auf. Der Bus brach aus und fing an zu schlingern. Sandige Verwehungen auf der Straße machten das Lenken unmöglich. Marek merkte, dass er die Spur nicht länger halten konnte.
»Pass doch auf, du Idiot!« Kattas Gesicht war kreidebleich. Sie klammerte sich an den Türgriff. »Du wirst uns noch umbringen!«
Marek hatte keine Zeit für ihr Gezeter. Er riss das Lenkrad nach rechts und versuchte, den Bus zu stabilisieren. Die Hinterräder wirbelten eine gewaltige Staubfontäne auf. Offenbar verwirrte der Sand die Sensoren der Drohne, denn für einen Moment hatte Marek das Gefühl, sie abgeschüttelt zu haben. Sie musste ausweichen, wurde dabei langsamer und verschwand aus seinem Blickfeld.
»Drecksvieh«, fluchte Marek und hielt weiter den Fuß nach unten gedrückt. Auf keinen Fall durfte er jetzt langsamer werden. Doch er hatte sich zu früh gefreut.
»Sofort anhalten oder wir machen von der Waffe Gebrauch.«
Mit Sorge sah Marek, wie die Drohne aus der Staubwolke heraus auf ihn zugefegt kam. Ihre Flügel verwirbelten den Sand zu riesigen Spiralen.
Noch einmal versuchte Marek den Trick mit dem Hakenschlagen, doch diesmal war das Ding vorbereitet. Es zischte nach links, beschleunigte und zog dann an ihnen vorbei. Marek konnte den Wind spüren, als die Drohne über sie hinwegdonnerte.
Etwa hundert Meter vor ihnen wendete sie und blockierte die Straße. Eine gewaltige Staubwolke wirbelte unter ihren Flügeln auf. Aus ihrer Schnauze zuckten Lichtblitze, gleichzeitig ertönte ein hässliches Knattern.
Staubfontänen spritzten quer über die Fahrbahn.
»Mein Gott«, stammelte Marek. »Ein … ein Maschinengewehr. Die Schweine schießen auf uns.«
Ungebremst raste er auf den schwarzen Albtraum zu. Auf keinen Fall würde er jetzt klein beigeben.
Die Drohne wich keinen Meter zur Seite.
Um einen Zusammenprall zu verhindern, riss Marek in letzter Sekunde das Lenkrad herum, verließ die Piste und donnerte seitlich die Düne hinauf. Die Katastrophe war unausweichlich. Marek hörte das panische Wiehern des Pferdes, dann spürte er, wie das Fahrzeug immer mehr in Schieflage geriet. Einen atemlosen Moment schien es in der Luft zu schweben, dann kippte es um. Der Boden raste auf sie zu. Mareks Hände krampften sich um das Lenkrad. Gleich würden sie aufschlagen.
Fünf Meter … drei …
Eine furchtbare Erschütterung fuhr durch ihn hindurch. Sand wurde aufgewirbelt. Er hörte das Kreischen von Metall, ein dumpfes Krachen, dann wurde es schwarz um ihn.
4
Das Glas war zwei Zentimeter dick und hatte einen grünlichen Schimmer. Das Untersuchungszimmer dahinter war hell beleuchtet. So hell, dass Emilia einen Moment brauchte, bis sich ihre Augen daran gewöhnt hatten. Im Glas sah sie ihr eigenes Spiegelbild. Dunkelbraune Kurzhaarfrisur, helle Haut mit Sommersprossen und leicht abstehende Ohren. Sie fand sich selbst nicht besonders hübsch und war deswegen immer wieder erstaunt zu erfahren, dass Jungs sie offensichtlich recht attraktiv fanden. Bisher hatte sie aber noch keines der Angebote wirklich gereizt. Dafür wartete viel zu viel Arbeit auf sie.
Jenseits der Scheibe existierten keinerlei Schatten. Es war eine Welt aus Weiß. Weißer Boden, weiße Wände, weiße Decke. Wissenschaftler in weißen Overalls, die um eine Vorrichtung aus weißem Plastik, Chrom und Stahl versammelt standen. Mit Ganzkörperanzügen, die luftdicht verschlossen und mittels Schläuchen an die externe Sauerstoffversorgung angeschlossen waren.
Die medizinische Abteilung gehörte nicht zu ihrem Aufgabenbereich. Sie war in der Abteilung Kommunikation und Überwachung tätig. Doch als ihre Freundin Sara gefragt hatte, ob sie mal einen Blick auf einen der Neuankömmlinge werfen wollte, war Emilia natürlich Feuer und Flamme gewesen. Einen Code Red, wann hatte es das das letzte Mal gegeben? Nicht, solange sie sich erinnern konnte.
Das rothaarige Mädchen war auf den Untersuchungstisch festgeschnallt. Ihre Augen hatte sie geschlossen, Unterarme, Hals und Schultern waren von der Sonne gerötet.
Emilia hörte ein Geräusch und drehte sich um. Sara hatte den Überwachungsraum betreten. Die dunklen Haare zu einer unordentlichen Frisur verwuschelt, die Brille etwas schief auf der Nasenspitze, sah sie aus, als wäre sie gerade in einen Wirbelsturm geraten.
»Da bist du ja endlich«, sagte Emilia. »Ich dachte, du kommst nicht mehr.«
»Bitte entschuldige, bin gerade etwas im Stress. Ich musste noch kurz nach den anderen sehen. Befehl von Provost.«
»Und wie geht’s ihnen?«
»Scheinen so weit alle okay zu sein. Sind natürlich noch etwas sauer wegen der Drohnen, aber sie werden schon darüber hinwegkommen. Wir mussten schließlich sichergehen, dass sie sich in ihrer Panik nicht noch selbst verletzen. Wie geht es denn unserer rothaarigen Freundin hier?«
»Woher soll ich das wissen, du bist doch die Ärztin.«
Sara tippte auf ein Display, das im unteren Teil des Glases eingelassen war, und studierte die Messwerte.
»Nun, zumindest ist sie am Leben. Angesichts ihres schlechten gesundheitlichen Zustands ist das ein kleines Wunder. Sie stand kurz vor dem Verdursten. Wir halten sie noch ein bisschen im künstlichen Koma und zeichnen ihre Gedankenströme auf, bis wir wissen, was mit ihr los ist.«
»Bis wir wissen, was mit ihr los ist?« Emilia runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht ganz …«
»Nun, immerhin ist sie ein Outlander«, sagte Sara. »Diese Menschen sind uns völlig fremd. Weder haben wir eine Ahnung, wo sie herkommen, noch, wie sie hierhergelangt sind. Ganz zu schweigen von der Frage, was sie hier wollen.«
»Weck sie doch auf und frag sie.«
Sara blickte sie ernst an. »Dagegen dürfte unsere Ratsvorsitzende große Einwände haben. Vor allem angesichts der besonderen Umstände.«
»Was denn für Umstände?« Sara liebte es, in Rätseln zu sprechen. Das hatte sie schon immer gerne getan. Aber heute fand es Emilia besonders nervig.
»Moment mal …« Sara hob die Brauen. »Heißt das, du weißt es noch gar nicht?«
»Was wissen?«, protestierte Emilia. »Mir sagt ja niemand etwas. GAIA nicht, Rogers nicht und am wenigsten du.«
»Oh. Wenn das so ist …« Sara blickte sich um, als habe sie Angst, man könne sie belauschen. »Ich weiß gar nicht, ob ich dir das dann überhaupt verraten darf …«
»Seit wann haben wir denn Geheimnisse voreinander?«, erwiderte Emilia empört. »Los jetzt, raus mit der Sprache oder du kannst sehen, von wem du dir ein Kleid für die Party morgen leihst.« Emilia versuchte zu lächeln, aber irgendwie wollte es nicht so recht klappen.
Sara knabberte an ihrer Unterlippe. »Du musst mir aber versprechen, dass du es für dich behältst, okay?«
»Jetzt mach’s doch nicht so spannend.«
»Es geht um den Squid.«
Emilia runzelte die Stirn. Die Erwähnung ihrer Todfeinde erstickte die heitere Stimmung im Keim. »Was denn für ein Squid?«
»Den man bei ihr gefunden hat. Wenn du ganz genau hinschaust, kannst du ihn sehen. Komm hier herüber.« Sie winkte sie zu sich.
Emilia trat neben Sara und schaute durch die Scheibe. Sie war so nahe am Glas, dass sie es mit ihrer Nasenspitze berührte.
»Siehst du ihn? Unter ihrer linken Achselhöhle.«
Emilia kniff die Augen zusammen. Und dann sah sie es. Sie hatte es anfangs nur für einen Schatten gehalten, doch jetzt bemerkte sie ein ungewöhnliches Muster. Sie hatte ganz vergessen, wie gut sich diese Dinger tarnen konnten. Ein Gefühl von Grabeskälte kroch ihr den Rücken herauf.
»Ich will verdammt sein …«
»Wir fanden ihn während der Hauptuntersuchung. Stell dir das mal vor: Sie trug ihn unter ihrer Kleidung. Direkt auf der Haut.«
»Was?« Der Gedanke ließ Emilia vor Ekel zusammenzucken. Sie musste an das kalte, gummiartige Fleisch denken, an die Saugnäpfe und die krallenförmigen Haken. Noch nie hatte sie einen lebenden Squid gesehen. Immer nur tote Exemplare, die von den Außenteams von irgendwelchen Streifzügen mitgebracht worden waren. Die Expeditionen ins Outer Rim waren gefährlich, vor allem, wenn man die lebensfeindliche Wüste verließ und ins Steppenland vordrang. Die Aufklärer berichteten immer wieder von massiven Angriffen wilder Bestien, die die Fahrzeuge im Nu wieder zurück in die Wüste drängten. Und jetzt hatten sie also wirklich und wahrhaftig einen lebenden Squid hier. Das war unglaublich.
Sie schauderte.
»Was macht der denn da?«
»Schutz suchen, vermutlich. Die Messströme unserer Enzephalogramme zeigen, dass die beiden in engem geistigem Kontakt stehen. GAIA hat Order gegeben, sie noch nicht voneinander zu trennen. Erst müssen wir wissen, ob der Squid nur ein Parasit ist oder ob das Mädchen die Symbiose freiwillig eingegangen ist. Vielleicht verstehst du jetzt, warum ich dir dieses Versprechen abnehmen musste.«
»Allerdings …«
Emilia war fassungslos. »Sieht aus wie ein Jungtier.«
»Ist es auch. Seine psychoaktiven Nervenzellen sind aber bereits voll ausgebildet.«
»Und dieses rothaarige Mädchen hat zugelassen, dass er einfach so an ihr dranklebt? Sie muss nicht bei Verstand sein.«
»Das werden wir erst erfahren, wenn sie wieder wach ist«, sagte Sara.
Emilia schüttelte den Kopf. Sie verstand einfach nicht, wie jemand freiwillig so etwas zulassen konnte. Kontakt mit einem Squid. Wieder schauderte sie. Eigentlich sah das Mädchen ganz normal aus.
»Ich denke nicht, dass sie es freiwillig getan hat«, sagte sie. »Das Biest muss sie gegen ihren Willen übernommen haben. Das ist doch ihre Art, oder?«
»Dafür spräche zumindest, dass wir sie gar nicht voneinander losbekommen. Der Squid hat sich richtig an ihr festgesaugt.«
Emilia versuchte, sich vorzustellen, wie wohl die nächsten Schritte aussehen würden. »Was, wenn sie erwacht?», fragte sie. »Was, wenn sie erfährt, dass ihr ihre Gedankenströme aufgezeichnet habt? Wird sie nicht furchtbar wütend sein?«
»Keine Sorge, sie wird sich an nichts erinnern«, sagte Sara. »Unser Benzodiazepin wirkt ziemlich gut. Viel schwieriger ist, was wir ihren Freunden erzählen, wenn sie nach ihr fragen. Ganz eindeutig gehören sie zusammen, auch, wenn uns noch nicht ganz klar ist, wieso sie getrennte Wege gegangen sind. Aber all das wird sich aufklären. Ich denke, der Grund dafür dürfte ebenfalls der Squid sein. Wir müssen einfach Geduld haben.«
In diesem Moment ging die Tür auf. Lieutenant Rogers betrat den Raum. Emilias Vorgesetzter befand sich in Begleitung von drei Mitarbeitern des Außenteams. Alle drei waren in Kampfmontur und schwer bewaffnet. Als er die beiden jungen Frauen sah, nickte er erleichtert. »Da sind Sie ja. Ich habe Sie schon überall gesucht. Kommen Sie, es wartet Arbeit auf Sie.«
Sara neigte den Kopf. »Was denn, wir beide?«
»So lauten meine Anweisungen.«
»Aber ich kann hier nicht weg«, protestierte Sara. »Die junge Frau könnte jeden Moment erwachen. Ich sollte …«
»Professor Provost hat mir die Erlaubnis persönlich erteilt. Er hat Sie für den Vormittag freigestellt. Es ist wichtig, dass jemand vom medizinischen Personal mit an Bord ist. Kommen Sie.«
»Um was geht es denn?«, fragte Emilia. »Ist irgendetwas vorgefallen?«
Lieutenant Rogers war eine beeindruckende Erscheinung. Dichtes Haar, hohe Wangenknochen, ein markantes Kinn. Das Ergebnis erstklassigen Erbguts. Als er lächelte, konnte man seine Grübchen sehen. »Kann man so sagen«, sagte er. »Wir haben den Bus gefunden.«
»Den Bus? Wo?« Emilia riss die Augen auf. Sie war diejenige gewesen, die das Fahrzeug als Erste auf ihrem Monitor gehabt hatte, ehe es wieder verschwunden war.
Sie hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben.
»Jenseits des Perimeters. Es war unterwegs in Richtung Norden. Der Fahrer hatte es wohl ziemlich eilig. Einer unserer Aufklärer ist zufällig auf den Bus gestoßen und hat versucht, ihn aufzuhalten. Dabei kam es zu einem Unfall. Beeilen Sie sich. Ziehen Sie Schutzkleidung an und dann ab zu Schleuse drei. Wir treffen uns dort in einer Viertelstunde.«
»Jawohl, Sir.« Emilia salutierte freudestrahlend. Ein Außeneinsatz, das wurde ja immer besser.
5
Marek keuchte vor Schmerz. Ein widerwärtiges Stechen durchzuckte seine Beine, stieg seine Hüfte empor und bohrte sich wie eine glühende Messerklinge in seinen Schädel. Selbst Atemholen war kaum noch möglich.
Wenn er sich ruhig verhielt, war es nicht ganz so schlimm, aber sobald er eine Bewegung ausführte – und war sie noch so winzig –, zuckte sofort der Schmerz sein Bein herauf.
Er befand sich im Dunkeln. Wie es aussah, lag der umgestürzte Bus meterhoch über ihm. Marek war kurz bewusstlos gewesen, hatte den Unfall aber in allen Einzelheiten mitbekommen. Offenbar hatte sich eine der Haltestangen aus der Verankerung gelöst und lag jetzt quer und verbogen über seinem rechten Bein. Das war die Quelle des Schmerzes und Marek hatte keine Ahnung, was er dagegen tun konnte. Der Bus war mehrere Tonnen schwer. Obwohl er sich kaum bewegen konnte, spürte Marek, dass das Bein gebrochen war. Von dem anderen spürte er überhaupt nichts mehr.
Durch einen schmalen Spalt zwischen Sand und Karosserie fiel Licht. Immerhin schützte ihn der Bus vor der Sonne.
Einige Meter entfernt, sah er den Kopf seines Pferdes, halb vergraben im Sand. Roans linkes Auge starrte leblos zu ihm herüber. Es war unübersehbar, dass sein treuer Begleiter den Sturz nicht überlebt hatte. Roan hatte es hinter sich.
Anfangs war Marek noch auf Finns Stute unterwegs gewesen, doch als er seinen geliebten Roan wiedergefunden hatte, war er zu ihm zurückgewechselt und hatte die Stute laufen lassen. Pech für den Hengst. Jetzt war er tot, während Finns Stute vermutlich ihre neu gewonnene Freiheit genoss. So konnte es manchmal gehen.
Schaudernd wandte Marek sich ab.
Und wo war Katta? Von ihr hatte er bisher weder etwas gehört, noch gesehen. Sie musste bei dem Überschlag aus dem Beifahrersitz in die Wüste geschleudert worden sein. Ob sie noch lebte?
»Katta?« Seine Stimme war schwach und er bekam keine Antwort. Noch einmal. »Katta?«
Nur der Wind antwortete.
Es war sinnlos. Vermutlich hatte sie sich bei dem Sturz das Genick gebrochen und war jetzt mausetot.
Marek schniefte. Das war also das Ende.
Eine neue Schmerzwelle brandete über ihn hinweg. Er hielt die Luft an, zählte im Geiste mit und wartete, bis es wieder besser wurde. Er versuchte, den Sand unter seinem Körper mit den Händen beiseitezuschaufeln, merkte aber sehr schnell, dass das nichts brachte. Er rutschte einfach immer wieder nach. Allmählich wurden die Schmerzen unerträglich. Ihm rannen die Tränen über die Augen. Doch weniger wegen der Schmerzen als wegen der Ausweglosigkeit seiner Situation.
So eine verfluchte Scheiße, dachte er noch, dann schwanden ihm die Sinne.
6
Der Bus lag zerschrammt und verbeult auf der Seite. Ein Fahrzeug, wie es früher viele gegeben haben musste. Mit abgefahrenen Reifen und einer ölverschmierten Unterseite, die es der Sonne entgegenstreckte. Emilia konnte kaum glauben, dass die Outlander mit diesem Ding unterwegs gewesen waren.
Während zwei Mitglieder des Außenteams aufmerksam die Umgebung im Auge behielten, war Rogers an den Bus herangeschlichen und klopfte mit dem Kolben seines Gewehrs gegen die Karosserie.
Emilia lauschte.
Nichts.
Er winkte die beiden jungen Frauen zu sich. »Das hat wohl niemand überlebt. Sehen Sie sich ruhig ein bisschen um, aber fassen Sie nichts an. Das Metall ist glühend heiß.«
»Lieutenant!«
Der Mann auf der anderen Seite des Busses winkte aufgeregt. »Kommen Sie mal hierher. Ich glaube, ich habe einen von ihnen gefunden. Er scheint noch am Leben zu sein.«
Sofort waren sie drüben auf der anderen Seite. Emilia spürte, wie der Sand an ihren Füßen zerrte. Als wäre er ein lebendiges Wesen, das danach trachtete, sie zu verschlingen.
Als sie den grünen, fellbedeckten Rücken neben der zerschundenen Karosserie aufragen sah, stutzte sie. »Was ist denn das?«
»Sieht aus wie ein Pferd«, sagte Sara. »Offenbar ist es von dem Gewicht des Fahrzeugs niedergedrückt worden.«
»Seien Sie mal still«, erwiderte Rogers. »Ich glaube, ich höre etwas. Es kommt von da unten.« Er spähte in den schmalen Spalt am Boden des Fahrzeugs. Kopfschüttelnd richtete er sich auf. »Versuchen Sie mal Ihr Glück, Emilia. Sie sind etwas kleiner als ich.«
Emilia ging auf die Knie und spähte unter die Karosserie. »Sie sagten, Sie hätten etwas gehört?«
»Ja«, entgegnete er. »Klang, als habe jemand gehustet.«
Emilia konnte auch nichts erkennen, doch dann fiel ihr etwas ein. »Kann ich mal deine Taschenlampe haben, Sara?«
»Klar, hier.«
Sie hielt den Lichtkegel in den Spalt und sah lediglich einen Haufen verbogenes Metall. »Hallo, ist da jemand? Können Sie mich hören?«
»J…ja.«
Eine Stimme. Leise, aber verständlich.
Emilia kniff die Augen zusammen und schob ein paar Handvoll Sand zu Seite. War das ein blonder Haarschopf?
»Hallo, sind Sie verletzt? Können Sie in meine Richtung kriechen?«
»Keine Chance«, antwortete die Stimme. »D…da liegt etwas auf mir. Eine Stange. Ich g…glaube, meine Beine sind gebrochen. Bitte helfen Sie mir.«
»Wir werden es versuchen. Ist da noch jemand bei Ihnen?«
»Ja … nein. Ich weiß nicht. Katta … sie war vorhin noch hier, aber jetzt ist sie weg.«
»In Ordnung. Wir haben eine Ärztin hier, die wird sich gleich um Sie kümmern. Bewegen Sie sich nicht.«
Emilia kroch wieder aus dem Loch heraus und gab Sara ihre Taschenlampe zurück. »Ich denke, wir müssen den Bus umdrehen. Kriegen wir das hin?«
Rogers prüfte die Karosserie, dann nickte er. »William, bringen Sie mal das Hovercraft her. Ich werde derweil nach Stellen suchen, an denen wir die Stahlseile verankern können. Und der Rest von euch: Verteilt euch auf die umliegenden Hügel und haltet nach Eindringlingen Ausschau. Auch in der Wüste gibt es feindselige Biester. Ich habe keine Lust, in einen Hinterhalt zu geraten.«
Emilia klopfte den Sand von ihrem Overall. »Der Mann erwähnte eine zweite Person. Katta. Ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht unter dem Bus liegt. Mit Ihrer Erlaubnis würden Sara und ich gerne die Umgebung absuchen.«
»Machen Sie das. Sara, Sie brauche ich dann später wieder hier, um nach dem Verletzten zu sehen. Und seien Sie vorsichtig, verstanden? Entfernen Sie sich nicht zu weit von unserer Position. Die Wüste ist ein tödlicher Ort.«
Emilia nickte. »Machen wir. Komm, Sara.«
Gemeinsam stapften sie die westlich gelegene Düne empor.
Als sie oben ankamen, breitete sich eine wüste, leere Ödnis um sie herum aus. Wohin man blickte, Sand, Steine und glühende Hitze.
In etwa zwei Kilometern Entfernung erhoben sich einige steile Felszinnen. Dort hatten die Drohnen den dunkelhäutigen Jungen und das schwarzhaarige Mädchen eingefangen. Es war erstaunlich, dass sie so weit gekommen waren. Emilia war jetzt schon aus der Puste.
»Atemberaubend, oder?« Saras Augen glänzten. »Diese Weite, diese Helligkeit. Wunderschön. Hier draußen ist alles pur und ungefiltert.«
»Du hast eine merkwürdige Vorstellung von Schönheit, weißt du das?«
Sara zwinkerte ihr zu. »Das müsste dir doch inzwischen bekannt sein. Ist lange her, dass ich in der Wüste war.«
»Bei mir auch, und das aus gutem Grund. Wir würden keinen halben Tag hier draußen überleben.«
»Diese Fremden haben weitaus länger überlebt«, sagte Sara. »Ohne Schutzkleidung, ohne Überlebenstraining und fast ohne Wasser.«
»Stimmt schon. Aber deswegen muss einem das hier ja nicht gefallen. Ich kenne jedenfalls niemanden außer dir, der der Wüste irgendetwas Positives abgewinnen kann. Komm, lass uns weitergehen.«
Ein erster Rundblick lieferte keine bemerkenswerten Ergebnisse. Weder hier oben noch auf der südlichen Seite. Dafür gab es unten in der Senke jede Menge Reifenspuren.
»Da drüben muss der Bus das erste Mal von der Straße abgekommen sein.« Emilia deutete auf die Stelle. Der Sand war dort ziemlich aufgewühlt. »Ich würde vorschlagen, dass wir mal nachsehen.«
»Einverstanden.«
Hinter ihnen nahm das Hovercraft seine Arbeit auf. Rogers’ Männer hatten Stahlkabel eingehängt und versuchten nun, den Bus wieder aufzurichten. Die Rotoren heulten auf. Eine gewaltige Staubwolke wurde emporgewirbelt. Emilia war froh, dass sie weit genug entfernt waren.
Wo die Reifenspuren von der Straße abwichen, war das Gelände ziemlich uneben. Tiefe Furchen durchzogen den Sand. In einiger Entfernung ragten die Stümpfe versteinerter Bäume in die Höhe.
Sie hatten etwa hundert Meter zurückgelegt, als Sara plötzlich den Hang hinaufrannte.
Emilia blieb stehen und sah ihr hinterher. »Was ist los? Hast du etwas gefunden?«
»Ich glaube, ja. Komm mal her und sieh dir das an.« Sie griff in den Sand und hob einen abgewetzten Schuh in die Höhe. Emilia betrachtete ihn von allen Seiten. »Merkwürdig«, sagte sie. »Nichts, was mit unseren Schuhen vergleichbar wäre. Und alt kann er auch noch nicht sein. Er riecht immer noch nach Leder.«
Sara hielt den Schuh an ihren eigenen Fuß. »Also, wenn du mich fragst, der stammt definitiv nicht von einem Kerl.«
»He, da drüben sind Fußspuren.« Emilia deutete nach oben. Eine schwache Spur zog sich den Hang hinauf.
»Worauf warten wir noch?« Saras Wangen glühten vor Aufregung. »Lass uns nachsehen.«
Oben angekommen, erblickten sie auf der anderen Seite eine Senke, in der Dutzende versteinerter Baumstümpfe herumstanden. Manche von ihnen waren so groß, dass fünf Mann sie nicht zu umspannen vermocht hätten. Ein ideales Versteck für jemanden, der nicht gefunden werden wollte. Ohne zu zögern, eilte Emilia die Düne hinab und fing an, systematisch die Baumstümpfe zu überprüfen. Der Wind frischte auf und blies ihr den Sand ins Gesicht. Wo steckte diese Katta nur?
Emilia war beim vierten Baumstumpf angelangt, als sie bemerkte, dass Sara ihr nicht gefolgt war. Sie stand immer noch oben auf der Düne und wedelte wie verrückt mit den Händen. Offenbar rief sie auch etwas, doch Emilia konnte es über das Heulen des Windes hinweg nicht verstehen.
Sie formte die Hände zu einem Trichter. »Nun komm schon«, rief sie. »Glaubst du, ich mache hier die ganze Arbeit alleine? Wenn wir uns aufteilen, kommen wir schneller voran. Setz dich endlich in Bewegung!« Sie unterstrich ihre Worte mit entsprechenden Gesten. Doch Sara schüttelte nur heftig den Kopf und schrie irgendetwas. »…ndlöcher!«
»Was?« Emilia hielt die Hände hinter ihre Ohren.
»Sandlöcher!«
Emilia sah sich um. Ja, da waren ein paar Erdtrichter, aber sie verstand die Aufregung nicht. Emilia hätte ohnehin einen Bogen um sie gemacht. Sie maßen etwa drei Meter im Durchmesser und waren einen Meter tief. Die Seitenwände sahen ziemlich rutschig aus. Wieso machte Sara deswegen so ein Theater?
Die Geräusche des Hovercrafts waren inzwischen leiser geworden. Offenbar war die Bergungsaktion beendet.
»Du stehst mitten in einem Termitenfeld.«
Emilia riss alarmiert die Augen auf. Aber natürlich!
Jetzt erkannte sie es auch. Wie hatte sie nur so leichtsinnig sein können? Was sie für versteinerte Baumstümpfe gehalten hatte, waren in Wirklichkeit Abluftanlagen für die unterirdischen Stollen der Riesentermiten. Und die Löcher, das waren Fanggruben.
»Scheiße.«
Trotz der Hitze kroch ihr ein Schauer den Rücken hoch. Sie traute sich kaum, sich zu bewegen, aber sie musste so schnell wie möglich hier weg. Termiten waren zwar keine Fleischfresser, dafür aber angriffslustige Monster, die den Außenteams in der Vergangenheit schon oft Probleme bereitet hatten. Dass Emilia nicht selbst darauf gekommen war, lag daran, dass sie viel zu selten hier draußen war.
Schritt für Schritt wich Emilia zurück. Die trichterförmigen Öffnungen schienen größer zu werden. Bloß keine Erschütterungen auslösen, dachte sie panisch. Die Biester reagierten sehr empfindlich auf Bewegung. In ihrer Vorstellung sah sie bereits hornige Antennen und Klauen aus den Löchern herausschießen. Aber vielleicht hatte sie ja Glück und es war ein verwaister Bau. Von denen gab es angeblich jede Menge hier in der Wüste.
Sie erreichte den Fuß der Düne und kletterte hastig den Hang hinauf. Als sie wieder oben war, ließ sie sich neben Sara zu Boden sinken. Von hier sah man sofort, dass es sich um ein Termitenfeld handelte. Sie war fertig mit den Nerven.
»Danke«, keuchte sie. »Danke, dass du mich gewarnt hast.«
»Alles in Ordnung mit dir?« Sara sah sie ernst an.
»Alles okay. Aber ich könnte mir in den Hintern treten, dass ich das nicht eher gesehen habe. Dabei wollte ich doch nur diese Katta finden …«
»Das können wir wohl vergessen«, sagte Sara düster. »Wenn sie in eines dieser Löcher gefallen ist, hat sie keine Überlebenschance. Die Viecher fressen zwar selbst kein Fleisch, aber sie töten Menschen und benutzen dann ihr organisches Material, um tief in ihren Stollen Pilze zu züchten, von denen sie sich ernähren. Letztlich kommt es also aufs Gleiche raus.« Sie verzog angewidert das Gesicht. »Falls sie also hier war, ist sie längst Futter für die Krabbler geworden.«
Emilia presste die Lippen zusammen. Sie wollte noch etwas sagen, als sie aus der Ferne Maschinengewehrfeuer hörte.
Das Geräusch riss sie aus ihren Gedanken.
Sie sprang auf. »Was ist da los?«
»Klingt nach einem Angriff«, rief Sara, die schon losgelaufen war. »Vermutlich die üblichen Schlangen und Riesenskorpione. Mit denen werden unsere Kämpfer spielend fertig. Trotzdem sollten wir nachsehen. Komm.« Mit diesen Worten rannte sie die Düne hinab.
Emilia blickte zurück in die Senke. Sara hatte recht. Die Wüste mochte auf eine gewisse Art schön sein, sie war jedoch ein tödlicher und lebensfeindlicher Ort. Hier gab es nichts mehr zu holen. Sollte die Vermisste tatsächlich hier entlanggekommen sein, war sie längst tot.
7
Katta wusste nicht, wie lange sie schon hier war. Ihre Kehle war ausgetrocknet. Sie sehnte sich nach einem Schluck Wasser.
Die Luft hier unten im Loch war schwül und stickig.
Hatte sie etwa geschlafen? Sie meinte, sich zu erinnern, irgendwelche Rufe gehört zu haben. Frauenstimmen. Es war aber auch möglich, dass sie das nur geträumt hatte.
Wo waren ihre Freunde, wo war Leòd?
Sie sah sich um. Von oben drang gedämpftes Licht in die Höhle. In der Decke war eine Öffnung, durch die Sand herabrieselte. Er hatte einen Haufen gebildet, der ihren Sturz abgefangen hatte.
Durch die schmale Öffnung sah sie einen winzigen Ausschnitt des Himmels. Das Dämmerlicht ermöglichte ihr, sich ein bisschen zu orientieren, aber wirklich viel erkennen konnte sie nicht.
»Hallo?«, rief sie zaghaft.
Sie lauschte, doch außer ihrem Echo kam keine Antwort.
Es gruselte sie bei der Vorstellung, dass irgendjemand Nichtmenschliches ihre Rufe gehört haben könnte.
Mann, sie steckte ganz schön in der Scheiße. Marek hatte sie entführt. Es war ihr ein Rätsel, was in seinem Kopf vorging. Wie hatte sie ihn nur irgendwann mal nett, ja sogar attraktiv finden können? Ein anderes Leben, ein anderer Marek. Dieser hier hatte Augen, in denen ein wahnsinniges Feuer loderte.
Er war ihnen gefolgt, hatte Leòd niedergeschlagen, sie entführt und war dann losgefahren. Ohne auf die anderen zu warten! Er hatte tatsächlich vorgehabt, sie ihrem Schicksal zu überlassen, oder? Wie kaltblütig war das denn?
Und jetzt saß sie in diesem Drecksloch, in das sie auf ihrer Flucht gestürzt war. Hierbleiben konnte sie nicht, sie musste wieder raus. Sie stand auf und humpelte herum. Ihr Fuß hatte bei dem Unfall etwas abbekommen. Der Knöchel war dick und brannte wie Feuer. Aber im Großen und Ganzen hatte sie noch Glück gehabt. Es hätte für sie alles noch viel schlimmer ausgehen können. Nachdem sie aus dem Bus geschleudert worden war, hatte sie sich unter Schmerzen durch die Wüste geschleppt. Es war ihr egal gewesen, was mit Marek geschah. Das hatte er sich selbst zuzuschreiben.
Die Frage war nur, wie sie jetzt wieder aus dem Loch kam. Allzu schwierig sah das nicht aus, immerhin reichte der Sandhaufen fast bis unter die Decke. Einfach hochsteigen, aus dem Loch kriechen und dann den Trichter hinauf. Easy.
Doch sie merkte schnell, dass es viel einfacher aussah, als es war. Kaum war sie ein paar Meter hinaufgeklettert, geriet der Sand ins Rutschen und trug sie wieder bergab.
Vielleicht, wenn sie Anlauf nahm. Nicht ganz einfach mit ihrem Knöchel, aber sie musste es wenigstens versuchen.
Sie ging ein Stück zurück, konzentrierte sich und humpelte dann im Eiltempo los. Ihr Fuß brannte höllisch, aber sie biss die Zähne zusammen. Die ersten Meter glaubte sie noch, ihr Plan würde aufgehen, doch je weiter sie nach oben kam, desto mehr rutschte der Sand nach. Irgendwann verließen sie die Kräfte und sie rutschte wieder ab.
Es war zum Verzweifeln.
Wütend presste sie die Lippen aufeinander. Das konnte doch nicht so schwierig sein! Sie versuchte es noch einmal. Diesmal mit einer anderen Strategie. Vielleicht war der Fehler gewesen, so hinaufzustürmen. Der Sand war dadurch zu sehr in Bewegung geraten und hatte sie wieder hinabgetragen. Wenn es ihr gelang, keine Erschütterungen zu erzeugen, klappte es vielleicht besser. Sie ging in die Hocke und verteilte dann ihr Gewicht gleichmäßig auf Hände und Füße. Dann setzte sie sich in Bewegung. Rechte Hand, linker Fuß, linke Hand, rechter Fuß.
Das Ergebnis war niederschmetternd. Sie kam nicht mal ansatzweise so hoch wie bei den ersten Malen.
Tränen stiegen ihr in den Augen. Schluchzend rutschte sie hinab und blickte sehnsüchtig nach oben.
Es gab kein Entkommen. Sie war gefangen. Eingesperrt in dieser unheimlichen Höhle.
8
Jem zog den Reißverschluss seines Overalls hoch, prüfte die Armlänge und strich den Stoff glatt. Dann betrachtete er sich im Spiegel. Das Ding saß wie angegossen, war ultraleicht und sah dabei noch richtig cool aus. Dunkelrot mit dünnen weißen Streifen an den Ärmeln sowie innen liegenden Taschen. Fast wie ein Formel-1-Anzug. Auch die neuen Schuhe waren ein Traum. Sneaker, aus irgendeinem Mikrofaserstoff und mit Sohlen, die so weich waren, dass man beim Gehen kaum ein Geräusch erzeugte. Fast jeder hier in der Kuppel trug diese Anzüge, die es in allen möglichen Farben und Schnitten zu geben schien. Aus den Lautsprechern drang leise, beruhigende Klaviermusik. Olivia, Arthur, Leòd, Ragnar, Nisha, Zoe und Paul saßen drüben vor dem Panoramafenster und unterhielten sich leise. Sie sahen total ungewohnt aus in diesen Anzügen, aber irgendwie auch total lässig. Besonders Leòd und Ragnar, die sich in ihrer Haut gar nicht wohlzufühlen schienen.
Jem musste daran denken, wie sie hier eingetroffen waren. Schmutzig, durstig, vollkommen fertig. Er war während der Fahrt im Hovercraft immer wieder eingenickt, sodass ihm einige Teile seiner Erinnerung fehlten. Er wusste aber noch, wie beeindruckt er gewesen war, als er zum ersten Mal das Innere der Biosphäre gesehen hatte. Die funkelnden Hochhäuser, die grünen Parks und breiten Prachtboulevards – es war der Wahnsinn. Alles wirkte so sauber und frisch. Kein Dreck, keine verschmutzte Luft. Weder Staub noch Gestank noch Lärm. Ein leichter Wind war spürbar gewesen, der nach Blumen und Blüten roch. Den üblichen Großstadtlärm gab es hier nicht. Stattdessen ertönten Musik, Gelächter und das Summen Tausender elektrisch betriebener Geräte. Es klang fast wie in einem Bienenstock.
Leider war der Eindruck nur von kurzer Dauer gewesen, denn sie waren geradewegs in eines dieser Hochhäuser gebracht und dort mit einem Aufzug in eine der höheren Etagen transportiert worden. Hier befand sich eine Art medizinisches Zentrum, wo man sie von Kopf bis Fuß untersucht hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Jem bereits so müde gewesen, dass er von der eigentlichen Untersuchung kaum noch etwas mitbekommen hatte. Danach hatte er geschlafen und beim Aufwachen diese coolen Klamotten vorgefunden.
Inzwischen waren alle wieder wach.
Es klopfte an der Tür. Sie ging auf und Sara, die junge Ärztin, betrat den Raum. Sie war in Begleitung einer zweiten jungen Frau. Genau genommen, schienen die beiden kaum älter als Jem und seine Freunde zu sein. Sara hatte ihnen erzählt, dass sie sich noch in der Ausbildung befand. Sie hatte Jem und den anderen während der Aufwachphase zur Seite gestanden. Jem mochte sie. Sie war herzlich und hatte eine positive Ausstrahlung.
Die andere trug Uniform und war einen halben Kopf größer. Sie hatte eine strenge Kurzhaarfrisur, die der von Zoe glich, war aber ansonsten ein komplett anderer Typ. Helle Haut, Sommersprossen, graue Augen. Eine echte Schönheit.
Sara schloss die Tür und kam lächelnd zu ihnen herüber. »Hallo zusammen«, sagte sie. »Freut mich zu sehen, dass ihr alle wieder wach und munter seid. Gut geschlafen, gefallen euch die Sachen?«
»Sehr bequem«, antwortete Jem. »Man hat das Gefühl, kaum etwas am Leib zu tragen.«
Sara nickte. »Das ist ja auch Sinn der Sache.« Dann erhob sie ihre Stimme. »Und jetzt möchte ich euch jemanden vorstellen. Das ist meine Freundin Emilia. Sie arbeitet in der Abteilung Außenüberwachung und Verteidigung. Sie ist diejenige, die euch auf dem Monitor entdeckt hat. Wenn ihr also jemandem für euer Überleben danken wollt, dann ist sie die Richtige.«
»Echt?«, fragte Jem. »Danke!«
Auch die anderen bedankten sich und Jem fiel auf, dass Emilia ein bisschen rot wurde. Sie wirkte sehr sympathisch.
»Schön«, sagte Sara. »Emilia und ich werden für die nächsten Tage eure Betreuerinnen sein. Wir sorgen dafür, dass ihr euch gut bei uns einlebt, dass ihr euch wohlfühlt und es euch an nichts mangelt. Wenn ihr also ein Problem habt oder etwas braucht, wendet euch an uns.«
Emilia räusperte sich und trat einen Schritt vor. Ihre Stimme war dunkler, als Jem vermutet hätte. »Wir würden euch gerne das Habitat zeigen, wenn ihr mögt, und versuchen, eure Fragen zu beantworten. Zuerst mal möchte ich euch aber meinen Respekt dafür aussprechen, dass ihr die strapaziöse Reise überstanden habt und wohlbehalten bei uns eingetroffen seid. Inzwischen kommen leider kaum noch Outlander zu uns.«
Jem runzelte die Stirn. »Outlander?«
»So nennen wir Menschen von außerhalb, wie euch. Flüchtlinge, Überlebende. Leute, die irgendwie von uns erfahren und den beschwerlichen Weg durch die Wüste angetreten haben.«
Olivia verschränkte die Arme. »Passiert das häufiger?«
Emilia zuckte die Schultern. »Sehr selten. Früher vielleicht ein- oder zweimal im Jahr, doch inzwischen gar nicht mehr. Ihr seid seit ewigen Zeiten die ersten. Und fast immer kamen sie alleine. Nie in einer solch großen Gruppe wie ihr.« Sie hielt den Kopf leicht schräg. »Wir haben viele Fragen an euch. Wo ihr herkommt, was es mit dem seltsamen Fahrzeug von euch auf sich hat und so weiter. Auch wenn ihr momentan noch unter Beobachtung steht, seid ihr natürlich keine Gefangenen. Sobald alle Untersuchungen abgeschlossen sind, dürft ihr euch frei in der Stadt bewegen.«
»Das freut uns zu hören«, erwiderte Jem skeptisch. »Wir möchten selbstverständlich auch einiges von euch erfahren. Vor allem, ob ihr wisst, was mit unseren Freunden passiert ist. Zwei Mädchen, Lucie und Katta. Habt ihr sie gefunden oder wisst ihr, was aus ihnen geworden ist?«
»Lucie und Katta?« Emilia zog einen Tabletcomputer aus ihrer Tasche, tippte darauf herum und sagte dann: »Tut mir leid, aber diese Information ist nicht verfügbar. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.«
Jem hob verblüfft die Brauen. »Nicht verfügbar? Was soll dasdenn bitte heißen? Wisst ihr etwas über sie oder nicht? Ist doch eine einfache Frage.«
»Auf die ich euch leider keine einfache Antwort geben kann. Ich muss mich an die Informationen halten, die ich von GAIA bekomme. Aber ich bin sicher, dass die Informationen bald freigegeben werden.« Sie lächelte entschuldigend.
Jem hatte das Gefühl, dass Emilia sie verarschen würde. »Komm schon«, sagte er. »Ist doch nur eine Kleinigkeit. Versteht ihr das nicht, wir müssen wissen, was mit ihnen los ist. Sie sind unsere Freunde.«
Emilia und Sara tauschten einen schwer zu deutenden Blick, dann zuckte Emilia mit den Schultern. »Bedaure.« Sie steckte das Tablet wieder ein. »Gibt es noch etwas anderes, womit ich euch dienen kann? Habt ihr Hunger? Gefallen euch die Unterkünfte?«
Jem sah ratlos zu seinen Freunden hinüber. Ihn plagten Fragen über Leben oder Tod und sie redeten von Essen und Unterkünften. Was waren das für seltsame Leute?
Er wollte gerade noch einmal nachhaken, als Ragnar ihm zuvorkam. »Wo sind meine Waffen?«, knurrte der Krieger. »Meine Schleuder, mein Schwert. Ich will sie zurückhaben.«
»Und ich meinen Bogen«, ergänzte Zoe. »Er bedeutet mir sehr viel.«
Sara lächelte. »Keine Sorge, sie werden gerade noch untersucht. Ihr bekommt sie zurück, sobald sichergestellt wurde, dass sich keine gefährlichen Keime oder Krankheitserreger daran befinden. Allerdings muss ich euch mitteilen, dass das Mitführen von Waffen in dieser Stadt untersagt ist. Ihr dürft sie zu Erinnerungszwecken in euren Zimmern behalten, aber bitte nicht öffentlich tragen. Sonst noch Fragen?«
»Was ist mit Loki?«, hakte Leòd nach. »Ich will meinen Kater wiederhaben. Seit unserer Ankunft habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ihr habt ihn doch wohl hoffentlich nicht …«
»Keine Sorge, deinem Tier geht es gut. Es muss ebenfalls untersucht werden, dann bekommst du es zurück.«
Jem fand, dass Saras Lächeln ziemlich gezwungen wirkte. Sie schien kein sonderlich großer Tierfreund zu sein.
»Ziemlich robust, dieser Kater«, sagte sie. »Wir hatten einige Probleme, ihn ruhigzustellen. Bist du sicher, dass du ihn hier bei dir haben willst?«
»Ja, unbedingt.« Leòd nickte bestimmt. »Er ist schließlich mein Freund.«
»Dein Freund?
»Ja, mein Freund. Habt ihr ein Problem damit?« Seine Stimme klang angriffslustig.
»Nein, natürlich nicht«, ruderte Sara zurück. »Ihr müsst nur wissen, dass Haustiere bei uns eigentlich nicht erlaubt sind. Abgesehen davon, dass niemand freiwillig auf die Idee käme, mit einem Tier unter einem Dach zu leben.« Jem konnte die Abneigung in ihrer Stimme hören. »Aber ich denke, dass wir hier mal eine Ausnahme machen können. Pass bloß bitte auf, dass er nicht herumstreunt, es könnte sonst leicht passieren, dass er eingefangen und … na ja, das muss ich dir ja nicht erzählen.« Sie musterte seinen Verband. »Wie geht es deinem Kopf? Immer noch schwindelig?«
»Geht schon wieder.« Leòd tastete ein bisschen herum und verzog schmerzverzerrt das Gesicht. »Ich glaube, ich habe eine ziemliche Beule.«
»Das ist normal«, sagte Sara. »Du hast einen ordentlichen Schlag abbekommen. Viel Ruhe und noch etwas Kühlspray, dann fühlst du dich wie neugeboren. Irgendeine Ahnung, wie das passieren konnte?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich kann mich an nichts erinnern.«
»Er wurde niedergeschlagen«, sagte Ragnar. »Das sieht doch ein Blinder. Derjenige, der das getan hat, hat auch Katta entführt. Wenn ich ihn in die Finger kriege, wird er sich wünschen, nicht geboren worden zu sein.«
»Ich denke, dass die Erinnerung bald wieder einsetzt, vielleicht werden wir dann Licht ins Dunkel bringen«, sagte Sara. »Ruht euch jetzt ein bisschen aus. Wenn ihr mögt, lassen wir euch etwas zu essen bringen.«
»Ich will mich nicht ausruhen.« Jem ballte die Hände zu Fäusten. »Mir ist das hier alles viel zu lasch. Es gibt wichtige Dinge zu klären und wir plaudern hier über belangloses Zeug. Wenn ihr uns schon nicht sagen dürft, was mit Lucie und Katta passiert ist, dann führt uns doch bitte zu jemandem, der dazu befugt ist. Möglicherweise steht ihr Leben auf dem Spiel. Jetzt, in diesem Augenblick. Jede Minute, die wir hier verschwenden, könnte sie das Leben kosten.«
»Ich stimme Jem zu«, sagte Arthur. »Wir brauchen Antworten. Erst überfallt ihr uns, fangt uns ein wie wilde Tiere, dann versorgt ihr uns und bietet uns Schutz an. Ich finde das alles sehr verwirrend. Wer ist euer Vorgesetzter, wer hat hier das Sagen?«
Emilia und Sara tauschten ratlose Blicke. Offenbar hatten sie nicht mit so viel Widerstand gerechnet.
In diesem Moment ertönte ein leises Piepen. Emilia presste den Finger an ihr Ohr. Jem sah, dass sie einen kleinen Knopf oder etwas Ähnliches darin hatte. Ein Ohrhörer?
Sie wandte sich ab und sprach mit jemandem.