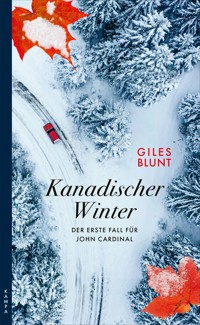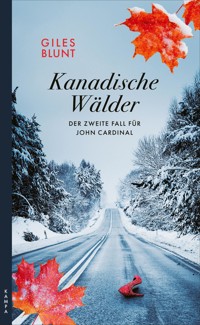14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für John Cardinal
- Sprache: Deutsch
Knapp ein Jahr liegt der Tod seiner Ehefrau Catherine nun zurück. John Cardinal versucht noch immer, zurück ins Leben zu finden. Dazu gehören im Augenblick eine kleine Wohnung, in der er sich vorübergehend ganz gut neu eingerichtet hat, die routinemäßige Arbeit an Cold-Case-Akten und Filmabende mit seiner Lieblingskollegin Lise Delorme, die ihn auf andere Gedanken bringen sollen. Passend zu Cardinals Gemütslage hüllt sich Algonquin Bay unterdessen in Schnee und Stille. Bis zwei enthauptete Leichen in einem abgelegenen Sommerhaus am Trout Lake gefunden werden. Für den Detective steht schnell fest, dass dieser Fall keineswegs Routine sein wird: Die Frau und der Mann waren anlässlich einer Pelzauktion, die jährlich in Algonquin Bay stattfindet, aus Russland angereist. Die renommierte Veranstaltung lockt für gewöhnlich Einkäufer aus aller Welt an, die die Pelze von Manhattan über Moskau bis nach China verteilen. Unvermittelt muss sich Cardinal ins Geschehen stürzen und gerät in ein Netz aus Intrigen und Geheimnissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Giles Blunt
Kanadische Kälte
Ein Fall für John Cardinal. Kriminalroman
Aus dem kanadischen Englisch von Anke Kreutzer
Kampa
Für Janna
1
Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich eine Stadt nichtnur als Tor zum Norden, sondern auch als Tor zur Haute Cuisine empfiehlt, und bis vor Kurzem wäre das bei Algonquin Bay ziemlich abwegig erschienen, es sei denn, man speiste Donuts oder Poutine – eine Spezialität aus Fritten, Frischkäse und Bratensoße. Schon so manchen verwegenen Restaurantbesitzer hatte der Versuch, dreihundertvierzig Kilometer nördlich von Toronto frischen Atlantik-Lachs oder gar eine essbare Tomate zu servieren, in den Ruin getrieben. Doch sie gaben nicht auf, und in diesem Jahr wetteiferten mindestens drei Tempel – zwei Steakhäuser und ein Bistro Champlain – um die Gunst des Gourmets.
Das Bistro Champlain lag dabei eindeutig vorn, was zum Teil der Kreativität des Kochs Jerry Wing geschuldet war, wobei es durchaus auch von der Lage auf der anderen Seite der Autobahn, gegenüber einem erstklassigen Skigebiet namens Highlands, profitierte. Hatten die Highlands Zulauf, dann ging es auch dem Bistro Champlain gut – und im Moment lief es dank der Winterpelz-Auktion blendend. Aus aller Welt waren die Einkäufer über Algonquin Bay hergefallen, um auf Hunderttausende von Pelzen zu bieten, die einmal in den Geschäften von Manhattan über Moskau bis Peking landen würden. Auch wenn es im Restaurant wie gewohnt vornehm zurückhaltend zuging, so herrschte in der Küche einige Stunden lang Chaos.
Es war schon fast zehn Uhr, und Sam Doucette hatte die hoffentlich letzte Bestellung für diesen Abend angerichtet: Wildbret mit Süßkartoffelpüree und Rotweinsoße. Die Stoßzeit war vorbei, der Lärmpegel vom Scheppern der Bratpfannen, Töpfe und Auflaufformen endlich unter die Schmerzgrenze gesunken. Jerry war bereits heimgegangen, und Sam schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass der Geschäftsführer Ken nicht noch irgendeinem Spätankömmling mit Bärenhunger einen Platz anwies. Kochen hatte sie von ihrer Mutter gelernt, und die Arbeit im Champlain war eigentlich als Teilzeitjob gedacht, um davon ihre Kunstkurse am Algonquin College zu bestreiten, doch an den letzten Abenden hatte sie die Arbeit von zwei Köchen gestemmt, nachdem man einen ihrer Kollegen beim Verlassen des Geländes mit zwei Schinken im Rucksack erwischt und auf der Stelle gefeuert hatte. Außer Ali und Jeff waren die Kellner bereits nach Hause gegangen, und Sam konnte es kaum abwarten, auch endlich wegzukommen.
Sie stellte einen Fuß auf den Boden eines umgestülpten Gewürzgurkeneimers und wischte sich mit dem Ärmel ihres Kochkittels den Schweiß von der Stirn. Würde Randall sie anrufen? Falls ja, umso besser. Falls nicht … darüber dachte sie lieber nicht nach. Wenn man verliebt war, fand sie gerade heraus, schwebte man nicht etwa ununterbrochen auf Wolken, sondern war ständig Angst und Zweifeln ausgesetzt. Deshalb wandte sie sich lieber Loreena Moon zu, der Heldin eines Comic-Romans, den sie einfach so zum Vergnügen gerade zeichnete und schrieb. Zumindest redete sie sich ein, die Sache sei nur so zum Spaß, denn sie wollte sich nicht in den Traum hineinsteigern, den Comic auch verkaufen zu können. Andererseits spielte sie mit dem Gedanken, daraus eine Serie zu machen. So hatte sie bereits stapelweise Bilder gezeichnet und einige Szenen geschrieben. Aus irgendeinem Grund hatte Sam von der imaginären Loreena Moon eine klarere Vorstellung im Kopf als von irgendetwas in ihrem realen Leben – mit Ausnahme von Randall und seinen leidenschaftlichen Küssen.
Loreena Moon war cool, abgehoben, selbstbewusst – das genaue Gegenteil von Sam. Wenn sie sich durch das Dickicht der Stadt bewegte, umwölkte Argwohn ihre Stirn. Sie trug ein Messer in einer fransenbesetzten Scheide an der Hüfte, einen Köcher mit Pfeilen über der Schulter und einen kleinen Bogen auf dem Rücken. Sie war stets empört, die Rächerin der Entrechteten, der Beistand der Hilflosen und Verzagten.
Loreena blickte nie zurück und verliebte sich grundsätzlich nicht. Sie war genau wie Sam achtzehn Jahre alt, lebte jedoch weder im Reservat noch in Algonquin Bay. Sam war sich noch nicht sicher, wo Loreena Moon lebte. Es konnte unmöglich ein Haus oder eine Wohnung sein; mit Rechnungen oder anderen banalen Pflichten gab sich Loreena nicht ab. Allenfalls konnte Sam sich vorstellen, dass sie in Hotels übernachtete und in keinem häufiger als einmal.
Die Wanduhr schlug zehn, und Champlains Küche hatte damit geschlossen. Als das Handy in der Brusttasche ihres Kittels klingelte, machte ihr Herz vor Freude einen Satz. Auf dem Display erschien der Name Randall Wishart.
»Wir haben ein Nest«, sagte sie. »Bitte sag mir, dass wir ein Nest haben. Ich hab dich so vermisst.«
»Ich dich auch«, sagte Randall. »Komm zum Haus an der Island Road. Wann kannst du da sein?«
»Hier bin ich so weit fertig. Ich muss nur noch alles für die Leute von der Mittagsschicht vorbereiten.«
»Parke ein Stück weiter weg«, sagte er. »Und pass auf, dass dich keiner sieht.«
Sam schaltete die Fritteuse, die Backöfen und Kochfelder aus. Die Arbeitsplatten und Schneidebretter hatte sie bereits abgewischt. Ihr Boss McCoy streckte den Kopf zur Tür herein und gab ihr mit dem erhobenen Daumen Zeichen, Feierabend zu machen.
In einer der Vorratskammern hinter der Küche zog sie sich um. Der weiße Kittel landete ebenso wie die lächerliche Pepitahose in der Wäschetonne. Loreena trug nie etwas anderes als schwarze Jeans zum Tanktop oder auch zu einem schwarzen T-Shirt, vielleicht mit einem Katzenlogo oder einem Blitz darauf. Sam war von der Hitze am Herd so verschwitzt, dass sie sich mühsam in ihre Jeans zwängen musste. Sie zog den weichen roten Pulli an, den Randall besonders mochte, hängte sich die Jacke über den Arm und gelangte zur Hintertür hinaus auf den Parkplatz.
Es war eine erfrischend kalte Dezembernacht, ohne die eisigen Temperaturen, die einem gewöhnlich ab Januar das Gesicht taub froren. Loreena Moon wäre jetzt auf ihre Kawasaki gesprungen, doch Sam stieg sehr behutsam in ihren 96er Civic. Man musste die Tür beim Öffnen leicht anheben, damit sich die Angel nicht verschob und das Ding sich nicht mehr schließen ließ.
Das Anwesen an der Island Road lag draußen am Trout Lake und nahm die ganze Spitze einer Landzunge ein. Während hier im Sommer Leute in ihren Booten vorbeikamen oder mit dem Wagen zwischen ihren Cottages hin und her fuhren, herrschte um diese Jahreszeit Totenstille. Trotzdem öffnete Randall die Tür so wie immer, indem er sich dahinterstellte, damit er nicht von einem zufällig vorbeikommenden Passanten zu sehen war. Er trug immer noch eines der dunklen Sportjacketts, die ihm bei der Arbeit am angenehmsten waren, die Krawatte dagegen hatte er abgelegt, und als er Sam kommen sah, strahlte er wie ein junger Shootingstar bei der Oscarverleihung. Kaum war Sam im Haus, nahm er sie in die Arme und drückte sie an sich.
»Drei volle Tage«, sagte Sam. »Ich dachte, ich werde verrückt.«
»Hat dich jemand gesehen?«
»Nee.«
»Wo steht dein Wagen?«
»An der Abzweigung zum Wasserkraftwerk, die du mir gezeigt hast.«
Bei diesem Haus handelte es sich um einen Bungalow, sehr offen gestaltet, mit einer Menge lackiertem Holz. Zu hübsch für Loreena, doch Sam war es recht. Sie wünschte sich, die Eigentümer kämen nie zurück. Sie zog die Stiefel aus und hängte ihre Jacke in der Eingangshalle auf. Randall umarmte sie noch einmal. Er knipste das Licht in der Diele aus, dann gingen sie ins Schlafzimmer, schlüpften aus ihren Kleidern, und Sam legte ihre Sachen auf einen Holzstuhl neben dem Wandschrank.
»Jane haben schönen Körper«, sagte Randall.
»Ich wünschte, ich könnte duschen. Ich bin völlig verschwitzt.«
»Ich mögen verschwitzt.«
Sie legten sich auf die blaue Decke, die Randall immer mitbrachte und auf dem jeweiligen Bett, das sie benutzten, ausbreitete. Er hatte sie stets in seinem Auto, und Sam fragte sich manchmal, wie er dies seiner Frau erklärte. Er streckte sich nackt aus und verschränkte die Hände hinter dem Kopf, sodass sein Bizeps vortrat. Sam liebte seinen Körper. Liebte ihn mit einer Leidenschaft, wie man wohl nichts auf dieser Welt lieben sollte. Sie hatte immer geglaubt, Liebe hätte etwas mit Vereinigung, Verschmelzung der Seelen zu tun, und bevor sie mit Randall Wishart schlief, hatte sie nie mit der Möglichkeit gerechnet, dass man nach dem Körper eines anderen Menschen vollkommen verrückt sein konnte.
Sam setzte sich Randall rittlings auf die Brust und hielt seine Arme fest. Ihre Hände hoben sich dunkel von seiner weißen Haut ab. »Ich muss unablässig an dich denken«, sagte sie.
»Geht mir genauso.«
»Nein, ich meine, wirklich, einfach ohne Unterbrechung.«
»Wenn ich so wie du zeichnen könnte, wärst du mein einziges Modell.«
Sam berührte ihn an der Wange. Randall war immer glatt rasiert und trug grundsätzlich keinen Dreitagebart. Als Makler hätte er das unprofessionell gefunden.
»Ich denke an deine Stimme«, sagte sie und streichelte seinen Hals. »Manchmal höre ich sie sogar im Schlaf.«
»Tatsächlich? Und was sage ich?«
»Das verrate ich dir nicht.« Sie legte sich die Hände aufs Gesicht.
»Komm schon, was sage ich? Ich weiß, was ich sage.« Er befreite sich aus ihrem Griff, legte sie auf den Rücken und flüsterte ihr eine Reihe unerhörter Befehle ins Ohr, während er an ihrem Ohrläppchen knabberte. Wie gewöhnlich war dies der Auftakt zu ihrem Liebesspiel, bis sie sich wild ineinander verknäuelten. Selbst nach sechs Monaten war Sam auch diesmal wieder vollkommen außer Atem und durcheinander. Randall fand immer genau die richtige Art der Berührung, den passenden Zeitpunkt, um ihre Lust ins nahezu Grenzenlose zu steigern. Lag es nur daran, dass er älter war? Oder hatte er eine Art natürliche Begabung? Oder lag es vielleicht – ach, wenn es doch bitte, bitte so wäre – daran, dass er sie wirklich von ganzem Herzen liebte? Im Handumdrehen ein Orgasmus Windstärke zehn.
Keuchend und lachend rollte er sich von ihr herunter. »Das ist es. Ich schwör’s dir. Das war er. Ich werde nie wieder einen brauchen. Das war’s für alle Zeiten.«
Sam lachte. »Sollte als olympische Disziplin eingeführt werden. Der Hundert-Meter-Orgasmus.«
»Synchronisierte Orgasmen.«
Auch wenn sie lachten, fühlte sich Sam schon jetzt, wie jedes Mal danach, bedrückt. Traurig darüber, dass Randall zu seiner Frau nach Hause gehen würde. Traurig, weil sie selbst zu ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder, zu ihren selbstverliebten Kunstlehrern in Algonquin zurückkehren würde. Die meisten ihrer Freunde hatten die Stadt verlassen, um an weiter entfernten Universitäten zu studieren. Ihr Dad war bei einem seiner winterlichen Campingausflüge entweder zur Jagd oder auch nur, um die Einsamkeit zu genießen, unterwegs. Sie drehte sich auf die Seite und berührte Randall an der Schulter.
»Können wir vielleicht mal irgendwo hinfahren?«, fragte sie. »Wenigstens für ein paar Tage?«
»Wäre schön, oder?«
»Können wir? Einfach nur mal nach Toronto oder Montreal oder, was weiß ich, sonst irgendwohin? Wenigstens über Nacht?«
»Würde ich liebend gerne, Sam, aber ich kann nicht. Was soll ich Laura erzählen?«
»Erzähl ihr, du hättest eine schöne indianische Prinzessin gefunden, die dich unglaublich glücklich macht.«
»Käme bestimmt toll an.«
»Dann denk dir eben was aus.«
»Das kann ich nicht, Sam. Ich bin ein lausiger Lügner, und Laura würde es in einer Sekunde begreifen.« Er schnippte mit den Fingern.
Wie jedes Mal, wenn sie über ein Leben außerhalb eines leer stehenden Hauses sprach, in dem sie sich gerade getroffen hatten, wurde Randall angespannt. Sie wusste, dass sie den Mund halten sollte, doch sie konnte sich nicht beherrschen.
»Hast du nicht auch Lust, irgendwo anders mit mir Zeit zu verbringen? Vielleicht irgendwo draußen? Oder was weiß ich – in einem Café, einem Buchladen –, irgendwo, wo wir einfach ganz normale Menschen sein können?«
»Sam, Laura und ich sind schon lange zusammen. Ich kann sie nicht von heute auf morgen verlassen, und, wie gesagt, ich bin ein lausiger Lügner.«
»Na ja, darüber sollte ich mich vermutlich freuen.« Sam hob die Hand und strich ihm über die Augenbrauen. Er gab einen leisen wohligen Laut von sich und war im nächsten Moment eingeschlafen.
Er schlief hinterher immer ein, tief und fest, wie mit Valium vollgepumpt. Das dauerte fünf bis zehn Minuten, in denen Sam sich über sein anderes Leben, sein reales Leben Gedanken machte. Laura Wishart war hübsch und intelligent – Sam hatte im Internet nachgesehen –, der Inbegriff einer erfolgreichen Blondine, irgend so eine Finanzexpertin. Sie musste von Anfang an betucht gewesen sein, denn ihrem Vater gehörte Carnwright Real Estate, die Maklerfirma, bei der Randall beschäftigt war. Sam war sich nicht sicher, wieso Randall mit seiner Frau unglücklich war. Er sprach kaum von ihr, sondern hatte lediglich einmal erwähnt, dass sie nie mehr Sex miteinander hatten.
Sie versuchte, an Loreena Moon zu denken. Loreena war frei, immer auf der Pirsch. Loreena war cool und unnahbar. Sie war wie Pootkin, Sams schwarze Katze, die in ihrem Wohnviertel herumstreunte und manchmal nach Hause kam, manchmal nicht. Sie hatte Loreena Pootkins grüne Augen gegeben – die einzigen Farbtupfer in ihrer monochromen Kunst. Sie wusste nicht, ob man bei einem richtigen Buch mit einem einzigen Farbtupfer arbeiten konnte, doch ihr gefiel’s.
Ihre Heldin sollte im Prinzip zu den Guten gehören – das heißt, immer den Schwächeren helfen und dafür sorgen, dass die Bösen ihre gerechte Strafe bekamen. Andererseits sollte sie sich nicht von kleinlichen Verhaltensregeln einengen lassen. An diesem Wochenende hatte sie Bilder von Loreena gezeichnet, auf denen sie Sachen mitgehen ließ. Sie ermittelte gegen einen reichen Industriellen, der unter dem Verdacht stand, das Trinkwasser für mehrere Reservate zu vergiften, und während sie in einer seiner prächtigen Villen herumschnüffelte, steckte sie mehrere Wertgegenstände ein. Sam gefiel der Gedanke, dass Loreena so wenig Moral kannte wie Pootkin, war sich allerdings nicht ganz sicher, ob sie das mit ihrer Hilfe für die Schwachen in Einklang bringen konnte. Sie liebte Pootkin, allerdings nicht, weil die Katze irgendwelche Anzeichen von Altruismus an den Tag gelegt hätte.
Randall wachte auf und nahm seine Armbanduhr vom Nachttisch. »Himmel, ich muss los. Angeblich bin ich bei Troy und sehe das Spiel an. Den größten Teil hab ich tatsächlich gesehen.«
»Du solltest dich erkundigen, wie es ausgegangen ist, bevor du nach Hause kommst.«
»Ruf ich auf dem Handy ab. Nicht, dass Laura sich dafür interessieren würde.«
Sie zogen sich an, und Randall faltete die blaue Decke zusammen. In der Eingangsdiele schlüpften sie in ihre Stiefel und Mäntel. Randall knipste das Licht aus. Er sprach so leise, als fürchtete er, es stünden draußen Leute und horchten an der Tür. »Lass mir zwei Minuten Vorsprung, ja?«
»Ist gut.«
»Und schließ die Tür richtig ab. Das Schloss scheint irgendwie kaputt zu sein – in dem Haus klemmt es an allen Ecken und Enden.«
Er gab ihr einen kurzen Abschiedskuss, sagte, er könne es bis zum nächsten Mal kaum abwarten, und war verschwunden. Ein Schwall kalte Luft, der Geruch nach nassen Kiefern. Das Geräusch, als er den Gang einlegte. Es sollte nicht so wehtun, sagte sie sich. Du bist ein großes Mädchen. Theoretisch. Allerdings keine Loreena mit Katzenherz, so viel stand fest. Durch das Türfenster schaute sie seinen Rücklichtern nach, bis sie zwischen den Bäumen verschwanden. Es war eine lange Fahrt in die Stadt zurück und von dort aus weiter ins Reservat; sie ging besser noch mal aufs Klo, bevor sie sich auf die Socken machte. Sie wischte die Stiefelsohlen auf der Fußmatte ab, bis sie sicher war, auf dem Holzboden keine Wasserspuren zu hinterlassen.
Als sie aus dem Bad kam, hörte sie einen Schlüssel in der Eingangstür. Die Stimme eines Mannes. Nicht Randall. Stapfende, schwere Schuhe und andere Stimmen, die antworteten.
Sam trat ins Schlafzimmer. Falls das die Eigentümer sind, überlegte sie, oder sogar ein anderer Makler, der dieses Haus Interessenten zeigt, bin ich am Arsch; Randall auch. Doch die Eigentümer konnten noch nicht wieder zurück sein, und wieso sollte ein Makler jemandem so spät am Abend eine Immobilie zeigen? Das ergab keinen Sinn. Die Klospülung lief noch, und sie hoffte inständig, dass sie verstummte.
Stimmen und Schritte im Haus. Licht in der Diele.
Sam legte sich auf den Boden und rollte sich unters Bett. Kein seriöser Mensch, dachte sie unwillkürlich, bringt sich in so eine Lage.
Einige Minuten lang war es still, dann wurde die Stimme des Mannes lauter, und die Schritte kamen in ihre Richtung. Dumpfes Tappen von Leuten auf Socken. Hieß das etwa, dass sie bleiben würden?
Die Stimme des Mannes aus dem Flur. »Hat ein hübsches Badezimmer. Kein Luxus, aber hier zahlt man vor allem für die Lage. Die Ruhe.«
Im Schlafzimmer ging das Licht an, und Sam hielt die Luft an.
»Das Elternschlafzimmer hat eine anständige Größe. Offensichtlich für ein großes Doppelbett ausgelegt. Reichlich Einbauschränke. Die Farbe wird man vielleicht ändern.«
Das Geräusch von Schiebetüren.
Die Stimme einer Frau mit irgendeinem Akzent. »Wann, sagen Sie, wurde es gebaut?«
»Anfang der Sechziger.«
»So neu. Sieht älter aus, der Stil.«
Die Schiebetüren gingen zu.
»Es hat Charme«, sagte der Mann aus größerer Nähe. »Kein Haus von der Stange.« Er durchquerte das Zimmer, Gardinen wurden zurückgezogen. »Der Garten grenzt direkt an den See, im Winter fahren Sie Schneemobil, im Sommer Kanu oder Wasserski. Der Blick ist das Einzigartige an diesem Haus. Sie müssen es sich unbedingt noch mal bei Tageslicht ansehen, direkt am Wasser, an der Spitze der Landzunge – Bilderbuch, anders kann man das wirklich nicht nennen. Ziemlich einmalig. Hat noch zwei Schlafzimmer.«
»Nur ein Bad?« Eine andere Männerstimme. Auch mit ausländischem Akzent.
»Ja, Sir. Man kauft es vielleicht nicht als ersten Wohnsitz, aber als Wochenendhaus im Norden? So ein Angebot können Sie lange suchen.«
Ihre Schritte tappten in den Flur, das Licht ging aus.
»Sehen Sie sich die anderen Zimmer an«, sagte der Mann, »danach hab ich noch einen kleinen Seelenwärmer für uns.«
Sam wechselte die Stellung unter dem Bett. Sie hörte den Mann und die Frau in der Diele in einer Fremdsprache reden. Wie lange brauchten die, um sich einen kleinen Bungalow anzusehen? Geht, flehte sie. Nun geht schon!
Schritte wieder Richtung Küche oder Wohnzimmer, jedenfalls nicht mehr in der Diele. Die Leute gingen immer noch nicht, aber sie konnte sie zumindest nicht mehr hören.
Sie versuchte, ruhig durchzuatmen und sich zu beruhigen. Sicher gingen sie bald. Vielleicht in ein paar Minuten.
Aus dem Wohnzimmer Gläserklirren. Lachen. Sam betete, dass sie nicht vorhatten, für den Rest der Nacht zu einem Saufgelage zu bleiben.
Sie wartete und dachte an das Fenster. Der Bungalow hatte einen offenen Grundriss, sodass man unmöglich bis zur Haustür kam, ohne entdeckt zu werden. Die Gartentür hatte sie nicht gesehen, aber sie musste irgendwo in der Nähe der Küche sein. Also durchs Fenster.
Gibt es in dieser Situation irgendeinen Grund zur Dankbarkeit?, fragte sie sich. Einen einzigen kleinen Umstand, der die sprichwörtliche »dankbare Grundeinstellung« rechtfertigte, die ihr Vater ihr ständig nahelegte? Denn sonst würde ihre Angst noch ganz andere Formen annehmen.
Ein Schuss.
Sam stieß mit dem Kopf gegen die Matratzenfeder. Ihr Vater hatte ihr mit neun Jahren das Schießen beigebracht. Es gab für sie nicht den Hauch eines Zweifels, dass gerade jemand einen Schuss abgefeuert hatte.
Noch ein Schuss.
Ein Mann stieß einen Schrei aus, so wie jemand brüllt, wenn seine Mannschaft gerade einen Treffer gelandet hat.
Falls man sich im Wald verirrt, hatte ihr Vater ihr eingebläut – denn schließlich verirrt sich jeder mal im Wald, sogar Indianer –, ist zunächst einmal ganz entscheidend, was man nicht tut. Man gerät nicht in Panik. Die bringt einen schneller um als jeder Wolf, schneller als jeder Bär. Panik ist die häufigste Todesursache, die der Mensch kennt. Man muss sie erkennen und beim Namen nennen und dann in einem kleinen Safe verschließen, wo niemand herankam, nicht mal du selbst, verstanden?
Keine Panik, schärfte sie sich ein. Vielleicht wurde da gerade ja niemand erschossen. Sie waren dabei, ein Haus zu besichtigen – wieso sollte irgendjemand einen anderen erschießen? Vielleicht schießt jemand aus irgendeinem Grund mit Platzpatronen. Vielleicht haben sie gekokst oder so und sind nicht ganz dicht. Nur keine Panik!
Sie versuchte, ihren Atem, ihren Puls wieder zu normalisieren. Niemand weiß, dass ich hier bin. Egal, was da vor sich geht, es ist sicher bald vorbei. Die hauen ab, ich haue ab. Das Leben geht ganz normal weiter, und niemand ist tot. Ich zumindest nicht.
Das alles konnte ihre Herzfrequenz nicht beruhigen. Das Blut hämmerte ihr in den Ohren.
Langsam kroch sie unter dem Bett hervor. Es gab zwei nebeneinandergelegene Fenster, eines davon mit eingebauter Klimaanlage. Draußen glänzte der Schnee im Mondlicht. Sie drehte den Griff am anderen Fenster und versuchte, es hochzuschieben. Es bewegte sich nicht. Ihr Herz raste noch schneller. Nur mit größter Mühe konnte sie einen Schrei unterdrücken.
Das ist Panik, dachte sie. An den Griffen zerren, um die bewegliche Scheibe hochzuschieben, obwohl sich nichts bewegt. Dabei die ganze Zeit der Gedanke: Du bist in Panik, kriech wieder unters Bett.
Den Stuhl packen, obwohl du bis jetzt noch nicht das leiseste Geräusch verursacht hast.
Wenn du das jetzt machst, gibt es kein Zurück. Es gibt keine zweite Chance. Du solltest unters Bett zurückkriechen.
Sie schwang den Stuhl mit aller Kraft und warf sich mit ihrem ganzen Körpergewicht in die Bewegung. Der Lärm war erschreckend.
Sie schob ein Knie über die innere Fensterbank auf den schmaleren Sims draußen. Dann stützte sie sich auf, sodass sich ihr an mehreren Stellen zugleich scharfe Glaskanten in die Handflächen schnitten. Sie stieß sich ab, hörte, wie ihr Mantel riss, und schlug mit Knien und Händen hart auf den Boden auf. Im selben Moment rappelte sie sich hoch und rannte los. Sie sah dort, wo die Kugeln in den Boden trafen, den Schnee aufspritzen, bevor sie den ersten Knall registrierte.
Während sie den Schutz der dunklen Bäume suchte, war ihr bewusst, dass ihre frischen Fußspuren auf dem unberührten Weiß danach schrien, sie zu erschießen. Sie ließ sich hinter einem Granitfelsen fallen und blickte zurück. Jemand hatte im Schlafzimmer Licht gemacht, doch im Fenster war kein Schatten zu sehen. Denk nach, befahl sie sich. Links der platingraue See, dessen hauchdünne Eisschicht allenfalls eine Katze trug. Es gibt nur zwei Routen zum Wagen zurück – je eine links und rechts von der Einfahrt, und dann die Straße. Er hat mich hier entlanglaufen sehen. Er wird jeden Moment aus dieser Haustür stürmen und in meine Richtung kommen, und selbst wenn er mich im Dunkeln nicht erkennen kann, wird er mich hören, und dann bin ich tot, und ich will ganz bestimmt nicht sterben.
Das offene Gelände zwischen ihr und dem Haus erschien ihr wie der bedrohlichste Ort auf Erden. Sie verließ den Schutz der Felsen und kehrte quer über diese Lichtung zum Haus zurück, hielt sich dann möglichst dicht an dessen Gartenfront, um auf dieser Seite im Wald zu verschwinden. Sie konnte nur den einen Gedanken fassen, aus Leibeskräften zu laufen. Ich bin schnell, sprach sie sich Mut zu, aber ich bin nicht Loreena Moon und ganz bestimmt nicht schneller als Kugeln. Noch wichtiger als das Tempo war es, sich lautlos zu bewegen.
Sie versuchte, sich all die Regeln ins Gedächtnis zu rufen, die sie beim Jagdunterricht von ihrem Vater gelernt hatte. Sich unentdeckt an seine Beute anschleichen. Vorzugsweise auf felsigem Boden oder in dessen Nähe laufen. Sein Gewicht reduzieren, indem man dicht am Stamm den Halt von Ästen sucht. Ach ja – nicht auf kleine Zweige treten. Tolles Indianer-Einmaleins, Dad! Darauf wäre ich nie gekommen. Ein guter Jäger zu sein war nicht ganz dasselbe, wie als Beute am Leben zu bleiben.
Als sie die Vorderseite des Bungalows ein gutes Stück hinter sich gelassen hatte, duckte sie sich in eine Gruppe von Kiefern und horchte. Sie sah die Einfahrt, hörte, wie der Mann auf der anderen Seite geräuschvoll durch den Wald lief. Fragte sich, wie blöd der Kerl war. Wie lange würde er brauchen, bis er merkte, dass es da drüben in der dünnen Schicht Neuschnee, die in dieser Nacht gefallen war, keine Spuren gab. Dann würde er entweder warten oder umkehren und hinter dem Haus ihre Fährte entdecken.
Jetzt kam er aus dem Wald und drehte sich langsam im Kreis, um sich den Schnee genauer anzusehen. Sam griff in ihrer Tasche nach dem Handy. Nicht da. Sie klopfte die anderen Taschen ab. Der Mann lief mit schussbereitem Gewehr zum Haus zurück. Sam sprintete wieder los. Wenige Sekunden später konnte sie zwischen den Bäumen hindurch die Straße erkennen. Ihr Wagen wartete ein Stück weiter Richtung Stadt. Um nicht die ungeschützte Einfahrt überqueren zu müssen, blieb ihr keine andere Wahl, als einen großen Bogen zu schlagen und auf der anderen Straßenseite durch den Wald, der sich dort eine steile Böschung hochzog, zu pirschen und die offene Straße zu meiden.
Der Mann kam durchs Gestrüpp hinter ihr hergestürmt. Sam bog Richtung Straße ab und rannte um ihr Leben. Falls er sie sah, hätte er Mühe, anzulegen und zu zielen, und bis er die Straße erreichte, säße sie schon im Wagen. Etwas sirrte an ihrem Gesicht vorbei, und der Knall, der augenblicklich folgte, beantwortete alle ihre Fragen. Sie erreichte die Zufahrt zum Kraftwerk und ihr fünfzehn Meter weiter geparktes Auto.
Falls er es bis zur Straße geschafft hat, sagt ihm das Geräusch, wenn ich mit dem Ding da losfahre, wo ich bin.
Sie ließ die Scheinwerfer ausgeschaltet. Der Honda zündete gleich beim ersten Versuch. Auf der Zufahrt ging sie es langsam an; auf der leichten Steigung hätten die abgefahrenen Reifen nicht gegriffen. Noch während sie die Island Road hinaufkroch, sah sie ihn kommen. Sie gab Gas. Auch wenn hinten die Räder durchdrehten, gelangte sie auf die Straße. Es war eine Qual, den Fuß vom Gas zu nehmen, andererseits die einzige Chance, dass die Reifen griffen. Eine Kugel traf ins Heck, und der Mann schrie, während sie ihn im Rückspiegel hinter ihr herrennen sah.
Die Reifen griffen, und sie gab langsam mehr Gas, während sie versuchte, sich auf ihrem Sitz möglichst klein zu machen. Eine zweite Kugel schlug in den Kofferraum ein. Sie fuhr um eine Kurve und bekam schon etwas besser Luft. Er konnte sie weder treffen noch zu Fuß mit ihr Schritt halten. Logisch wäre jetzt für ihn, in diesen Wagen zu steigen, den sie im Schatten der Einfahrt gesehen hatte, und wie der Terminator hinter ihr herzujagen. Immerhin hatte sie ihm voraus, dass sie die Island Road mit ihren teils üblen Serpentinen kannte, und außerdem konnte er nicht wissen, ob sie Richtung Stadt oder weiter nach Norden fuhr.
Ein entgegenkommendes Fahrzeug hupte laut und blinkte. Sie machte die Scheinwerfer an und drückte weiter aufs Gaspedal, sodass der Honda in den Kurven ins Schleudern geriet. Im Rückspiegel war bislang noch nichts, auch wenn man natürlich immer nur bis zur letzten Kurve sehen konnte. Vor ihr lag rechts die Chinook Tavern und dahinter der Highway. Für einen Donnerstagabend war der Parkplatz der Chinook ziemlich voll besetzt. Draußen standen einige Leute herum und beugten sich über ihre Zigaretten. Ein Kerl wollte gerade mit seiner Harley auf die Straße einbiegen – keine Chance. Sie raste vorbei und ignorierte das Halteschild an der Kreuzung. Er brüllte ihr seine Wut hinterher.
Dann endlich in der Ferne die breite, gerade Straße und die Lichter der Stadt. Sie tastete noch einmal in ihren Taschen nach ihrem Handy. Eindeutig nicht da. Sie musste es bei dem Sprung verloren haben. Der Mond schien auf die weiße Fläche des Trout Lake, die Straße selbst lag im tiefen Schatten der Bäume und der Berge. Das Tempolimit betrug achtzig Kilometer, doch ihr Tacho zeigte hundertzwanzig an. Schneller ging es bei den Kurven nicht. Natürlich war das hier eine richtige Radarfalle. Die Cops kontrollierten diesen Streckenabschnitt mit Vorliebe, um Betrunkene zu kassieren, die vom Chinook aus in Schlangenlinien in die Stadt zurückfuhren.
Das Lenkrad war blutverklebt. Ihr tat das Knie weh, und zwar so, dass es nicht so schnell wieder aufhören würde. Das Blut hatte ihre Jeans fast bis zum Saum hinunter getränkt. Musste vermutlich genäht werden. Du hast mehr als ein Problem am Hals, sagte sie, und wenn du eine Idee hast, wie du da wieder herauskommst, lass hören – und zwar, bevor unser Mörder beschließt, Jagd auf dich zu machen.
2
Als Sam nach Hause kam, parkte sie den Wagen in derGarage und sah sich den Schaden am Heck an. Das linke Blinklicht war zersplittert, und im Kofferraum gab es ein Einschussloch. Sieben, acht Zentimeter höher, und ihr Gehirn wäre quer über die Windschutzscheibe gespritzt.
Sie ging ins Haus und zog sich im Dunkeln Mantel und Stiefel aus. Ihre Mutter ließ nachts immer die Schlafzimmertür geöffnet. Sam musste leise die Diele durchqueren, um ins Bad zu kommen. Das rechte Bein ihrer Jeans war unterhalb der Schnittwunde im Knie steif vom Blut. Sie öffnete den Wandschrank über dem Waschbecken und fand ein Fläschchen Tylenol mit Codein, das von einer Zahnextraktion übrig geblieben war. Sie ließ zwei Tabletten auf die hohle Hand fallen und schluckte sie mit Wasser aus dem Hahn.
Ihre linke Hand hatte einen tiefen, fünf Zentimeter langen Schnitt am Ballen. Die Wunde blutete nicht mehr besonders stark. Im Schrank neben der Toilette fand sie Mull und Heftpflaster sowie einen alten Waschlappen und Franzbranntwein. Ihre Oberschenkel zitterten heftig, als sie in die Badewanne stieg. Sie schlüpfte halb aus der Jeans und setzte sich auf den Wannenrand.
Sie atmete ein paarmal tief ein und aus, hielt die Luft an und löste die Jeans von der Wunde am Knie. Die Tränen brannten ihr in den Augen, und sie schluchzte, auch wenn es ihr gelang, keinen Laut von sich zu geben. Sie zog die Jeans ganz herunter und rollte sie auf. Aus dem Knie quoll Blut. Sie ließ Wasser darüber laufen und sah zu, wie es rot bis rosa in den Ausguss lief. Sie wusch sich den klaffenden Schnitt mit Seife und Wasser aus und tupfte ihn anschließend mit dem alten Waschlappen trocken. Der Alkohol war kalt und brannte, doch es fühlte sich sauber an.
Die Wunde im Knie musste genäht werden, aber das war nicht möglich. Wenn sie zur Notaufnahme fuhr, war eine Erklärung fällig, und es war durchaus möglich, dass sie dort jemandem begegnete, der angeschossen war oder der geschossen hatte.
Sie trocknete sich die Füße ab, kehrte zum Wäscheschrank zurück und wühlte so lange darin herum, bis sie eine Packung Kotex-Binden fand, die ihre Mutter vor ein paar Jahren gekauft hatte, ohne die medizinischen Gründe dafür mit ihren Kindern zu erörtern. Sam klebte sich eine davon mit Pflaster fest aufs Knie.
Es war mühsam, die hinterlassene Schweinerei zu beseitigen, während sie jeden Moment damit rechnete, dass ihre Mutter anklopfte, doch es blieb still. Sam knipste das Licht im Badezimmer aus, hinkte an dem Zimmer ihres Bruders vorbei in ihr eigenes und zog die Tür hinter sich zu. Ihre aufgerollte Jeans und die Packung Binden versteckte sie unter dem Bett. Sie schaltete die Nachttischlampe ein und setzte sich, indem sie das linke Bein gerade hielt, auf die Bettkante. Pootkin hatte sich am Fußende eingerollt. Die Katze hob den schwarzen Kopf, blinzelte und schlief wieder ein.
Die Oberseite ihres improvisierten Verbands färbte sich bereits rot. Die Wunde würde sich jedes Mal öffnen, wenn Sam das Knie anwinkelte.
Das Codein zeigte schon Wirkung, und das Zittern ließ nach. Für eine Prognose, wie groß die Probleme waren, in die sie sich hineingeritten hatte, war vermutlich ein ganzer Haufen Wissenschaftler nötig. Falls unser Mann mit der Knarre mein Kennzeichen gesehen hat, kann ich Gute Nacht sagen. Aber es war dunkel, er lag weit zurück und hat versucht, mich zu treffen; vielleicht hat er das Kennzeichen nicht gesehen. Wenn man auf Leute schießt, hat man wahrscheinlich keinen Blick für Nummernschilder.
Außerdem weißt du nicht mal, jedenfalls nicht mit Gewissheit, ob der Mann im Haus überhaupt auf jemanden geschossen hat. Klar doch – und wieso hat er dann versucht, dich aus dem Weg zu räumen? Sams Schlafzimmer war winzig. Sie konnte vom Bett aus ihren Schreibtisch berühren. Sie nahm ihren Laptop, fuhr ihn hoch und überprüfte ein paar neue Webpages wie abdaily.com und algonquinlode.com. Natürlich war es noch zu früh. Sie brachten Beiträge zur Pelzauktion und zum Winterkarneval, aber nichts über eine Schießerei.
Sie sah auf ihren Wecker und dachte an Randall. Wenn du jetzt bei ihm anrufst, seine Frau aufweckst, ihn überrumpelst, kannst du ihn gleich vergessen. Frühestens konnte sie sich am Morgen nach acht Uhr bei ihm melden. Er hatte gesagt, seine Frau sei jeden Tag von acht bis sechs im Büro. Randall musste dagegen erst um zehn los.
Das Scheinwerferlicht eines vorbeifahrenden Autos strich über ihre Schlafzimmerwand, und sie hielt die Luft an, bis es vorüber war. Sie knipste das Licht aus und schob die Katze zur Seite, um sich hinlegen zu können. Ihr Knie pochte. Als sie die Augen schloss, war sie wieder im Haus am Trout Lake, sprang auf den verschneiten Boden, rannte durch den Wald. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Handy findet? Er rennt mit einer Knarre durch die Dunkelheit – hat er da einen Blick für einen kleinen Gegenstand, der halb im Schnee begraben ist?
Sie öffnete erneut ihren Laptop, legte sich auf die Seite und suchte im Internet nach Ratschlägen, was man am besten machte, wenn man sein Handy verloren hatte. Es gab Modelle, die man mit seinem Computer synchronisieren konnte, was einem ermöglichte, sämtliche Informationen zu löschen, sobald der Dieb versuchte, damit ins Internet zu gelangen. Sams Handy verfügte nicht über solche technischen Finessen. Sie hatte nicht einmal ein Passwort eingerichtet. Nur die Ruhe, Sam, er hat es nicht gefunden. Folglich findet es vermutlich die Polizei.
Endlich entfaltete das Codein seine volle Wirkung. Sie versuchte, sich zurechtzulegen, was sie der Polizei sagen sollte, konnte aber keinen klaren Gedanken fassen.
Als Sam am nächsten Morgen aufwachte, hatte sie ihren Laptop noch neben sich auf dem Bett. Auf ihrem Wecker war es 8:30 Uhr. Ihre Mutter und ihr Bruder mussten wohl schon gegangen sein. Sie rief Randall auf dem Festnetztelefon an. Er schien nicht begeistert zu sein, dass sie am Apparat war, doch sie ignorierte ihn und rückte mit der ganzen Geschichte heraus.
»Randall, ich hatte noch nie im Leben solche Angst. Bis gestern hab ich nicht mal gewusst, was Angst bedeutet. Ich hab wirklich geglaubt, dass ich sterbe, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in diesem Haus Tote gibt.«
»Aber du hast nicht selbst gesehen, wie er jemanden erschossen hat.«
»Nein, doch er war hinter mir her und hat versucht, mich umzubringen, und wieso sollte er das wohl tun, wenn er nicht gerade diese Leute erschossen hätte?«
»Ich will damit nur sagen, dass du keinen Mord zu melden hast. Allenfalls könntest du bezeugen, du hättest Schüsse gehört.«
»Und dass so ein Mistkerl versucht hat, mich umzubringen. Ich hab Einschusslöcher in meinem Wagen.«
»Und du sagst, er hat sich als Immobilienmakler ausgegeben? Er hat versucht, ihnen das Haus zu verkaufen?«
»Er hat ihnen das Badezimmer gezeigt und von der Aussicht gefaselt.«
»Das ist völlig absurd. Ich hab dieses Haus im Alleinauftrag.«
»Ich wollte die Polizei anrufen, sobald ich nach Hause komme, aber ich wollte dich nicht in Schwierigkeiten bringen.«
»Moment mal, Sam. Du kannst der Polizei nicht erzählen, dass ich da draußen war. Ist dir klar, was das für mich bedeuten würde? Wie soll ich Larry erklären, was ich mitten in der Nacht mit einer Indianerin da draußen in dem Haus zu suchen hatte?«
Larry war Lawrence Carnwright, Eigentümer und Betreiber von Carnwright Real Estate.
»Indianerin?«
»First Nations. Halt dich da raus, Sam. Sonst geht nicht nur meine Ehe, sondern auch meine Karriere den Bach runter.«
»Ich kann doch nicht einfach den Mund halten. Stell dir vor, da draußen ist jemand verwundet? Der verblutet langsam? Was wäre ich dann für ein Mensch?«
»Du wärst einfach nur vernünftig. Jemand, der unter Beschuss einen kühlen Kopf behält. Buchstäblich. Falls der Kerl jemanden umgebracht hat, dann ist derjenige tot, und du kannst auch nichts mehr daran ändern, Sam. Aber du musst bei der Sache auch mal an meine Situation denken. Wie willst du erklären, dass du in diesem Haus warst? Woher wüsstest du überhaupt von dem Haus, ohne mich ins Spiel zu bringen? Und wenn sie erst mal meinen Namen kennen, bin ich erledigt. Der Schaden wäre irreparabel.«
Sam dachte darüber nach. Sie strich sich mit den Fingern durchs Haar und stieß auf V-förmige Kiefernnadeln. »Ich könnte anonym anrufen. Aus einer Telefonzelle.«
»Um ihnen was zu sagen, Sam?«
»Ich war in der Nähe und hab Schüsse gehört und dachte, ich sollte das besser melden.«
»Und du meinst, die fahren zehn Stunden später da raus, nur für den Fall, dass an der Spitze der Island Road immer noch jemand herumballern könnte? Auf solche Informationen reagieren die gar nicht. Du müsstest denen sagen, was du mir erzählt hast – du hättest Leute gehört, und dann wären Schüsse gefallen, und du seist dir ziemlich sicher, dass sie tot sind. Dann fahren die hinaus. Bei der einsamen Lage des Anwesens wissen sie dann auch gleich, dass du in Wahrheit im Haus warst, und dann drehen und wenden sie jedes klitzekleine Indiz so lange hin und her, bis sie dich ausfindig gemacht haben. Sie werden unsere Fingerabdrücke finden, sie werden Gott weiß was alles da draußen finden. Du kannst das nicht machen, Sam.«
»Ich hab kein Vorstrafenregister und du auch nicht – mit den Fingerabdrücken können die nichts anfangen.«
»Oh, mein Gott.«
»Was ist?«
»Wenn es da draußen tatsächlich einen Mord gegeben hat, werden sie mich sowieso befragen. Ich hab einen Schlüssel zu dem Haus. Ich sag ja, Sam, ich bin kein guter Lügner.«
»Du könntest ihnen die Wahrheit erzählen. Du warst an einem anderen Tag da draußen. Aus irgendeinem Grund wolltest du nach dem Rechten sehen, und das war’s – du hast nichts Verdächtiges bemerkt. Und das ist die Wahrheit, also hast du keinen Grund, nervös zu sein. Du brauchst mich nicht zu erwähnen.«
»Sam, melde dich nicht bei der Polizei. Lass diesen Anruf. Ich darf da nicht reingezogen werden. Und du auch nicht. Ich muss los. Ich muss nachdenken. Bitte unternimm nichts, Sam.«
»Ich hab mein Handy verloren. Was ist, wenn er das hat? Wenn er mein Kennzeichen gesehen hat? Was ist, wenn er denkt, ich kann ihn identifizieren, und er ist hinter mir her?«
»Wenn er dich unbedingt in die Finger kriegen wollte, hätte er es gestern Nacht versucht. Er hätte dich mit dem Wagen verfolgen können, richtig? Hat er aber nicht. Weil er weiß, dass du überhaupt nichts identifizieren kannst.«
»Was ist, wenn er versucht, mich zu töten, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen? Hab ich das wirklich gerade gesagt? Die Sache ist ernst, Randall.«
»Ich muss los. Ruf mich nicht an. Wenn die Polizei anfängt, Anrufnachweise zu überprüfen, ist die Hölle los. Und wir sehen uns besser eine Weile nicht.«
»Nein, sag das nicht.«
»Nur als Vorsichtsmaßnahme – wir wollen doch das, was wir haben, nicht aufs Spiel setzen? Das, was wir miteinander haben, ist zu kostbar, um es aufs Spiel zu setzen, oder?«
»Ja.«
»Also gut. Ich ruf dich bald an.«
»Ich liebe dich, Randall. Ich muss dich sehen.«
»Ich dich auch. So sehr. Ich muss los.«
3
Nach dem Abendessen saß John Cardinal am Küchentisch und merkte erst nach einer Weile, dass er die ganze Zeit sein eigenes Spiegelbild im Fenster angestarrt hatte. Er stand auf, schaltete das Licht aus und setzte sich wieder. Sein Gebäude mit Eigentumswohnungen befand sich an einem Hang mit Blick über die nördliche Bucht des Lake Nipissing, und nachdem das Licht aus war, nahm die Oberfläche des gefrorenen Sees in der Scheibe Gestalt an. Der Dreiviertelmond war so hell, dass er fast alle Sterne überstrahlte und einen breiten, schmutzig weißen Pfad quer durch den Schnee bis zu Cardinals Fenster erleuchtete. Die Baumkronen, die das Ufer säumten, wiegten sich in der Brise, auch wenn er sie durch die Doppelverglasung nicht hören konnte.
Die Mahlzeiten waren immer noch ein wunder Punkt. In den ersten sechs Monaten nach Catherines Tod hatte Cardinal vor dem Fernseher gegessen. Er sah nicht gerne fern, aber es war immer noch besser, als ständig nur auf den leeren Platz zu starren, auf dem Catherine gesessen und ihm von ihren Studenten oder ihrem letzten Fotoprojekt erzählt hatte. Irgendwann wurde es ihm unerträglich, und so bot er das kleine Haus am Trout Lake – das Haus, in dem er fast zwanzig Jahre lang mit Catherine und ihrer gemeinsamen Tochter gelebt hatte – zum Verkauf an. Irgendwie war er zu dem Schluss gekommen, dass er an dieser Bruchstelle in seinem Leben besser in einer Wohnung leben sollte. Eine Wohnung passte nicht im mindesten zu Catherine. Genau genommen auch nicht zu Cardinal. Als er in jungen Jahren in Toronto lebte, hätte er sich vielleicht als Stadtmensch eingestuft, doch jetzt nicht mehr. Jetzt war er einfach nur ein Mann, dessen Frau gestorben war und der in dem, was von seinem Leben noch übrig war, keinen großen Sinn erkennen konnte.
Er schaltete das Licht wieder ein und griff nach der obersten Mappe auf einem ganzen Stapel alter stockfleckiger, verfärbter Akten. Unter dem Gummiband, das den obersten Schnellhefter zusammenhielt, steckte eine Notiz des Chief mit der Mahnung an die Kripo, sich bei der Aufklärung alter ungelöster Fälle ordentlich ins Zeug zu legen. Es ging doch nichts über die Lösung eines alten, rätselhaften Verbrechens und das erhebende Gefühl, einen Täter, der allzu lange auf freiem Fuß gewesen war, vor Gericht zu bringen und das Vertrauen der Bürger in ihre örtliche Polizei wiederherzustellen. Insbesondere waren sie angehalten, alle Technologien, Datenbanken und Verfahrensweisen auszuschöpfen, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ermittlungen noch nicht zur Verfügung standen. Wenn Chief R.J. Kendall bei seinen Mitarbeitern Begeisterung entfachen wollte, hielt er flammende Sonntagsreden. Wir müssen uns als Besucher aus der Zukunft begreifen, die eine Zeitreise in die Vergangenheit machen, um ihren ratlosen Kollegen von damals zu Hilfe zu eilen.
R.J. besaß die Gabe des Politikers, eine Maßnahme, die ihm aufgezwungen worden war, als persönliche Herzensangelegenheit, als Ausdruck seines Gutmenschentums zu verkaufen. In diesem Fall war der zündende Funke ein landesweiter kriminalstatistischer Bericht über die Aufklärungsquoten der verschiedenen örtlichen Behörden. Gewöhnlich erfassten solche Erhebungen nur größere Städte ab einer Einwohnerzahl von über einhunderttausend. Dieses Jahr hingegen hatte ein Bürokrat, der mit seiner Zeit nichts Besseres anzufangen wusste, einen Vergleich zwischen kleineren Städten vorgelegt, und obwohl man eine Reihe triftiger Gründe anführen konnte, weshalb diese Ergebnisse nicht besonders aussagekräftig waren, konnte dies Chief Kendalls Entrüstung über den Skandal, dass die Polizei von Algonquin Bay nur knapp über dem Durchschnitt eingestuft worden war, kaum beschwichtigen. Auch wenn der Chief es nicht ausdrücklich erwähnte, rieb er sich, wie Cardinal sehr wohl wusste, vor allem daran wund, dass Parry Sound und Sudbury, zwei an Größe, demographischer Zusammensetzung und geographischer Lage vergleichbare Städte, bei dem Vierzig-Jahres-Mittelwert weit besser abschnitten. Sie machten neben diesen Gemeinden keine gute Figur, und sogar The Globe and Mail hatte über das seltsame Phänomen berichtet.
Folglich lag der Fall Scriver mit einem Gesamtgewicht von zwanzig Pfund auf Cardinals Küchentisch. District Superintendent Chouinard hatte die sechs Detectives ihrer Abteilung je drei ungelöste Fälle aus einem Hut ziehen lassen, und Cardinal hatte Oldham (mutmaßlicher, doch nicht bewiesener Mord durch Ehegatten), Sloane (vermisster Achtjähriger, mutmaßlicher Unglücksfall) sowie Scriver erwischt. Als dieser letzte Name vorgelesen wurde, hatten Cardinals Kollegen sich nicht die geringste Mühe gegeben, ein Feixen zu unterdrücken.
Delorme dagegen hatte Lonnie Laird, ein vermisstes junges Mädchen, erwischt, das aller Wahrscheinlichkeit nach dem Serienmörder Laurence Knapschaeffer zum Opfer gefallen war, auch wenn dafür bis dato die Beweise fehlten. Es kostete Delorme genau eine Fahrt nach Penetanguishene zur Anstalt für geistesgestörte Straftäter und eine fünfundvierzigminütige Befragung, um Knapschaeffer ein schriftliches Geständnis zu entlocken. Vielleicht war der Erfolg ihren hervorragenden Ermittlerfähigkeiten gedankt, vielleicht aber auch – wie Ian McLeod mutmaßte – der Tatsache, dass Knapschaeffer noch nie zuvor die ungeteilte Aufmerksamkeit einer so attraktiven Frau vergönnt gewesen war.
Scriver war der älteste ungelöste Fall in der Geschichte der Kripo Algonquin Bay, die sich zusammen mit den Kollegen von der OPP, der Provinzpolizei Ontario, immer wieder die Zähne daran ausgebissen hatte. Schon bei Cardinals Dienstantritt lag der Fall Jahre zurück. Inzwischen waren sämtliche Beamten, die damals daran gearbeitet hatten, entweder längst pensioniert oder verstorben.
Um den 15. Juli 1970 herum hatte die Familie Scriver mutmaßlich in ihrem kleinen Boot mit Außenbordmotor ihr Cottage am Trout Lake verlassen und war nie zurückgekehrt. Die Cottagetür war nicht abgeschlossen. Die Reste des Abendessens standen noch auf dem Tisch. Keinerlei Anzeichen von Gewalteinwirkung.
Die Vermissten: Walt Scriver, fünfundvierzig, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Amt für Land- und Forstwirtschaft (wie das Naturschutzamt damals noch hieß). Seine Frau Jenny Scriver, dreiundvierzig, Hausfrau und Teilzeitlehrerin. Ihr achtzehnjähriger Sohn Martin, der von seinem Ferienjob bei der Rotwildzählung übers Wochenende nach Hause gekommen war. Alle, wie es aussah, bei einem Unfall ertrunken.
Cardinal schrieb in großen Buchstaben auf seinen Block: Gelöst: Entführung durch Außerirdische.
Es klingelte an der Wohnungstür, und Cardinal ging zur Gegensprechanlage, um Lise Delorme hereinzulassen. Zu den unvorhergesehenen Vorteilen seines Wohnungswechsels gehörte es, dass jetzt nur fünf Fußminuten zwischen ihm und Lise Delorme, seiner Lieblingskollegin, lagen. Bei seinem Einzug war Delorme vorbeigekommen und hatte ihm dabei geholfen, Teppiche zu entrollen und Gardinen aufzuhängen. Einfach nur aus Freundlichkeit, nahm Cardinal an, sie hätte dasselbe für jeden anderen getan.
Da stand sie nun – eine DVD in der einen Hand, eine riesige Dose Popcorn in der anderen, burschikos in Flanellhemd und Jeans in seiner Tür. Eine Frau, die so wenig nach einer Polizistin aussah, musste man erst mal finden.
»Monster«, sagte sie und hielt die DVD hoch. Auf der Hülle prangten überdimensionale Insekten. »Oder meinst du, das erinnert zu sehr an die Arbeit?«
Cardinal legte die DVD ein und hantierte ein paar Minuten an der Fernbedienung herum, die nie zweimal nacheinander funktionierte.
»Mann, ist das schwül hier drinnen«, sagte Delorme. »Haben die immer noch nicht deine Ventilation repariert?«
»Erinnere mich bloß nicht daran. Dieser Wohnungskauf war vielleicht einer der dümmsten Fehler meines Lebens.«
Delorme warf einen Blick auf den Aktenstapel. »Hey, gratuliere. Wie ich sehe, hast du Scriver gelöst.«
»Sicher. War eigentlich ganz einfach.«
Cardinal in seinem Fernsehsessel, Delorme auf der Couch. Er hielt immer eine Steppdecke zusammengefaltet über der Rückenlehne bereit, weil Delorme schnell fror – diese riesigen Flachglasfenster mit Blick über den See. Delorme war irgendwo zwischen dreißig und vierzig, von feurigem Temperament und mit einer einnehmenden Figur. Mehr als einmal hatte Cardinal den Drang verspürt, über den kleinen Tisch zu greifen, der sie beide trennte, und sie zu berühren, doch er hatte der Versuchung widerstanden. Diese Freundschaft zwischen ihnen hatte sich einfach ergeben, und schon bald fühlte es sich so an, als wäre es schon immer so gewesen und würde für immer so sein.
Sie erzählte ihm gerade von einem Jäger, den man nach zwei mühseligen Rasterfahndungen in der Nähe des Reservats am Nipissing gefunden hatte – mit ein paar Frostbeulen, aber sonst wohlauf. Zwei oder drei Mal im Jahr verirrten sich Jäger und zehrten an den Ressourcen der Polizei, ganz zu schweigen von der Geduld derjenigen, die nach ihnen suchen mussten. »Was stimmt mit diesen Leuten nicht?«, fragte sie. »Haben die noch nie was von GPS gehört?«
»Eine Menge Machos bilden sich was darauf ein, so etwas nicht nötig zu haben. Wie läuft’s mit Shane?« Für die Dauer der FBI-Warnung und des Vorspanns schaltete Cardinal den Ton aus.
Delorme zog sich die Decke um die Schultern und achtete darauf, nicht ihre Schüssel mit Popcorn umzustoßen. »Wir waren Mittwochabend essen. Lief so ganz nett.«
»Klingt nicht gerade überschwänglich.«
Delorme zuckte die Achseln und stopfte sich eine Handvoll Popcorn aus der Schale in den Mund. »Bin ich auch nicht.«
»Wahrscheinlich redet ihr viel über den Beruf.«
Delorme verzog das Gesicht. »Ehrlich gesagt, halte ich Shane für keinen so tollen Anwalt. Scheint nicht allzu viele Freisprüche rauszuschlagen.«
»Das liegt an der unheimlichen Kompetenz der örtlichen Polizei.«
»Wenn ich das nur glauben könnte.«
»Na ja, irgendwas muss er ja haben, sonst gingest du nicht ständig mit ihm aus.« Es verblüffte Cardinal, dass er mit Delorme über ihr Liebesleben reden konnte. Noch vor einem Jahr wäre das undenkbar gewesen, doch jetzt erschien es selbstverständlich.
»Shane ist jemand, mit dem man mal essen geht«, sagte Delorme. »Oder ins Kino. Nicht viel mehr.«
»Ein bisschen dürftig, findest du nicht?«
»Sagt der Richtige. Du gehst überhaupt nicht aus. Du scheinst es nicht mal in Erwägung zu ziehen.«
Cardinal drückte auf die Fernbedienung, und der MGM-Löwe brüllte.
Die ersten paar Minuten des Films waren selbst für Cardinal, der eigentlich keine Science-Fiction-Filme mochte, amüsant. Der pummelige Freund der Hauptfigur war gerade von einem äußerst schleimigen Tentakel von der Bildfläche gerissen worden, als das Telefon klingelte.
Sie fuhren zum Trout Lake hinaus. Am gefrorenen Ufer, dem Umweltschutzamt und dem Jachthafen vorbei. Sie ließen die Madonna Road hinter sich, in der Cardinal mit Catherine und ihrer Tochter gelebt hatte. Noch ein paar Kilometer, und sie bogen hinter der Chinook Tavern, einer Raststätte auf der linken Seite, nach rechts in die Island Road ab. In den Bergen mit den unzähligen Kurven drückte Delorme nicht aufs Gaspedal. Keiner von beiden sagte ein Wort, als hielten sie die Luft an.
Die Island Road hieß so, weil an ihrem Ende lediglich ein einziges Haus steht und dahinter nur noch das Wasser des derzeit zugefrorenen Trout Lake kommt. Vor dieser Landzunge, etwa einen Kilometer entfernt und wie das Tüpfelchen auf dem i, liegt eine hübsche Insel.
Weiße Birken schossen als endlose Palisadenwand vorbei; der Mond schimmerte auf Blautannen und Zedern. Mulmig wäre vielleicht zu viel gesagt, doch als Delorme an der Einfahrt zum letzten Haus vor dem gelben Absperrband hielt, schwante Cardinal nichts Gutes. Das war normal, wenn man an den Tatort eines Mordes kam, doch das allein war es nicht. Delorme sah blass und grimmig aus, zweifellos aus dem gleichen Grund wie er.
Sie stiegen aus und nickten dem jungen Polizisten zu, der direkt hinter dem gelben Band wartete. Er stellte sich als Police Constable Rankin vor und deutete mit seiner Taschenlampe in die Richtung links neben der Einfahrt. »Das da sind meine Spuren«, sagte er. »PC Gifford ist am Haus. Ich bin hierher zurückgelaufen und dachte mir, ich nehme besser eine Route, wo sonst noch keiner entlanggekommen ist.«
»Wo steht Ihr Streifenwagen?«
Er zeigte mit einem dicken Fausthandschuh die kurvige Einfahrt entlang.
Sie waren direkt über Reifenspuren gefahren, die sich später als wichtig erweisen konnten, doch Cardinal nahm es ihnen nicht übel. Schließlich hatten sie nicht gewusst, was für eine Situation sie vorfinden würden.
Er duckte sich unter dem Band hindurch und folgte dem Lichtstrahl seiner Taschenlampe Richtung Haus. Delorme hielt sich direkt hinter ihm, um die Reifenspuren nicht noch mehr zu beschädigen. Die Abdrücke warfen tiefe Schatten im Schnee.
Die Einfahrt war lang – genau genommen eine Straße für sich. Und sie war so kurvig und hügelig, dass sie das Haus am See erst hinter der letzten Anhöhe sehen konnten. Es war zusammen mit den Bäumen und der gefrorenen Wasserfläche vom Mondlicht überflutet.
Cardinal hatte das Haus noch nie von dieser Seite aus gesehen, auch wenn er es schon oft bei einer Bootsfahrt vom See aus bewundert hatte. Hier an der Spitze der Landzunge, welche die Four Mile Bay vom Hauptteil des Trout Lake trennte, mussten die Eigentümer zweifellos einen spektakulären Blick genießen. Bei dem Haus handelte es sich um einen lang gestreckten, niedrigen Bungalow, der aus Klinker und Stein sowie reichlich Zedernholz errichtet war. Er wusste nicht, wer dort lebte, sondern nur, dass die Besitzer ein leuchtend rotes Kanu besaßen, das den ganzen Sommer über am Landesteg angebunden war. Cardinal blieb stehen, Delorme ebenfalls. Sie sah ihn durch ihre Atemwolke mit einem fragenden Blick an.
»Woran denkst du als Erstes, wenn du das hier siehst?« Cardinal machte eine ausladende Bewegung, die den Wald, den See und die Insel einschloss.
»Abgeschiedenheit.«
»Geht mir genauso«, sagte er und setzte seinen Weg fort. Bei jedem Schritt knirschte der Schnee.
Eine junge Polizistin, die vor dem Haus stand, hob ihre Taschenlampe, um zu sehen, mit wem sie es zu tun hatte. Cardinal kannte sie flüchtig vom Revier.
»Police Constable Gifford«, sagte sie. »Ich weiß, wer Sie beide sind.«
Cardinal zeigte auf die verwischten Fußspuren vor der Eingangstür. »Ich hoffe, da sind keine von Ihnen dabei.«
»Nein, aber da drüben.« Sie wies auf Abdrücke unter dem Fenster. »Ich wollte sehen, ob es Überlebende gibt. Ich dachte, ich sollte reingehen – das Schloss zur Gartentür ist aufgehebelt, und ein Fenster ist zerbrochen –, aber der Staff Sergeant meinte, lieber nicht, wir sollten auf Sie warten, und das hab ich auch getan.«
»Wer hat es gemeldet?«
»Ein paar Jungs, die am Ufer entlanggelaufen sind. Sie schwören, sie hätten weder das Schloss noch das Fenster aufgebrochen, und ich glaube ihnen.«
»Eine Wanderung im Stockdunkeln?«, hakte Delorme nach.
»Ich weiß. Die sind so um die dreizehn, die Eltern übers Wochenende verreist, und der ältere Bruder ist vermutlich der denkbar schlechteste Babysitter.« Sie nannte die Namen der Jungen und eine Adresse in der Water Road am anderen Ufer, Richtung Stadt zurück. »Ich hab sie in den Streifenwagen gesetzt.«
Delorme lief zum Fenster an der Vorderseite des Hauses und hielt ihre Taschenlampe an die Scheibe.
»Tief Luft holen, bevor Sie sich das antun«, sagte Gifford. »So was hab ich noch nie gesehen.«
Delorme trat vom Fenster zurück und drehte sich um.
Cardinal folgte ihrem Beispiel und leuchtete ebenfalls mit der Taschenlampe hinein. Die Leichen befanden sich im rückwärtigen Teil des Hauses, auf diese Entfernung kaum mehr als Silhouetten. »Himmel«, sagte er und machte einen Schritt nach hinten.
Er begab sich, gefolgt von Delorme, zur Gartenseite des Hauses.
»Wir hätten den Wagen wahrscheinlich an der Straße stehen lassen sollen«, sagte Gifford. »Aber nach der spärlichen Information hätte es alles Mögliche sein können, von einem Fehlalarm aus Spaß bis zur Geiselnahme. Hab allerdings versucht, nicht darüberzufahren.« Sie wies auf die Reifenspuren zwischen dem Haus und der Streife. »Die waren schon da.«
»Zwei Fahrzeuge«, sagte Cardinal. »Und deutliche Spuren.«
»Soll ich mit Ihnen reinkommen?«
»Wir brauchen Sie hier. Bitte sorgen Sie dafür, dass niemand auf die Eingangsstufen tritt«, antwortete Cardinal.
Sandy und Doug waren dreizehn und vierzehn Jahre alt. Beste Freunde. Normalerweise würde man annehmen, dass sie von dem, was sie gesehen hatten, traumatisiert sein mussten, doch Cardinal wusste, dass sie ihm mit strahlenden Augen entgegenblicken würden. Er und Delorme nahmen jeder getrennt ihre Zeugenaussagen auf, wobei die einzige Schwierigkeit darin bestand, ihren Redeschwall zu bremsen. Sie waren an der Südseite der Halbinsel gelaufen, nicht auf dem Eis, sondern am Ufer. Sie hatten keinen Unfug geplant, sondern nur eine kleine Wanderung am Wasser entlang. Doch dann hatte die Neugier gesiegt, und sie kamen auf die Idee, heimlich in die Fenster des Hauses an der Spitze der Landzunge zu spähen.
Kaum hatten die Jungen einen Blick durchs Fenster an der Rückseite geworfen und »wie die Reiher gekotzt«, hatten sie die Polizei verständigt. Die Constables Gifford und Rankin waren eingetroffen, hatten durchs Fenster gesehen und sie aufgefordert, im Wagen zu warten.
Cardinal richtete seine Taschenlampe auf die Fußstapfen, die vom See zum Haus führten, und diejenigen in die umgekehrte Richtung. »Waren hier schon irgendwelche Spuren, bevor ihr zum Haus raufgegangen seid?«
Die Jungen sahen einander an und schüttelten den Kopf.
»Die Gartentür ist aufgehebelt, und ein Fenster ist aufgebrochen«, sagte Cardinal. »Habt ihr davon irgendwas mitbekommen?«
Wieder schüttelten sie den Kopf.
Nach ein paar letzten Fragen gab Cardinal ihnen seine Visitenkarte. »Habt ihr schon irgendjemandem davon erzählt?«
»Nee«, sagte der Jüngere.
»Gut. Verkneift es euch bis morgen früh – wir wollen vermeiden, dass die Bösen etwas davon mitkriegen, bevor es in den Nachrichten kommt. Ihr habt euch richtig verhalten, als ihr die Sache gemeldet habt. Wartet im Wagen, und wir lassen euch von jemandem nach Hause fahren.«
Die Jungen sahen sich enttäuscht an. »Wir würden eigentlich ganz gerne bleiben und den Leuten von der Spusi zugucken, falls es Ihnen nichts ausmacht«, schlug der Ältere vor.
»Tut mir leid. Ich kann am Tatort kein unnötiges Personal gebrauchen.«
»Die Ersten am Tatort«, korrigierte der Jüngere. »Wir sind wichtige Zeugen!«
»Da hast du recht, Detective, falls es zum Prozess kommt. Aber jetzt müsst ihr euch verziehen.«
Während er und Delorme sich zur Gartenseite des Hauses umdrehten, sagte Cardinal: »Jemand sollte es hier hinten weitläufig absperren, damit uns nicht noch mehr Spusi-Fans in die Quere kommen.«
Die zwei Kriminaltechniker trafen ein und kämpften sich ebenso wie Cardinal und Delorme in Papieranzüge mit Gummisohlen, die dafür sorgten, dass sie möglichst wenig auf den Tatort einwirkten. Bunny-Anzüge nannten sie die Dinger.
»In einer Hinsicht haben wir schon mal Glück«, sagte Cardinal. »Wir haben gute Fußspuren, die noch nicht zugeschneit sind. Bevor wir reingehen, machen wir erst mal Fotos und Videos von sämtlichen Spuren an der Eingangstür, den Seiten und der Rückfront des Hauses. Wenn wir uns das später ansehen, sollten wir hundertprozentig sicher sein, was schon da war und was nicht.«
Paul Arsenault, der Leiter der Spurensicherung, schaltete seine Videokamera ein, während er sprach, und sein Kollege Bob Collingwood forderte die zwei jungen Zeugen auf, noch einmal aus dem Streifenwagen zu steigen und frische Fußspuren zu machen, die er unter hellem Licht fotografierte. Die Jungen kamen der Aufforderung in feierlichem Ernst nach.
Als sie bis zur Gartentür alles abgelichtet hatten, ging Cardinal, gefolgt von Delorme und dem Gerichtsmediziner, hinein.
»Die Heizung ist ausgeschaltet«, sagte Cardinal. »Eigentümer würden sie runterdrehen, aber nicht ausschalten – beim ersten harten Frost platzen die Rohre.«
Die Toten, es waren zwei, saßen einander gegenüber, als hätte der Kegel des Mondlichts sie mitten im Gespräch in einer Momentaufnahme eingefangen. Cardinal merkte, wie sich ihm die Nackenhaare aufstellten. Er knipste die Lampen an und trat näher an die Leichen heran, um erst die eine, dann die andere zu betrachten. Eine männlich, eine weiblich, beide abscheulich verkürzt, beide in schöne Pelzmäntel gehüllt, eine in Zobel, eine in Nerz.
»Zunächst einmal«, sagte Cardinal, »haben wir eine Sperrfrist.« Er zeigte auf den Messergriff, der dem toten Mann aus dem Rücken ragte. »Behalten wir das Messer vorerst für uns.«
Gedämpftes Gemurmel im Raum. Collingwood machte ein paar Nahaufnahmen. Arsenault war noch draußen, um dort weiter Indizien festzuhalten.
Cardinal suchte in der Tasche des Mannes nach Ausweispapieren, Delorme bei der Frau. Nichts.
»Kein Mensch hat so leere Taschen«, sagte Cardinal. »Keine Schlüssel, kein Kleingeld, keine Quittungen.« Er kniete sich hin, um den Opfern die Lederhandschuhe von ihren Händen zu ziehen. Die Hautfarbe erinnerte an Tiefkühl-Truthahn. Er vermied es, einen von ihnen oberhalb der Schulter anzusehen, da, wo ihre Gesichter hingehörten. »Wer ist das?«, fragte Cardinal in den Raum hinein. »Kennt die jemand?«
»Ruth und Joseph Schumacher.« Die Bemerkung kam von Neil Dunbar. In seiner Kapuze und dem Overall wirkte er, als er durch die Küche hereinkam, irgendwie plump. »Ich hab sie im Telefonbuch im Straßenverzeichnis nachgeschlagen, bevor ich in den Wagen gesprungen bin. Denen gehört das Haus seit zwanzig Jahren.«
»Besagt noch lange nicht, dass sie es sind«, erwiderte Cardinal. Dunbar war neu im Dezernat, er war jung und das, was ihr Vorgesetzter »selbstmotiviert« zu nennen pflegte.
Cardinal trat an ein rustikales Kiefernbüfett, auf dem jede Menge gerahmte Fotos standen, darunter auch ein Bild von einem Paar, das im Sommer vor dem Haus stand.
»Die Frau auf dem Foto trägt einen einfachen Ehering, genau wie der Mann. Die beiden hier«, sagte Cardinal und zeigte auf die vier toten Hände, »sind ein wenig fleischiger, finden Sie nicht?«
Dunbar kam näher und inspizierte die Hände. »Schließt aber nicht aus, dass sie es sind.«
»Und dann die Haut der Frau. Diese Person hier ist erheblich jünger als die Frau auf dem Bild.« Er zeigte auf ihre Füße. »Der Mann trägt Schuhe. Wieso sie nicht?«
»Hat sie an der Haustür ausgezogen«, sagte Delorme. »Sie trug teure Lederstiefel, er zweifarbige Halbschuhe. Ich würde sagen, das hier sind nicht die Leute, die zur Hintertür eingebrochen sind.«
»Was meinst du, was seine Wingtips gekostet haben? Dreihundert? Mehr? Offensichtlich kein Polizist.«
Der Gerichtsmediziner Dr. Beasley war in zehn Minuten fertig. Er schrieb etwas auf ein Formular, riss das oberste Blatt ab und reichte es Cardinal. »Vorläufiger Befund: Verbrechen. Sie werden alles brauchen, was Toronto zu bieten hat.«
»Das war’s schon?«
»Zum Todeseintritt kann ich Ihnen nur sagen, dass es mindestens acht Stunden, weniger als achtundvierzig Stunden her ist. Sie müssen sie auf einen Autopsietisch in Toronto legen, um den Zeitpunkt weiter eingrenzen zu können. Der Messerstich im Rücken erfolgte post mortem, das Trauma am Hals ebenfalls.«
»So schnell hab ich noch keinen Gerichtsmediziner gehen sehen«, stellte Delorme fest, als er draußen war.
»Wahrscheinlich hat ihm die Atmosphäre nicht behagt«, sagte Cardinal.
Delorme wandte sich den Projektilen zu – vielleicht unbewusst, um den beiden entmenschlichten Gestalten den Rücken zukehren zu können. Hinter dem Mann steckte ein Geschoss in der Wand, ein anderes fand sich unter dem Büfett. Sie beschriftete Etiketten, die sie von den Technikern fotografieren ließ.
Collingwood untersuchte die Leichen und befasste sich gerade wie ein Affe, der seinen Partner laust, mit den Pelzmänteln.
Cardinal konzentrierte sich unterdessen auf den Tisch, um in der Art, wie er gedeckt war, irgendeinen Sinn zu erkennen. Drei Wodkagläser. Eine Flasche Stolichnaya.