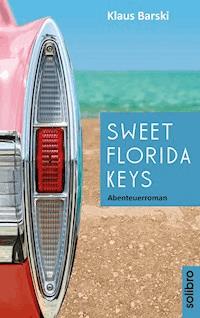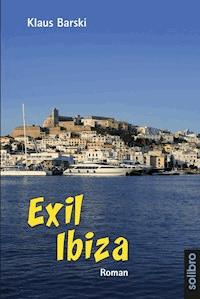
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Solibro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: cabrio
- Sprache: Deutsch
Der selbständige Werbefachmann Bernd Kleiner verliert Mitte der 70er Jahre nicht nur den besten Kunden sondern auch seine Ehefrau. Um wieder voranzukommen, überfällt er für eine ominöse Organisation einen Pfandleiher, der dabei aber leider schwer verletzt wird. Obwohl nur 40.000 DM erbeutet wurden, spricht man in der Presse von einem Millionenraub. Verfolgt von Polizei und der Organisation, mit der er die Millionenbeute teilen soll, flüchtet er nach Ibiza und nennt sich fortan Ben Benjamin. Er genießt das Leben zwischen Residenten, Steuerflüchtlingen, Touristinnen und Neureichen und wähnt sich in Sicherheit. Doch wie viele Residenten mit ein bisschen Geld, bekommt er es auch noch mit der Insel-Mafia zu tun. Doch viel entscheidender ist für Ben die Frage: Wird er von seiner deutschen Vergangenheit eingeholt werden? Der Autor, Immobilienspekulant und (Erfahrungs-)Millionär Klaus Barski lebte sechs Jahre als Aussteiger auf Ibiza. Sein abenteuerlicher Insiderroman spielt in der Residentenszene. Er ist aber nicht nur unterhaltsam und spannend, sondern auch informativ. Denn Barski hat viele seiner eigenen Erfahrungen und Erlebnisse auf dem Weg durch sein erfolgsverwöhntes Leben in die Story einfließen lassen. Ein Muss für Ibiza-Insider und Neuaussteiger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Barski, einer der von ganz unten kommt (Arbeiterfamilie, keine Schulbildung, Arbeitsbeginn mit 13 Jahren), schaffte mit harter Arbeit und gesundem Geschäftsinstinkt den Aufstieg vom Volksschüler und Sozialhilfeempfänger zum millionenschweren Immobilienkaufmann und Schriftsteller. In all seinen Romanen schildert er mitreißend, schonungslos und doch immer mit einem selbstironischen Augenzwinkern knallharte, oftmals abenteuerliche Erfahrungen, wie sie ihm auch auf seinem Lebensweg in ähnlicher Weise widerfahren sind. Klaus Barski ist dementsprechend natürlich kein Leisetreter. Gerne erzeugt der Werbeprofi Aufsehen. So als er anlässlich der Veröffentlichung seines Romans Der deutsche Konsul medienwirksam echte und gefälschte Dollars aus dem Fenster warf. Oder als er mit Luxuslimousine im Frankfurter Café Schwille aufkreuzte um seinen Ozelot an einer Eisenkette auszuführen – Klaus Barski: eben ein echter (Erfahrungs-)Millionär mit Tick und Charme.
Bibliografie
Der Frankfurter Spekulant (1999) •
Der Loser (2000) •
Der deutsche Konsul (2001) •
Exil Ibiza (2003) •
Lebenslänglich Côte d’Azur (2005) •
Blut-Zeitung (2008) •
Prügel für den Hausbesitzer (2012) •
Sweet Florida Keys (2014) •
Klaus Barski
ExilIbiza
Roman
1. Jöricke, Frank: Mein liebestoller Onkel, mein kleinkrimineller Vetter und der Rest der Bagage. Solibro Verlag 1. Aufl. 2007ISBN 978-3-932927-33-1 / gebundene AusgabeISBN 978-3-932927-36-2 / Broschur-AusgabeeISBN 978-3-932927-53-9 (epub)
2. Barski, Klaus: Prügel für den Hausbesitzer Tatsachenroman eines Immobilienspekulanten Solibro Verlag 1. Aufl. 2012; ISBN 978-3-932927-48-5eISBN 978-3-932927-52-2 (epub)
3. Barski, Klaus: Sweet Florida Keys. Abenteuerroman Solibro Verlag 1. Aufl. 2014; ISBN 978-3-932927-78-2eISBN 978-3-932927-89-8 (epub)
4. Barski, Klaus: Lebenslänglich Côte d’Azur. Roman Solibro Verlag 1. Aufl. 2018; ISBN 978-3-96079-049-5eISBN 978-3-96079-050-1 (epub)
5. Barski, Klaus: Exil Ibiza. Roman Solibro Verlag 1. Aufl. 2018; ISBN 978-3-96079-051-8eISBN 978-3-96079-052-5 (epub)
6. Usch Hollmann / Markus Böwering: Wasserschloss zu vererben. Ein Münsterlandroman Solibro Verlag 1. Aufl. 2018; ISBN 978-3-96079-055-6eISBN 978-3-96079-056-3 (epub)
eISBN 978-3-96079-052-5
1. Auflage 2018
© SOLIBRO® Verlag, Münster 2018
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: © Wolfgang Neumann
Umschlagfoto: © Tono Balaguer/Shutterstock.com (Cover)
Fotos des Autors: S. 2: privat
www.solibro.deverlegt. gefunden. gelesen.
Barskis Figuren sind amoralisch und großkotzig,geldgierig und skrupellos, proletenhaft und brutal,kurz: Sie sind durchaus glaubwürdig.
Frankfurter Rundschau
Inhalt
Kapitel 1
Bernd Kleiner kaufte den 220 SB für sechstausend Mark. Eigentlich wollte der Besitzer neuntausend. Als Bernd ihn aber bei der Rundumkontrolle bat, die Motorhaube zu öffnen, und routinemäßig den Ölstab rauszog, war der milchig, schleimig. Der junge Mann gab zu, daß der Motorblock einen Riß hatte und Wasser zog.
Bernd Kleiner kaufte den sechzehn Jahre alten Mercedes trotzdem. Schließlich handelte es sich um ein altes, fünfsitziges Cabrio, und der Preis war günstig genug bei den zu erwartenden Reparaturkosten. Im Fachhandel warnte man ihn vor Druckproblemen, es wäre leichtsinnig, einen neuen Block einzubauen. So suchte er auf Autofriedhöfen herum und erwarb dort für ein paar hundert Mark das passende, alte Ersatzteil. Für insgesamt zweitausend Mark machte er die Schleuder wieder fahrbereit: ein cooler, silberner Dampfer mit rissigem Leder, gecracktem Holzfurnier, schlechtem Lack. Aber mit dem geilen Stern vorne drauf!
Die Heizung war defekt. Für jemanden, der zum Mittelmeer wollte, war das kein Thema.
Nach der Weitervermietung seiner Wohnung packte er zwei Koffer, einen Seesack und sein Metzler-Schlauchboot mit Zubehör, rief morgens ein Taxi und fuhr mit dem ganzen Krempel zur Werkstatt. Er stopfte alles in seinen Wagen und startete direkt von dort aus in Richtung Spanien.
Es war März und kalt. Er schaltete das vergammelte Radio auf AFN. Die hatten immer gute Musik. Gerade lief »Stairway To Heaven« von Led Zeppelin: »And a new day will dawn … And the forests will echo with laughter.«
Vollgetankt rauf auf die Autobahn, Kleiner mit schwarzer Sonnenbrille, blödsinniger Prinz-Heinrich-Mütze und dem schmalen Oberlippenbart, den er noch stehen ließ. Er ging auf Nummer sicher.
»And it makes me wonder«, dröhnte der Refrain.
Er fühlte sich schwach, am Ende. Er, der immer der Größte, der Geilste, der Erfolgreichste sein wollte, hatte Scheiße gebaut. Einen Menschen kaputt-, sich kaputtgemacht. Nun war er auf der Flucht. War nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihn kriegten.
Vor Jahren, am SPD-Wahlstand, war er auf Ronski getroffen. Bei der Demonstration. Diesen korrupten Parteischergen, der Baudezernent werden wollte.
Trotz der langen Zeit hatte Ronski Kleiner jetzt wiedererkannt. Wußte nicht mehr seinen Namen, aber daß er zu den Sympathisanten der Organisation gehörte. Die Polizei war bestimmt schon auf seiner Spur.
Sein Alter – zum Glück erlebte seine Mutter das nicht mehr – würde sicherlich triumphieren. Recht hatte er, als er damals sagte: »Du bist ein Lügenbaron, ein Tunichtgut. Wirst schlimm enden!«
Es wurde langsam dunkel. Er schaltete die Scheinwerfer ein. Bog bei Mannheim Richtung Saarbrücken und Metz ab. Es wäre wohl günstiger gewesen bis Mulhouse zu fahren, um südlich von Dijon auf die französische A7 zu kommen. Aber er wollte so schnell wie möglich raus aus Deutschland. Rüber, hinein in die französische Provinz. Fühlte sich dort sicherer. Das Wetter blieb gut. Kein Regen.
Die ganze Sache kratzte ihn total auf, hielt ihn hellwach.
Der AFN soff ab. Er bekam jetzt 'nen französischen Sender rein, der guten Modern Jazz spielte.
Mensch, war er fertig – total im Arsch!
Es kühlte inzwischen auch im Auto stark ab. Abwechselnd klemmte er mal die linke, mal die rechte Hand unter eine Arschbacke, um sie aufzuwärmen.
Er erreichte Saarbrücken und kurz darauf die Grenze. Die Kontrollen waren lasch.
»Ist okay«, rief man und »Au revoir!«
Endlich in Frankreich! Er tankte und ging pissen. Raste weiter nach Westen. Dann südlicher nach Nancy, Richtung Dijon. Allmählich wurde er müde. Merkte es zuerst an den Augen.
Er wollte sich wachhalten und begann zu singen: »Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten …«
Dijon las er auf dem Schild. Er war immer noch wach und jagte weiter durch die Nacht, Richtung Lyon. Nach dem Überfall am Mittwoch hatte er genau zwölf Tage Fluchtvorbereitung benötigt, bis er im Wagen saß. Wahnsinn!
Den ganzen Scheiß hatte er sich nicht nur für die lausigen einundzwanzigtausend Märker eingebrockt. Ronski im Auftrag der Organisation einen Denkzettel zu verpassen, war ja in Ordnung. Aber ihn fast totzuschlagen und obendrein die Gruppe zu beklauen – was war er nur für ein Idiot! Dumme Sau. Wie konnte er nur? Wie konnte er nur? Als ideeller Vollstrecker sich so gehenzulassen. Das war wie Verrat. Mader, der Kapo, würde es ihm nie verzeihen.
Wie weit muß der menschliche Wurm sein Tun eigentlich selbst verantworten? Vielleicht ist das ganze Leben total vorprogrammiert? Wenn du dich halbtot strampelst, ist das nur der Ablauf einer riesigen Robotermaschinerie? Dein harter, persönlicher Einsatz nur der vorab festgelegte Ablauf eines gigantischen, allmächtigen Gesamtplans?
Als er von einem Kleinmotorrad mit HH-Nummernschild überholt wurde, sah er auf dem Tacho, daß er nur neunzig fuhr. Er gab mehr Gas, steigerte auf Tempo hundertvierzig und zog nach ein paar Minuten an dem Hamburger vorbei. Jetzt überholte ihn keiner mehr. Um drei Uhr früh.
Er dachte plötzlich an die »gute, heile Welt« von damals. Wie schnell doch aus einem Gewinnertyp ein Loser wurde. Damals war er Besitzer einer erfolgreichen Werbeagentur. Und er dachte natürlich an Renate, seine damalige Frau. Alles gelaufen, aus und vorbei.
Renate war ein verwöhntes, bildhübsches Einzelkind, von Zuhause schwer verhätschelt. Ihm machte es Spaß, ihr alles zu ermöglichen, was immer ihre kleine, weiße Stirn gebar. Wie im Rausch kaufte sie die Hauseinrichtung zusammen – Geschmack hatte sie ja, allerdings einen teuren.
Er schwamm ganz oben, machte echte, große Kohle. Aber das reichte ihm nicht. Irgendwann traf er Minke. Der schwärmte von den wahren Aufgaben des Lebens, der Bewegung. Minkes Kumpel Mader war ein Schulfreund von Baader.
»Du mußt bei uns mitmachen«, schlug Minke vor. Na ja, zuerst half er der Organisation mal hier und mal da ein bißchen, mit Werbematerial und anderen Spenden. Über die Jahre wurde er vom Sympathisanten zum aktiven Mitglied. War ja auch eine starke Sache.
Dann kam der geschäftliche Big Kill, sozusagen aus dem Nichts heraus. Auf der Internationalen Textilmesse stellte ihm Schwerdtfeger aus Bremen, das war Kleiners größter Kunde, seinen besten Freund Engelmann aus Hamburg vor: »Größter Schwimmbad- und Saunahändler Norddeutschlands.« Ein fetter, stets lustiger Machertyp mit großer Schnauze und Millionenumsätzen.
Bisher bastelte Engelmann seine Werbung in Heimarbeit. Mit einem Dorfphotographen und der kleinen Vorstadtdruckerei. Als er Kleiners imponierende Arbeitsmappe sah, war er aus dem Häuschen. Kleiner erklärte ihm die Grundregeln des Einzelhandelsmarketings.
Engelmann, ein begnadeter Starverkäufer, sagte nur: »Sie sind der absolute Werbefritze. Genau der, den ich seit langem suche. Die Ergänzung zu meiner Verkaufsarbeit.«
Er bot Kleiner seinen Werbeetat an.
»Circa anderthalb Millionen fürs nächste Jahr«, stellte er in den Raum und wartete auf seine Reaktion.
Kleiner nickte cool dazu.
»Wie teilt sich der Betrag auf?«
»Ein Drittel für Anzeigen in Tageszeitungen, eins für Werbung in Schwimmbad- und Saunazeitschriften. Der Rest geht drauf für Farbprospekte und Messestände.« Und brüstete sich weiter: »Das macht mich im nächsten Jahr zum größten Händler Norddeutschlands.«
Kleiner wußte nicht, daß Engelmann nichts weiter war als ein großmäuliger Schwimmbadvertreter, der gerade einen Konkurs überlebt hatte und nun eine neue GmbH auf den Namen seiner Frau aufzog – mit ein paar tausend Mark Schwarzgeld, einem protzigen, viel zu teuer angemieteten Schau-Firmengebäude und einem ahnungslosen Partner, der das Erbe seiner Frau für einen dreißig prozentigen Anteil verjubelte: für einen Direktortitel, ein hübsches Büro und einen verlogenen Händedruck des betrügerischen geschäftsführenden Gesellschafters. Der umgehend die Hälfte der Partnereinlage in die Schweiz verschob, um noch Kohle zu haben, wenn der Laden in Schieflage geriet.
Engelmann bestellte bei Kleiner halbseitige und für später ganzseitige Anzeigen. Klotzte wie ein Wilder. Hatte sich aber zu dem Zeitpunkt schon längst übernommen. Zahlungsfähig blieb er nur, weil er ans Eingemachte ging, die Casheinlage seines Partners mußte dran glauben. Walter Samson war als technischer Direktor bei den Kunden für Installations- und Servicearbeiten zuständig und ahnte nicht einmal, was in Wirklichkeit geschäftlich lief.
Am Anfang gab Engelmann Bernd immer Akontozahlungen, er schuldete ihm von Monat zu Monat mehr Geld. Mit dem brutalen Werbeeinsatz hoffte er auf einen größeren, ihn rettenden Auftragseingang.
Kleiner bestellte den Anzeigenraum wie branchenüblich auf seinen Namen. Dann kam der Knall, nachdem er drei Wochen lang kein Geld von Engelmann erhielt, und dieser telephonisch und persönlich unerreichbar schien. Engelmann, der ihm sechshunderttausend Mark schuldete, wurde krank. Kleiner wartete – im Nachbarhaus versteckt – auf ihn. Der neue, teure Leasingmercedes fuhr vor, aber nur der verzweifelte Walter Samson stieg aus dem Fahrzeug.
»Ich hab' es nicht gewußt … und nicht gewollt. Er hat auf Teufel komm raus bestellt, gepraßt, geschummelt und geklaut. Ich habe das gesamte Familienerbe verloren. Wir sind pleite«, schluchzte Samson, als Kleiner ihn zur Rede stellte.
In diesem Frühjahr, 1975, verlor Kleiner den größten Kunden, seinen Bungalow, die Firmenräume, den guten Partner und – seine Ehefrau.
Sein Partner Erwin und er teilten sich die Kunden auf. Das Einkommen war immer noch ausreichend. Aber die nächsten zehn Jahre würden sie wegen der Schuldentilgung wie die Hunde leben.
Renate und er waren gerade in eine Mietwohnung umgezogen, da verlor er durch eine Fusion seinen verbliebenen größten Kunden: Schwerdtfeger. Jetzt mußten sie mit ein paar lausigen Mark auskommen … Woche für Woche. Es gab oft Streit.
Renate nannte ihn eine Niete, einen Träumer, einen linken Wichser, der mit den Losern der Linksradikalen nur rummachte, weil er sonst nichts hinkriegte. Sie wollte weiterhin Abend für Abend ausgehen. Die tolle Frau spielen. Mit dem Mercedes-Cabrio angeben.
Dann zog sie überraschend zu ihrer Mutter. Zugleich berichteten ihm Bekannte, Renate tauche häufig mit einem anderen Mann in der Szene auf.
Er reichte die Scheidung ein. Sechs Monate später waren sie offiziell getrennt. Von den Weibern hatte er die Schnauze voll.
Kein Wunder, denn vor Renate gab es Inge, seine erste große Liebe. Sie schwätzte ihm eine Autoklauidee als Kavaliersdelikt auf – und so kam er zu seiner Vorstrafe. Die würde ihm jetzt bei einer erneuten Verurteilung eine lange Haftzeit garantieren. Inge servierte ihn 1970 ziemlich gemein ab: tauschte ihn, den armen Teufel, einfach gegen Hoffman, den reichen Metzgereierben, aus.
Er konnte die Monatsraten nicht mehr zahlen und war fertig, total fertig. Nur deshalb kam er bei der letzten Zusammenkunft auf die blödsinnige, alles vernichtende Idee. Er übernahm freiwillig den Auftrag, Ronski, dem Pfandleiher, zu zeigen, wo's lang geht: ihm eine Schreckschußpistole vor den Bauch halten, Geld zu fordern und ihm in den Arsch treten.
Ronski stand wegen seiner Lobbyabkoche schon ewig auf der schwarzen Liste der Organisation. Und weil die für die leere Bezirkskasse dringend Geld brauchte, und Ronski eins auf die Fresse verdiente, schlug Minke vor, ihm einen Denkzettel zu verpassen. Kleiner wollte das erledigen.
Es war Essenszeit, und Ronski war allein. Der bleiche, graue, immer am Geld herumzählende, weißhaarige Mann erinnerte sich. Er erkannte Kleiner, den ehemaligen Demonstranten, wollte ihm den Colt entreißen. Zur Abwehr schlug Kleiner ihm die schwere Waffe ins Gesicht. Ronski fiel hin und der Rächer sprang über den Tresen. Da kam der Pfandleiher hoch, schrie laut um Hilfe.
Kleiner öffnete die Kellertür. Und schlug noch mal zu. Dann lag Ronski still und bewegungslos. Kleiner erblickte Ronskis goldene Rolex, ein sehr seltenes Modell mit rotem Rubinkranz. Er hielt einen Moment inne, rief dann: »Leichenfledderei? Nicht ich!« Er ließ Ronski die Uhr und stieß ihn durch die geöffnete Kellertür die Stufen hinunter.
Kleiner räumte die Kasse aus, klaute ein paar Geldbündel aus dem geöffneten Panzerschrank im Büro und eine offene Schmuckkiste vom Tresen. Dann torkelte er entsetzt davon, verlor noch das wunderschöne goldene Armband, die Goldschlange mit den roten Rubinaugen.
Er, Bernd Kleiner, der arme Irre! Für die Scheißidee der Organisation und jeweils einundzwanzig Mille für die und ihn, dafür ruinierte er seine Zukunft.
Ronski wurde ins Krankenhaus gebracht, hatte ziemlich schwere Verletzungen. Die Polizei vermutete hinter der Tat offiziell einen Kunden. Kleiner las es am nächsten Morgen in der Tageszeitung. Die Zeitung sprach von einem Millionenraub. Er konnte es nicht glauben. Die Organisation auch nicht.
Minke nahm mißtrauisch das »bißchen Differenzgeld« von den zweiundvierzigtausend, sagte ihm, daß er ihm glaube. Aber nur ein Gespräch mit dem Chef könne ihn wieder von der schwarzen Liste löschen. Doch Mader, der Chef, war untergetaucht, verschwunden, nachdem er auf allen Fahndungsplakaten der Polizei gesucht wurde. Kleiner wußte nicht einmal, wie er wirklich aussah. Hatte ihn nie gesehen.
Also organisierte er seine Flucht. Kaufte das Auto.
Am Tag vor seiner Abreise sah er ein schockierendes Bild in der Zeitung: Ronski im Rollstuhl mit großer Kopfbandage, dazu der Kommentar der verzweifelten, armen Ehefrau. Ronski war teilweise gelähmt.
Er hatte ihm den Schädel eingeschlagen, sein Gehirn verletzt. Eine widerwärtige, niedrige Handlung! Er hatte einen Menschen zum Krüppel gemacht. Ihn und seine Frau ums Leben betrogen. Für ein paar Silberlinge. Für das Schulterklopfen der Organisation. Für Geld zum Überleben.
»Ich kaputte Sau … ich kaputte Sau«, jammerte er laut vor sich hin und raste durch die Nacht in Richtung Mittelmeer.
Eine gescheiterte Existenz am Abgrund. Die Flucht schien ihm aber richtig zu sein. Zumindest tat er etwas. Erwischt zu werden, hätte Knast bedeutet, und das hätte keinem geholfen. Ihm nicht, Ronski nicht … niemandem.
Durch die Auflösungsgelder konnte er trotz Schuldenzahlung achtundzwanzigtausend Mark bunkern. Trug sie im prallen Brustbeutel unter dem Hemd. Das war sein Startkapital als Ben Benjamin. So taufte er sich gleich zu Fahrtbeginn.
Den Ausweis mit seinem richtigen Namen Bernd Kleiner würde er für die Einreise nach Spanien benützen, aber hinter der Grenze müßte er verschwinden. Dort würde Bernd Kleiner eliminiert werden, von da ab nicht mehr existieren. War eh ein Arschloch.
Hinter Dijon wurde er richtig müde. Obwohl es kalt war, öffnete er das Fenster, machte gymnastische Verrenkungen im Sitzen und sang weiter: »… dem Spaten … dem Spaten … ins Moor … ins Moor.«
Sein Tagesziel war Lyon. Er wollte durchhalten.
Auf einmal saß Inge neben ihm. Komisch, er konnte sich gar nicht erklären, wo sie so plötzlich hergekommen war. Sie piekte ihn mit dem Zeigefinger in den Bauch und sang mit ihm: »Wir sind die Moorsoldaten.«
Irgend etwas stimmte nicht.
»Du bist doch mit dem Hoffmann?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Dem Metzger?«
»Mit dem ist schon lange Schluß. Hat immer nach Blut gerochen. Widerlich! Mit dem ist Schluß.«
Ein gigantisches Dröhnen in seinen Ohren störte ihn. Er kämpfte hart dagegen an, um es abzuwehren, aber es wurde immer lauter. Furchtbar störend.
Plötzlich war er hellwach. Er fuhr rechts neben der Autobahn, auf dem Grasstreifen. Links von ihm in gleicher Höhe ein Lastwagen. Seine gnadenlose Hupe hatte ihn aufgeweckt. Gerade als er auf einen Brückenpfeiler zuhielt. Oh Gott …
Er riß das Steuer herum. Zum Glück hatte er allenfalls siebzig, achtzig Sachen drauf. Er kam wieder auf die Fahrbahn, hupte und blinkte zweimal.
Der Lastwagenfahrer erwiderte sein Hupen und fuhr davon.
Kleiner war wie gelähmt. Er mußte anhalten, denn er zitterte am ganzen Körper, hatte kaum noch Gewalt über den Wagen. Öffnete die Tür, zog sich am Wagendach hoch. Er versuchte zu stehen, wäre aber beinahe umgefallen. In einiger Entfernung konnte er ein Schild entziffern: »Nächste Tankstelle, 12 km.«
Okay, das mußte gehen. Er ließ sich hinters Lenkrad fallen, fuhr langsam weiter und rief sich unterdessen mehrmals laut zu: »Nicht einschlafen! Bloß nicht einschlafen!«
Mann, war er im Arsch. Doch er schaffte es irgendwie bis zum Rastplatz. Hielt auf dem ersten freien Parkplatz, lehnte sich nach rechts rüber und schlief sofort ein.
Die heiße Sonne weckte ihn um zehn Uhr vormittags. Jeder einzelne Knochen tat ihm weh. Fünfzig Kilometer vor Lyon.
Wenn der Pfandleiher gestorben wäre. Was dann? Er verdrängte die aufkommende Scheißidee. Zum Glück lebte Ronski. Aber wie? Wie ein Hund, ein Restmensch mit Hundeleben.
»Ich muß mit meiner angerichteten Lebensscheiße leben. Bleibt mir nichts anderes übrig. Vielleicht geht's dem Ronski über die Jahre besser«, versuchte er mit fadenscheinigen Argumenten sein schlechtes Gewissen zu beruhigen.
Wie sollte es jetzt weitergehen? Er war auf dem Weg zum Mittelmeer, hatte viel Geld in der Tasche. Und eine kleine Kiste mit Goldschmuck: teure Uhren, Ringe, Anhänger. Zum Teil mit guten Steinen drin. Beim Abhauen schnappte er sie sich. Eine Kiste mit den Pfandstücken des Tages. Alle waren numeriert.
Im Zeitungsartikel über den Rollstuhlfahrer Ronski sprach der Journalist von einem Millionenraub. Es handele sich um einen sechsstelligen Betrag in bar, der verschwunden sei, und um Juwelen mit einer noch höheren Versicherungssumme.
Unsinn! Er klaute rund zweiundvierzigtausend Mark, der Schmuck war vielleicht etwas mehr wert. Da sah man mal wieder, wie die Zeitungen aus 'nem Furz 'nen Donnerschlag machen. Er schüttelte den Kopf.
Kleiner erreichte Lyon. In den Tunneln überfielen ihn entsetzliche Wahnvorstellungen von Abermillionen Tonnen Gestein, die ihn jeden Moment zermalmen würden. Jetzt bloß kein Stau hier drin. Nach scheinbar endlos langer Zeit die Ausfahrt. Tageslicht. Er zitterte und sah bedrohliche Blitze vor den Augen.
Es half alles nichts, er mußte rechts raus auf einen Nothalteplatz. Mit geschlossenen Augen versuchte er, sich zu beruhigen. Es dauerte über eine Viertelstunde, bis die grellen Blitze aufhörten.
Sind das Durchblutungsstörungen im Gehirn? Erschrocken dachte er kurz über seinen körperlichen Zustand nach, startete aber bald wieder den Motor und fuhr entschlossen weiter in Richtung Südfrankreich. Der Himmel wurde blau. Nur ab und zu eine kleine Cumuluswolke. Und es wurde warm. Im Radio lief gute Beat-Musik, er kurbelte das Fenster runter und atmete die weiche, warme Luft tief ein. Augenblicklich stieg seine Laune.
»Ich komme wieder hoch! Und ich helfe dir heimlich, Ronski«, schwor er dem Fahrtwind. Nahm sich fest vor, dieses Versprechen wirklich einzuhalten.
Er bunkerte im Moment zwar gutes Geld, konnte aber unter seinem richtigen Namen nirgendwo leben und arbeiten. Nur illegal, mit falschem Namen und falschen Papieren. Auf jeden Fall mußte er nun sein Geld eisern zusammenhalten. Als Werbefachmann hatte er keine Chance, in Spanien Geld zu verdienen. Er sprach kein Wort Spanisch. Vielleicht als Maler oder als Gastronom? Mit einem Partner, einem zuverlässigen natürlich, der den Laden auf seinen Namen laufen ließ.
Was war er doch für ein verblendeter Idiot gewesen. Fünfundzwanzig Jahre alt und schon so 'ne Scheiße am Hals. Hoffentlich liefen die nächsten fünfundzwanzig besser!
Am Abend die spanische Grenze. Vorher hatte er vollgetankt und sich dabei vorgenommen, in aller Ruhe bis kurz vor dem Einschlafen weiterzufahren.
Vor den Uniformierten der spanischen Guardia Civil mit den komischen Lackhüten hatte er einen ordentlichen Bammel. Es war allgemein bekannt, daß die keinerlei Spaß verstanden und brutal werden konnten. Und er war genau der richtige Verbrechertyp, zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt, mit einem Mercedes-Cabrio. Verdächtig!
Kurz vor der Zollstation drängte sich ein weißer 230er Mercedes vor ihn. Stuttgarter Kennzeichen, bis zum Dach vollgepackt mit Koffern, Taschen, Kleidungsstücken. Ein Uniformierter deutete dem Fahrer, einem weißhaarigen, sonnengebräunten Mann um die fünfzig, sein Fahrzeug rechts zu parken.
Der war geschockt, hatte wohl seine Gründe. Stieg nervös aus dem Wagen und mußte nach Anweisung alle Türen sowie den Kofferraum öffnen.
Kleiner sah nervös zu. Sie wühlten sich wie die Ratten von allen drei Seiten in den Gepäckberg, wurden fündig und zogen einen brandneuen Blaupunkt-Videorecorder raus.
»Verboten! Prohibido!« Der Mann von der Guardia Civil starrte entrüstet den Besitzer an.
Der Alte, von der anstrengenden Fahrt und der fündigen Kontrolle total entnervt, schaute die beiden Uniformierten eine Sekunde ratlos an, setzte dann ein entwaffnendes Lächeln auf und sagte kopfschüttelnd: »Música! Música!«
Er hielt die Jungs wohl für ziemlich blöd. Wußte bestimmt, daß die direkte Einfuhr von Fernsehapparaten und Videogeräten in Spanien verboten war. Er tat einfach so, als wäre der Videorecorder ein billiges Tonbandgerät.
»Música! Música!« tönte er ein zweites Mal.
Der fündig gewordene Beamte hielt das Gerät im Arm und schaute fragend seinen Kollegen an. Der grinste den erwischten Schmuggler an und imitierte dessen Tonfall: »Música! Música!«
Die beide grölten jetzt und lachten sich fast kaputt. Einem liefen tatsächlich Tränen übers Gesicht. Er reichte dem geschockten Stuttgarter den Recorder zurück. »Hier, nimm deine Música und hau ab!« Der Spanier sprach ein ausgezeichnetes Deutsch. Sie ließen den völlig irritierten Stuttgarter Schmuggler laufen und johlten auf dessen Kosten weiter herum. Der versteckte zitternd seine Música unter dem Kleiderberg, verschloß sorgfältig Türen und Kofferraum, ließ sich in seinen Wagen fallen und raste davon. Nichts wie weg!
Nun schnappten sich die Uniformierten Bernds Ausweis und verschwanden damit in ihrem Büro. Durch die geöffnete Tür sah er bis zur Decke gestapelte Fernseh- und Videogeräte. Irgendwelchen armen Schweinen abgenommen, die ein bis zwei Hunderter sparen wollten.
Hoffentlich gab es keine internationale Fahndung, betete Kleiner, bekam den großen Zittermann und grübelte unentwegt über Fluchtmöglichkeiten nach.
Ziemlich schnell kehrte der Jüngere der beiden freundlich grinsend aus dem Büro zurück, reichte ihm seinen Ausweis mit einem höflichen: »Okay, Amigo!«
Bernd erwiderte: »Gracias, Señor«, legte den Gang ein und gab Gas. Er hatte es über die Grenze geschafft.
Weiter durch die Pyrenäen. Die kalte Luft des Grenzübergangs hatte ihn aufgeweckt. Dank der defekten Heizung war er hellwach. Wieder wärmte er sich die Hände unter den Arschbacken.
Bei Figueras bog er in Richtung Rosas ab, hielt dann irgendwo in einer dunklen Seitenstraße, verschloß beide Türen und kroch auf den Rücksitz. In eine Wolldecke eingewickelt schlief er sofort ein.
Ben Benjamin wachte auf. Er hatte seinen Wagen anscheinend am Strand von Rosas geparkt. Auch nach der zweiten Nacht im PKW tat ihm alles weh. Gegenüber sah er ein Eiscafé. Zum Draußensitzen war es zu kalt, also ging er hinein. Glücklicherweise lief drinnen die Heizung, was in dieser Ecke des Landes recht selten geschah. Die Wärme tat ihm gut. Ben bestellte eine Tasse Kaffee und ein Eiersandwich.
Draußen hielt ein weißer Mercedes der S-Klasse. Der Stuttgarter stieg aus und steuerte auf das Café zu. Er schaute ihn kurz an – den blonden, fast 1,90 Meter großen, deutsch aussehenden Touristen.
»Darf ich mich zu Ihnen setzen?«
Ben nickte und sagte: »Música? Música?«
»Haben Sie meinen Videoschmuggel mitgekriegt?«
Ben grinste.
»Die Spanier leben ja fast noch im Mittelalter«, erzählte der Schmuggler, lässig zurückgelehnt. »Das sind meist schlichte, einfältige Bauerntypen, die keine Ahnung vom richtigen, modernen Leben haben.«
Benjamin stimmte todernst zu: »Klaro!«
Wilfried, der Stuttgarter, bestellte sich ebenfalls einen Kaffee und ein Sandwich.
»Von Beruf internationaler Playboy«, stellte er sich vor und gab recht schwatzhaft Teile seiner Lebensstory zum besten.
»Ich bin auf dem Weg nach Ibiza. Wir, meine Freundin Marie und ich, haben dort eine Spitzenvilla gekauft. Einen soliden Hangbungalow über dem Hafen von Ibiza-Stadt. Eine Aussicht … besser als vom Eiffelturm. Wir machen in Yachtcharter. Hab' dort zwei Halbtonner-Segelboote liegen. Bin jetzt fast sechzig. Das ist der Lebensabend, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe.«
»Ibiza, die Trauminsel. Bestimmt auch gut für mich. Vielleicht treffe ich Sie mal dort. Wo nehmen Sie die Fähre?«
»In Barcelona. Die Autobahn ist noch nicht ganz fertig. Von Valencia aus geht's zwar schneller. Ist aber so 'ne kleine, vergammelte Scheißfähre. Nee, ich fahre von Barcelona rüber.« Dabei wischte er resolut über seinen grauen Schnauzbart.
Ben wünschte ihm »Gute Fahrt!« und ging zu seinem Wagen. Er kehrte gemächlich auf die Autobahn zurück, wo er eine halbe Stunde später von Wilfrieds funkelnagelneuem Benz überholt wurde. Im Radio sangen die Stones, und seine Laune besserte sich ständig.
Am Rand der Autobahn stand plötzlich eine Anhalterin: Eine Blondine mit Kleinkind hielt den Daumen der rechten Hand nach oben. In der anderen Hand balancierte sie ein Pappschild mit der Aufschrift »Barcelona?« Er hielt und nahm sie mit.
Vanessa hieß die junge Frau, stammte aus Hamburg.
»Ich war bei meiner Schwester. Mein Ältester kommt in die Schule. Ist jetzt sieben. Wird bei ihr leben. Mein letzter Mann ist abgehauen, zurück nach Argentinien. Da hab' ich genug zu tun mit den beiden jüngeren Kindern. Der hier ist jetzt drei. Der Mittlere ist bei meiner Nachbarin in Cala Llonga auf Ibiza.« Während sie redete, kaute sie heftig auf ihrem Kaugummi herum und machte Blasen.
Hübsch war die Kleine, so Mitte bis Ende Zwanzig. Ihre Haare waren zu zwei langen Zöpfen geflochten, die sie unten mit Plastikklammern in Form von Totenköpfen zusammenhielt. Die Lippen hatte sie – passend zum Rest – schwarz geschminkt. Sie trug ein schwarzes Kleid, schwarze Strümpfe und schwarze Lackschuhe.
Der kleine blonde Junge steckte in Jeans-Latzhosen und einem roten Pullover. Er sah gesund und wohlgenährt aus, machte keinen Lärm und hielt einen Teddy im Arm, der aussah, als wäre er ein paarmal von einem Laster überrollt worden.
Vanessa war ein richtiges Hippiemädchen. »Am geilsten war die Insel Ende der Sechziger«, schwärmte sie. »Noch nicht so viele Neckermänner. Wir lebten in Kommunen … irre frei. In spottbilligen Fincas. Da stimmten die Preise. Wer Glück hatte, besaß mal einen Hunderter. Ein Tausend-Peseten-Schein war ganz selten«, meinte sie und phantasierte vom freien, wilden Leben auf der Insel. Merkte dabei gar nicht, daß sie dauernd nur von Geld sprach.
Vanessa war Kleiners zweiter Ibiza-Anstoß. Kurzerhand entschloß er sich hinzufahren.
»Kennst du den Weg zur Ibiza-Fähre?«
»Ja, ich war schon oft zur Insel unterwegs. Nehme immer die Fähre von Barcelona«, antwortete sie erleichtert, weil sie merkte, daß sie vielleicht das gleiche Ziel hatten.
»Ich fahre nach Ibiza. Habe schon viel von der Insel gehört. Den Aussteigern, Hippies. Dem freien, totalen Abgehen, dem Abheben. Viele Drogen?«
Sie nickte.
»Ibiza ist der Totaltrip. Ein Dauerorgasmus. Dazu Blüten, Moose, Kräuter, Pinien, Sabina. Natur pur! Und der reine klare Himmel, Felsen, das Meer und die schrillen Typen. Zuletzt lebte ich in einer Höhle am Meer. Die ewige Brandung, ganz nackt … bei Agua Blanca. Unsere Körper, vereint mit Himmel und Meer. Dem Universum verbunden. Oh Gott, die heißen Augustnächte«, seufzte sie.
Er grinste: »An deinem Dauerorgasmus muß was dran sein. Hast ja schon drei Kinder. Alle von dem Argentinier?«
»Da gibt's keinen festen Mann, aber viele geile Momente Glückseligkeit. Verzauberte Ibiza-Nächte zeugen Kinder der Liebe. Von vielen, süßen Liebhabern aus allen Ländern der Welt. Das ist das reine, unverfälschte Gesetz der Natur. Einfach das Begegnen, Annähern, gegenseitiges Nehmen, Vereinigen, Explodieren.«
Er schüttelte den Kopf.
»Und zuletzt bist du allein – mit dem nächsten Kind.«
Sie nickte lächelnd. Verzückt. Erzählte ihren Lebensblödsinn vom freien Hippieleben. Sprach kaum von der Drogensucht. Die doch die Basis ist.
Am Nachmittag fuhren sie nach Barcelona rein, fanden sofort den Hafen. Sie verabschiedete sich und rannte gleich auf das Schiff.
»Ibiza? Vielleicht finde ich dort zu mir?« sprach er vor sich hin.
Er kaufte ein Ticket und wartete auf den Verladebeginn. Als er startete, drückte sich ein altes Motorrad links an ihm vorbei. Das Hamburger Nummernschild erinnerte ihn an die nächtliche Fahrt.
Das Mädchen und die Vorfreude auf das Inselabenteuer lenkten ihn seit Stunden von seiner Scheiße ab. Er konnte sich jetzt vorstellen, den Anfang für ein neues Leben zu finden.
Er parkte den Wagen im Schiffsbauch, schnappte sich seinen Rasierer und marschierte zum Oberdeck hoch. Hinein ins Klo. Am Waschbecken rasierte er den Bart ab.
Den Bart trug er vor dem Überfall, für den Raub hatte er ihn entfernt. Danach klebte er sich fast eine Woche lang einen künstlichen an, bis der richtige Bart wieder normal aussah. Der gesuchte Räuber war also bartlos.
Später erlebte der aufgekratzte Flüchtling die ruhige Ausfahrt aus dem Hafen hinein in die Nacht. Es war immer noch zu kalt. Sie fuhren schon weit draußen auf dem Meer, als die letzten Lichter von Barcelona verschwanden. Er setzte sich in den großen Fahrgastraum am Bug. Nur wenige Passagiere schienen an Bord zu sein, es war keine Saison.
Er machte es sich auf einer langen Kunstlederbank bequem, legte den aufgerollten Schlafsack an ihr Ende und streckte sich lang hin.
»And a new day will dawn for those who stand long. And the forests will echo with laughter«, sang jemand zu leisem Gitarrenspiel.
Vorsichtig angelte er eine kleine Flasche Korn aus seiner Tasche und trank einen gewaltigen Schluck. Schmeckte das scheußlich, aber es schenkte ihm sofort ein angenehmes Gefühl der Entspannung. Er schlief ein. Irgendwann in der Nacht ging er pissen und kroch anschließend in seinen Schlafsack. Er träumte von seiner Fahrt durch die Nacht, der Flucht aus Deutschland, von dem Dröhnen neben sich auf der Autobahn …
Ein Ruck ging durch das Schiff und schläfrig öffnete er die Augen. Sie lagen im Hafen von Ibiza. Er war angekommen.
Gutgelaunt packten die Leute um ihn herum ihre Klamotten zusammen. Ben schlurfte die Stufen zum Parkdeck hinunter, erreichte schlaftrunken seinen Wagen, klappte das Verdeck nach hinten und kurbelte die Fenster runter. Er setzte sich hinters Lenkrad, suchte Musik im Radio und fand den Sender Radio de Ibiza. Die spielten scharfen Rock.
Die gigantische Ladeklappe der Fähre öffnete sich, und die wenigen Autos brummten hinaus. Es war angenehm warm, obwohl die Sonne knallte. Er folgte den Fahrzeugen, die vor ihm das Schiff verlassen hatten, folgte ihnen von Palme zu Palme.
Links erreichten sie eine große Plaza mit einem Café. Es gehörte zum Montesol-Hotel. Das gefiel ihm. Er parkte schnell ein und suchte sich einen Platz an einem schönen freien Tisch.
»Ibiza, hier bin ich. Schenk mir ein bißchen Glück! Freiheit! Erholung! Abstand von meiner entsetzlichen Lebenskacke!«
Natürlich starrten ihn alle wegen des schicken Cabrios an.
Er trank einen wohlschmeckenden, starken Café con Leche, aß dazu Eiertoast mit Schinken. Die Terrassentische waren gut besetzt. Mit älteren, spanischen Rentnergruppen, die Katalanisch sprachen. Die alten Knaben trugen trotz der tollen Sonne dicke Wolljacken und Pullover. Junge, wild aufgetakelte Touristen und Residenten drängten sich um die Tische. Die Ausländer besaßen alle die Standardausrüstung: Ibiza-Strohtasche und zwei Tage alte Bild-Zeitung.
Frühstückszeit im Montesol der siebziger Jahre. Franco war schon ewig an der Macht, unterdrückte mit aller Gewalt das Volk, besonders die Katalanen, hielt es klein und dumm. Deutsche Urlauber, die mit den – für sie so günstigen – Peseten regelrecht um sich warfen, wurden von den jungen Spaniern bewundert und kopiert. Nur das Geld zählte. Bens erstes Montesol-Frühstück – Kaffee, Eier mit Schinken und nochmals Kaffee – kostete umgerechnet weniger als vier Mark.
Die Sonne schien vormittags auf die Terrasse, und weil diese windgeschützt lag, war es im ansonsten kühlen Frühling angenehm warm. Alle stadtbekannten Residenten trafen sich hier, tauschten Erfahrungen aus – vom banalen Inselklatsch bis zu irgendwelchen Schnäppchenpreisen wurde alles thematisiert. Rechts neben dem Eingang zur Bar saß der legendäre Glorys-Peter mit einem Wasserglas voll Wodka. Neben ihm Mora, ihres Zeichens deutsche Hippiekönigin und Tänzerin.
Zu seinem zweiten Kaffee dröhnten die Stones aus den Lautsprechern. »Satisfaction!«
Er lehnte sich lässig zurück, griff seine Prinz-Heinrich-Mütze und warf sie in hohem Bogen in den Abfallkorb, der an einem Verkehrsschild befestigt war.
Vanessa schlenderte vorbei, gefolgt von ihrem kleinen Sohn, der den Teddy an einem Bein hinter sich her zog. Sie lächelten sich zu. Vanessa machte das Victory-Zeichen, und er nickte.
Immer mehr buntes Volk tauchte auf, abenteuerlich gekleidet. Touristen im neuesten Outfit der Insel-Boutiquen, Residenten in Jeans oder mit selbstgenähten Kleidern.
Ein alter, verstaubter Ami-Schlitten, genauer gesagt, ein spanischer Lizenz-Dodge, hielt neben seinem Benz. Heraus pellte sich ein Blondschopf mit blauen Augen und kräftigem Stiernacken.
»Kann ich?«
Ben nickte und der andere setzte sich an seinen Tisch.
»Ernie aus Hamburg«, sagte er und reichte ihm die Pranke.
»Ben aus Bremen«, antwortete er und ließ sich seine Hand zerquetschen.
»Schon lange auf der Insel?«
»Eben erst angekommen. Bleibe ein paar Monate«, klärte Ben auf.
»Haste genug Kohle?«
»Kaum. Werde irgendwas aufziehen. Geschäft, Kneipe, Kunstgewerbe – mal sehen.«
»Is' nicht einfach. Jede Menge aufgeweckte Jungs machen hier rum. Es gibt zwei Gruppen, die mit Geld und die Wichser, Leute, die einen total unterbezahlten Hungerleiderjob machen. Nur, um zu überleben.«
»Wovon lebst du?«
»Geschäfte in Hamburg. Meine Alte schmeißt dort unseren Friseursalon. Hab' den meisten Kies bereits abgezogen. Zieh hier 'ne Insider-Kneipe auf. Das Gebäude, auf dem Weg nach Figueretas, hab' ich schon gekauft. Selbständig rummachen ist aber schwierig in Spanien. Um einen eigenen Laden zu eröffnen, brauchst du als Ausländer grundsätzlich 'nen spanischen Partner mit einundfünfzig Prozent Teilhaberschaft.« Angeekelt verzog er sein Gesicht.
»Scheiße«, war Bens Kommentar. »Womit hast du dein Geld gemacht?«
»Kiez. Reeperbahn. Na ja, du kommst doch auch aus 'ner Hafenstadt. Geschäfte im Miljöh. Gastronomie, Animierdamen. Glücksspiel. Alles, was schnelle Kohle bringt.«
»Und jetzt der Traumausstieg auf der Trauminsel. Nicht schlecht.« Ben nickte cool und pfiff anerkennend durch die Zähne.
Eine schlanke, fast magere Blondine im hautengen Fransenlederkleid näherte sich ihrem Tisch.
»Mein Kurschatten. Die blonde Schnalle is' gerade achtzehn«, informierte ihn Ernie. Und leise hinter der vorgehaltenen Hand: »Du hast sie nie mit mir gesehen, okay? Ich meine, falls meine Alte mal rüberkommen sollte.«
Die beiden begrüßten sich, indem sie sich ineinander verkeilten und ablutschten. Ernie kniff ihr in den rechten Busen.