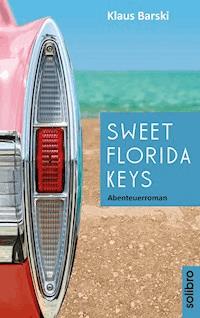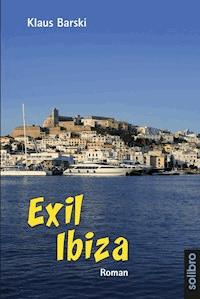Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Solibro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: cabrio
- Sprache: Deutsch
Klaus Barskis neuer Roman ist ein Muss für Hausbesitzer und Mieter. Und für Freunde süffig wegzulesender Abenteuergeschichten sowieso. Ein unterhaltsamer, schriller Wirtschaftsroman, der in das Reich von Maklern, Investoren und Spekulanten führt. Aber auch Zocker, Mietbetrüger und Immobilienabstauber kommen nicht zu kurz. Dem Leser wird eine rasante Abenteuergeschichte eines Mannes aufgetischt, der sich erst mit eigens im Bulli aus England importierten Antiquitäten, dann mit immer größeren Immobiliengeschäften von ganz unten nach oben arbeitet. En passant lernt der Leser die Tricks auf beiden Seiten der Tür kennen: wie gewiefte Mieter ihre Vermieter über den Tisch ziehen und wie pfiffige Vermieter darauf reagieren. Diese filmreife Lebensgeschichte, die nicht von ungefähr Parallelen zum Leben des Autors aufweist, ist gleichzeitig ein Zeitdokument deutscher (Immobilien-)Nachkriegsgeschichte: vom Leben in den Nissenhütten der Nachkriegsjahre bis hin zu den heutigen Nobeletagen Frankfurter Hochhäuser und Taunusvillen. Am Ende wird aus dem Protagonisten Jörg Baron ein reicher, satter Häuser-Hai. Doch reichen Geld und Besitz wirklich für das perfekte Glück? Baron zieht die Sehnsucht am Ende weiter Richtung Palmen und Meer. Und ein schickes Cabrio darf natürlich auch nicht fehlen. Motto: Immer der Sonne entgegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Barski, einer der von ganz unten kommt (Arbeiterfamilie, keine Schulbildung, Arbeitsbeginn mit 13 Jahren), schaffte mit harter Arbeit und gesundem Geschäftsinstinkt den Aufstieg vom Volksschüler und Sozialhilfeempfänger zum millionenschweren Immobilienkaufmann und Schriftsteller.
In all seinen Romanen schildert er mitreißend, schonungslos und doch immer mit einem selbstironischen Augenzwinkern knallharte, oftmals abenteuerliche Erfahrungen, wie sie ihm auch auf seinem Lebensweg in ähnlicher Weise widerfahren sind. Klaus Barski ist dementsprechend natürlich kein Leisetreter. Gerne erzeugt der Werbeprofi Aufsehen. So als er anlässlich der Veröffentlichung seines Romans Der deutsche Konsul medienwirksam echte und gefälschte Dollars aus dem Fenster warf. Oder als er mit Luxuslimousine im Frankfurter Café Schwille aufkreuzte um seinen Ozelot an einer Eisenkette auszuführen – Klaus Barski: eben ein echter (Erfahrungs-)Millionär mit Tick und Charme.
Bibliografie
Der Frankfurter Spekulant (1999) •
Der Loser (2000) •
Der deutsche Konsul (2001) •
Exil Ibiza (2003) •
Lebenslänglich Côte d’Azur (2005) •
Blut-Zeitung (2008) •
Prügel für den Hausbesitzer (2012) •
1. Jöricke, Frank:
Mein liebestoller Onkel, mein kleinkrimineller Vetter und der Rest der Bagage
Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2007
ISBN 978-3-932927-33-1 (geb. Ausgabe)
ISBN 978-3-932927-53-9 (E-Book)
2. Jöricke, Frank:
Mein liebestoller Onkel, mein kleinkrimineller Vetter und der Rest der Bagage
Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2010
ISBN 978-3-932927-36-2 (Broschur)
ISBN 978-3-932927-53-9 (E-Book)
3. Barski, Klaus:
Prügel für den Hausbesitzer.
Tatsachenroman eines Immobilienspekulanten
Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2012
ISBN 978-3-932927-48-5 (Broschur)
ISBN 978-3-932927-52-2 (E-Book)
ISBN 978-3-932927-52-2
2012 / Originalausgabe
© SOLIBRO® Verlag, Münster 2012
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes – auch auszugsweise – ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung, Verarbeitung und Verbreitung in elektronischen Systemen über die eingeräumten Rechte hinaus.
Umschlaggestaltung: Nils A. Werner, [email protected]
Reihengestaltung: Wolfgang Neumann
Fotos des Autors: S. 2 und Buchumschlag: privat
Bestellen Sie unseren Newsletter unter www.solibro.de/newsletter. Infos vom Solibro Verlag gibt es auch bei Facebook und Twitter.
www.solibro.de verlegt. gefunden. gelesen.
’cause we are living in a material world
Madonna, Material Girl
Prolog
Sonnenuntergang am Strand von Benalmadena. Herbst 2011. Und Fred und Angies Beachbar „Ring of Kerry“ tankt noch mindestens eine halbe Stunde wärmende, blendende, tief stehende Sonne aus dem Westen. Ich habe zum Glück den letzten freien Zweiertisch an der Treppe erwischt. Fred wienert hinter seiner Theke Cocktailgläser und erwidert teilnahmslos nickend mein „Hi“. Seine wie immer strahlende, fette Angie mit den grün gefärbten Zöpfen bringt mir stumm lächelnd meinen ersten halben, „kostenlosen“ Liter schäumendes San Miguel vom Fass und dazu einen spanischen Tomaten-Knoblauch-Bocadillo. Das läuft hier lautlos, automatisch für mich, ohne Bestellung. Bin doch akzeptierter Stammgast der beliebten Kneipe. Man kennt meine Bedürfnisse.
Links, in der Zufahrtsstraße zur A7, habe ich meinen alten, offenen, feuerroten SL-Pagodendach geparkt, den ich natürlich ab und zu mit zusammengekniffenen Augen kontrolliere. Fehlt ja noch, dass irgendein Afrikaner von der Plagiatshändlerbande mein Radio rausbricht, oder ein neidischer deutscher Tourist wegen der deutschen Nummer ihm ’ne linke Schramme verpasst. Und ich fühl mich heute wie immer richtig top drauf, weil ich mir vorher zu Hause immer zwei doppelte Soberanos reinkippe. Das spart Kohle, harte Euros, die ich arme Sau leider nun mal im Alter dreimal umdrehen muss.
Vor meinem geliebten SL parkt meist ein schneeweißes Jaguar E-Cabrio aus den Sechzigern. Es gehört Poppy, dem gestopften Häuserspekulanten aus meiner Frankfurter Glanzzeit, der sich vor zwei Jahren eine Ferienvilla in Marbella kaufte. Einem knallharten, menschenverachtenden Hasardeur, der großes Geld auf Kosten vieler schwacher Mieter machte. Mit Sanier-Psychoterror. Durch Leerstandsdruck und zermürbender Bauarbeitsdrangsalierung und natürlich lockender Abstandskohle räumte er gnadenlos den billig wohnenden Altmieterbestand. Blendende Ramschrenovierung brachte ihm nach erfolgter Aufteilung in begehrte Altbau-Eigentumswohnungen den großen Reibach. Damals in den Siebzigern und Achtzigern wurden Deutschlands Innenstadtmietshäuser ruckzuck von einer cleveren Piratenbande gekapert, geräumt, aufgemotzt und in kleinen Stücken als Eigentumswohnungen verschachert. Ich kriegte die Immobilienspeku schon als kleiner Knirps mit. Meine Leute waren seit Generationen Mieter gewesen und so akzeptierten auch meine Eltern es einfach kritiklos, das deutsche Mieterproletariersystem.
Mutti machte ihr ganzes Leben lang auf nette kleine graue Maus. Eine, die sich immer gut mit Mitmietern und Hausbesitzer verstand, weil sie nicht aufmuckte. Geduldig, nur ihr „kleines Glück“: Freundschaften mit freundlichen Nachbarn und Erfüllung im schützenden Familienhort als Erfüllung sehend, ertrug sie geduldig ihr „ererbtes Schicksal“. Durch Geburt zu denen „ganz unten“ zu gehören, den Mieterproleten. Die „oben“: Ladenbesitzer, Handwerksmeister oder Ärzte in der Nachbarschaft waren für sie „die Gewinner mit dicker Brieftasche“, die „reichen Hausbesitzer“. Der unerreichbare Geldadel von ihnen verkehrte nur in seinem sozialen Bereich. Kontakte mit der höheren Schicht erfuhr Mutti durch den jährlichen Arztbesuch und ein zwei Gespräche mit ihrem Hauswirt. „Sieh zu, dass du es weiter schaffst als Vati“, trichterte sie mir ein. Und dass es nur zwei Typen von Hausbesitzern gäbe: menschenverachtende, sich anbiedernde „Schleimer“ oder brutale „Abkocher“! Für die waren Mieter eine stumpfsinnige, dumme Kuhherde, die ein Leben lang Monat für Monat ohnmächtig in Reihe antrat, um „bis zum letzten Tropfen“ gemolken zu werden. Schluckt doch die Monatsmiete bei den meisten Deutschen bis zu 40 Prozent ihres oft hart erschufteten Monatseinkommens. Da bleibt nicht viel übrig für etwas anspruchsvollere Lebensgestaltung. Hausbesitzer fuhren bei uns fast alle als Statussymbol ihren Mercedes. Wir Lemminge leider mit dem klappernden, vollgepropften Uralt-Vorstadtbus. Ja, meine Mutter und auch mein Alter, die „wussten Bescheid“, kamen aber nie auf die Idee, irgendwann zu planen, zu handeln, um ihr Schicksal zu verbessern. Ich brannte damals darauf erwachsen zu werden, um das System zu kippen und zum Hausbesitzer aufzusteigen.
Heute kommen stürmische Windböen von Gibraltar. Ich schließe den Reißverschluss meiner Strickjacke und denke an Poppy. Der war mit der Meute befreundet, oft ihr Geschäftspartner gewesen und kannte sie damals alle, die großen Frankfurter Immobilienspekulanten, vom Häuserhai Aki bis zum großen „Midas“ Sawitzki.
Poppy, der um die Jahrtausendwende sein halbes Vermögen im großen Newmarketfall und dem späteren Bankcrash verlor, sich berappelte und dann, etwas später, von der Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft wegen Hinterziehung und Betrug vier Jahre in den Knast gesteckt wurde. Das hat ihn, den verwöhnten Lebemann von Popenburg, dann gebrochen. Er besitzt immer noch zwei Citymietshäuser hinter der Zeil und ein paar Millionen Dollar Schwarzgeld auf den Caymans. Aber, oh Jammer, ist seitdem nicht mehr der alte, gut gelaunte Luftikus, sondern ein depressiver, negativer Weinerling.
Seine Anfangskohle machte er mit der großzügigen Monatsapanage seiner Familie und an den US-Army-Paydays der Sechziger mit Marihuanahandel. Den soliden Reibach danach mit der sicheren Altbauspekulation der Siebziger. Der IT-Aufschwung der Neunziger mit der Aktienspekulation und die Finanznot nach dem Crash katapultierten ihn in den Knast, weil er seine Kunden und die Steuer über den Tisch zog, um sich zu retten. Jetzt trinkt er abends, aus Angst vor eventuellen Rächern, bewacht von seinem scharfen Schäferhund Elvis, den Sundowner bei Fred. Und ziemlich oft sitzen wir dann auf zwei, drei Gläser zusammen, gucken in den Sonnenuntergang und suchen den legendären „Green Flash“, der uns vielleicht die „Erleuchtung“ für die weitere Zukunftsbewältigung bringen könnte.
Ja, damals gehörten wir zu ihnen: den Mainzockern und Halbweltgrößen vom Terrassencafé. Mit dem großen Emil Sawitzki als zeitweiligem Partner drehte Poppy natürlich seine lukrativsten Dinge.
„Emil war der größte Macher in der Branche. Ein Naturtalent! Irgendwie vermisse ich sie ja, unsere alte Gaunermeute. Mensch, was waren wir damals kreativ. Und wenn der Finkelstein wiedermal mit’nem neuen Ferrari anrauschte, bin ich nach meinem Morgenkaffee, neidisch wie der letzte Loser, immer gleich zurück ins Büro und hab, heiß wie’n Groschenautomatzocker, die wildesten Geschäftsideen durchgestartet. Nur, um es auch mal wieder allen zu zeigen: meine legendäre Geschäftspower! Die Terrassencafé-Frühstücksrunde war unser Superbrainstorming und Sawitzki unser Messias“, murmelt er dann immer wieder, und dabei flackert ein kurzes, fast erloschenes Leuchten in seinen Augen.
Heute scheint er nicht reinzukommen. Er hat ja wohl nicht schlapp gemacht, der alte Abkocher?
Freds große Kübelpalme wirft bereits ihren endlos langen Sonnenuntergangsschatten, und aus dem Lautsprecher dröhnt „Satisfaction“ von den Stones. Mein täglich geiles, ewiges Jetsetleben!
Das kühle Vier-Euro-Bier schmeckt fast besser als deutsches. Verdammt, in den Siebzigern schmeckte es logo, für nur umgerechnet 30 Pfennig, noch besser. Aber jedes erste Glas am Abend hab’ ich ja noch über zwei Jahre frei.
Das Wachs meiner Flügel fing nur kurz über dem Boden an zu schmelzen. Okay, ich stürzte ab, aber nicht zu tief, überlebte mit intaktem Verstand, weil ich nie zu hoch zockte und dadurch nicht in dem finanziellen Schuldenstrudel der Zinseszinsen endete. Nach den Sternen greifen, heißt für mich, nicht sie zu erreichen, sondern nur permanent ihre Richtung anzupeilen für eine gesunde Chance, über mich selbst hinauszuwachsen.
1
1941 wurde ich, Jörg Baron, in Bremen geboren. In den frühen Jahren nach dem Krieg waren wir finanziell klamm, weil mein Vater Walter damals unterbezahlter Busschaffner war und seine Kohle vorne und hinten nicht reichte. Kurz davor noch ein schneidiger Luftwaffenunteroffizier mit Eisernem Kreuz, von mir als Held verehrt und nun in der bescheidenen Schaffneruniform. Das war bitter für uns, denn Schaffner verdienten nicht viel. Später bewarb er sich beim Bund, um als Feldwebel wieder aufzuleben und seine „wohlverdiente, dicke Pension“ zu kassieren. Zum „Glück“ wurde bei uns schnell wieder aufgerüstet. 1957 zog er sie dann wieder an: die heiß geliebte blaue Luftwaffenuniform.
Unser kleines Glück nach dem Krieg aber war die preiswerte Souterrainwohnung seitlich neben dem Lebensmittelladen des mehrfachen Hausbesitzers Rode. Vier Zimmer mit eigentlich schöner Aussicht auf dem breiten, mit vielen Bäumen bepflanzten, großzügig angelegten Anlagenring und Tausende von Passantenbeinen.
Der Krieg zerstörte in Deutschland fast drei Millionen Westwohnungen. Über zwei Millionen weitere wurden über Nacht für die fast 12 Millionen Flüchtlinge und Kriegsheimkehrer gebraucht. Überall wurden mit viel Fantasie Behelfswohnungen in Kellern, Bunkern, Baracken und Dachböden geschaffen, um diese obdachlosen Menschen unterzubringen. Leider hatte die Stadt aufgrund der Wohnungsnot auch bei uns, nur zehn Meter entfernt, eine provisorische Vierergruppe Nissenhütten – hässliche halbrunde Wellblechunterkünfte mit Bretterseiten – aufgestellt, in denen hausten über zwei Jahre meist katholische Heimatvertriebene aus dem Osten.
„Alles halbe Pollacken. Viele stammeln so richtiges Kanakendeutsch mit Akzent. Kommen hier ausgehungert an und lügen, dass sich die Balken nur so biegen. Erzählen den lieben langen Tag nur immer, was sie alles für Reichtümer verloren haben. Wiedergutmachungskohle, die wollen sie ergaunern“, ärgerte sich oft mein unbelehrbarer Vater.
Und wenn er dann beim Thema war, kam er immer schnell auf sein „abenteuerliches, aufregendes“ Leben im Krieg zu sprechen. Es waren wohl seine besten Jahre gewesen, denn alle Kriegserlebnisse waren positiv: die vielen erfolgreichen Feindflüge in der Geschwaderkommodore-Maschine, mit anschließendem Ordenssegen vom Eisernen Kreuz bis zur goldenen Frontflugspange, die schnellen Beförderungen bis zum Stabsunteroffizier und sein berühmtes Foto auf der Titelseite des Frontfliegermagazins. Dazu endlose unterhaltsam-lustige Ereignisse mit den Kameraden im Fliegerhorst und beim Bombardiereinsatz. Und wenn er dann genug Bier und Korn drin hatte, gings erst richtig los: Er war als Bordmechaniker ein begeistertes Mitglied der Flieger gewesen und vermisste sie so sehr, die tägliche, große Freiheit über den Wolken. Danach kam er immer schwärmend zu seinem Ikarusthema:
„Den weiten Himmel erklimmen, aber realistisch geplant und professionell gemeistert ohne riskante, dilettantische Flugversuche, die in einem Absturz enden könnten …“
Und ich Knirps wunderte mich, dass Ikarus seinen Flug dümmlich mit Wachskleber und Federn wagte. Das musste ja schief gehen. Im Radio lief irgendwann die Geschichte vom Schneider zu Ulm. Obwohl sie böse endete, schien er eher auf dem richtigen Weg zu sein, und so zeichnete ich mir schon in den ersten Volksschuljahren meine Traumflugmaschine, die sich durch Wind- und Menschenkraft vom Erdboden abhebend, hoch und immer höher, hineinschraubte in das endlose Firmament.
Zeitungen, Bücher, Theaterbesuche. Nicht bei uns. Nix Kultura. In den Vorschuljahren vermisste ich sie ja nicht, als kleiner Knirps. Aber wir besaßen einen ständig lärmenden, pechschwarzen Volksempfänger, auf dessen Vorderfront ein Stück Bakelit rausgebrochen war.
„Da war früher das Hakenkreuz vom Führer dran, jetzt verboten“, seufzte Mutti nachdenklich, und ich fühlte mit ihr, denn sie hatte mir ’48, kurz vor der Währungsreform, ein Foto von ihm im STERN gezeigt. Der war sicherlich auch so ein lustiger Clown wie der Charley Chaplin mit dem Stöckchen. Trugen sie doch beide ein putziges Bärtchen und schnitten dazu witzige Grimassen.
Mutti schaltete mir immer die unterhaltsamen Kindersendungen an. Diese animierten mich schon in den Kindheitsjahren, gestalterisch zu spielen: Zeichnen, Basteln und einfach nur unterhaltsame Geschichtchen erfinden.
Bremen mit seinen wichtigen Häfen und Werften wurde so platt bombardiert, dass selbst viele dort Geborene noch lange im Umland wohnen mussten. Unser Haus war glücklicherweise, bis auf einige Splitterschäden, verschont worden. Einige Straßen weiter war bereits alles zerstört: Ein gigantischer, endloser Haufen Bombenschutt mit Millionen roter Ziegeln formte eine grandiose abenteuerliche Mondlandschaft, für uns Kinder ideal zum Spielen.
Oftmals kamen entsetzlich heruntergekommene Männer mit langen Haaren und Bärten, total abgemagert in schlotternden Lumpen vorbeigezogen.
„Heimkehrer, Heimkehrer. Sind wohl schon Monate unterwegs, dem Russen entkommen“, riefen die Leute und flüsterten:
„Geh ja nicht zu nahe an die ran. Da holst du dir noch ’nen netten Untermieter. Vorsicht: Wanzen oder Läuse“. Ein Heimkehrer in zerschlissener Uniformjacke rotzte verärgert hinter sich.
Als 1947 die Wohnraumbewirtschaftung der Besatzer eng wurde, starteten die Behörden die Zwangsbelegungen. Wir hatten vier Zimmer und das war natürlich Pech. Aufgrund des vierten Raumes wurde 1948 ein junges Flüchtlings-Ehepaar aus Stettin bei uns eingewiesen. Und so brachte mir die Wohnungsnot meinen Kultureinstieg, denn die „Aftermieter“ aus dem „Polackenosten“, wie Vater sie titulierte, die Eberts, waren intelligente, aufgeschlossene Textildesigner, die früher in einer kriegswichtigen Fabrik beschäftigt waren. Sie hatten sogar „Mittlere Reife“.
„Mittelschüler sind se, denken sie sind was Besseres. Meine Luftwaffenschwinge, die wurde respektiert – früher. Schade, dass ich nicht mehr blauer Uniformträger bin. Die aus dem Polackenosten haben in ihrem Zimmer so knallbunte Plakatdrucke angebracht, Moderne Kunst von Picasso und Klee. Damit wollen die sich nur wichtig machen. Meine Kunst heißt Breker … Dürer. Beim Adolf hätten’se nicht gewagt diesen Dreck an unsere Wand zu hängen. Der hätte mit so was kurzen Prozess gemacht: entartete Kunst, scheußlich, undeutsch!“, brummte er.
Als unsere Nachbarin Frau Wuttke ihr Baby bekam, bastelte Herr Ebert eine atemberaubende Glückwunschkarte: aufklappbar mit einem aus Silberpapier geformten winzigen, dreidimensionalen Klapperstorch. Alle Mieter unterschrieben begeistert den druckreif in altdeutschen Buchstaben geschriebenen Text: „Alles Gute zur Geburt und weiterhin reichen Kindersegen wünschen Ihre Nachbarn Baron, Schmitt, Gorski und Ebert.“ Alle, bis auf meinen Vater, zeigten sich beeindruckt. Ebert war ein begabter Mann.
Roland Ebert, zeichnete von früh bis spät mit Blei- und Buntstiften antike Bremer Ruinen.
„Damit sie nicht vergessen werden, unsere alten Kostbarkeiten. Kein Verantwortlicher kümmert sich um ihre Erhaltung. Jeder holt den Abrissbagger, um sie ruckzuck plattzumachen, für gewinnbringende Neubauten. Furchtbar!“, seufzte er, und ich bewunderte mit glänzenden Augen seine fotografisch wirkenden, perfekten Vergangenheitstresore. Fing dann ebenfalls an zu zeichnen und verliebte mich prompt in die Idee, später einmal ein berühmter Maler zu werden. In meinen Träumen ein besserer „Ikarus“: Einer, der sich traut und durch Können siegt. Kein Blender oder Verblendeter, der durch Selbstbetrug abstürzt.
Untermieter Ebert konnte sogar richtig zaubern und begeisterte mich mit seinen raffinierten Kartentricks. Aber das stärkste war sein Fernglas: ein armeegrüner, riesiger Russen-Feldstecher, den er mir oft lieh. Damit konnte ich, unbemerkt hinter der Gardine verborgen, das bunte Treiben der Nissenhütten-Bewohner studieren. Dazu trank ich oft, wenn allein zu Hause, eine ganze Flasche Bier und war danach gut drauf. Brause, das Lieblingsgetränk der Nachbarkinder kostete damals 10 Pfennig. Konnte ich mir leider nicht leisten. So klaute ich dem Alten ab und zu ’ne Buddel „Haake Beck“. Aber in Maßen, um nicht erwischt zu werden.
Bei den Hüttenbewohnern war ständig was los: Ein- und Auszüge mit Wagenladungen von armseligem, seltsamem Hausrat, Familienfesten mit Akkordeonklängen und fremdländischem Gesang sowie lallenden Alkoholleichen. Ich wurde Zeuge der städtischen Abtransporte nach furchtbaren Schicksalsschlägen, die nicht selten in Selbstmordversuchen mündeten, blutigen Schlägereien, nächtlichen, überfallartigen Polizeirazzien und rätselhaften Geschäften in den Büschen der Anlage.
Einer der schillerndsten Typen der Hütten war ein kleiner, drahtiger, halbglatziger Brillenträger, der einen richtigen Muli besaß. Mit dem alten zotteligen, hellbraunen Pferdeesel und seinem zweirädrigen, selbst gebastelten Anhänger mit Fahrradrädern führte er Kleintransporte, Umzüge und sogar Wochenendausflüge durch. Er hatte zwar nur wenig schwarze Haare auf dem Kopf, schien aber kaum älter als 20 zu sein. Immer trug er Schlips und Kragen und einen abgetragenen, schlotternden altertümlich gestreiften Anzug. Mehrmals kam ich mit diesem aus Riga stammenden Deutschen ins Gespräch, mit Emil Sawitzki. Und der konnte reden. Mein Gott, heftiger und überzeugender noch als unser Pfarrer in der katholischen Kirche.
„Jetzt, wo alles zerstört ist in unserem einstmals schönen Deutschen Reich und wir ganz unten sind, da kann es ja nur noch aufwärtsgehen. Im nächsten Monat geht der Moppi, mein Muli, in die Pferdemetzgerei Schmitt nach Lemwerder, und ich fahre dann erste Klasse: Hab gestern ein richtiges Automobil gekauft. Natürlich einen Transporter. Vorne zwei Sitze und hinten Planwagen. Einen preiswerten Unfall-Goliath, ich sag dir: So gut wie neu und wie sein blauer Lack glänzt, wie frisch aus der Fabrik. Und jetzt steig ich so richtig ins Plünn- und Oldiesengeschäft ein. Buntmetall bringt dieser Tage richtig große Asche.“
„Das ist doch ein Dreiradfahrzeug. Vorne eins und hinten zwei Räder?“
„Na klar, mordsvernünftige Erfindung: Hinten trägt er die schwere Last und vorne nur mich, mit meinen heruntergehungerten sechzig Kilo. Aber weil ich jetzt so richtig an die fette Penunze rankomme, werde ich schnell wieder zunehmen, Speck auf die Rippen kriegen. Da kommt mittags statt gebratener Steckrüben, ein saftiges Kotelett auf den Teller“, sagte er und streichelte schmunzelnd seinen flachen Bauch.
Wie ich von Nachbarn hörte, ging es Sawitzki finanziell nicht schlecht, weil er bereits sehr früh in den Schwarzmarkthandel einstieg: Mehrere seiner Bekannten waren farbige US-Soldaten, die er mit zu Likör umgepanschtem Rohalkohol belieferte. Der Alkohol wurde nachts, unter Lebensgefahr beim Russenbesatzer von cleveren Einsteigdieben aus ehemaligen, unterirdischen Alkoholerdtanks der Wehrmacht abgepumpt und geklaut.
Die Schwarzen zahlten in der Besatzungszeit mit PX-Ware, unterschlagenen Hershey-Schokoladetafeln, Camel-Zigaretten, Armeedecken und Nylonstrümpfen für schwarzen Schnaps, weil die rassistische US-Regierung ihnen keinen freien Alkoholkonsum erlaubte.
„Wie gesagt, es geht wieder aufwärts mit uns. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Der erfolgreiche Geschäftsmann muss seiner Zeit ständig einen Schritt voraus sein. Nächste Woche kriege ich sogar ’ne richtige Adler-Schreibmaschine. Für meine Rechnungen, den Schriftverkehr. Seriosität und Professionalität sind angesagt!“, ergänzte Sawitzki ein paar Wochen vor dem zündenden Wohlstandsbeschleuniger: der Währungsreform.
Gott, was für ein mutiger Visionär er schon damals war. Beeindruckt antwortete ich:
„Wenn ich die Schule hinter mir habe, komm ich zu ihnen in die Lehre, Chef. Sie fordern doch die große Welt heraus. Da will ich dabei sein.“
Er grinste gut gelaunt und schenkte mir dann zwei Groschen und einen wertvollen Spruch fürs Leben, wie: „Glück läuft nur, wenn’de es vorher gezielt in den Arsch trittst“, oder „Wer mich bremsen will, wird aus dem Weg geräumt!“
Vater mochte den Sawitzki nicht:
„Der ist, ich wette um den Endsieg, garantiert ein Itzig. Sieh nur die fliehende Primitivenstirn und dann seine Liebe zu dem komischen, dümmlichen Eselmischling, typisch „David Itzig“.
Ich war ja dran gewöhnt, aber staunte erneut. Sein Fremdenhass kreierte immer „kreativere“ Hetznamen. Zwei Jahre später wohnte der begnadete Geschäftsmann bereits in einem zwar etwas heruntergekommenen, aber eigenen Einfamilienhaus und war der erste in der Nachbarschaft, der einen richtigen Ami-Schlitten fuhr: den neuesten schneeweißen Kaiser.
„Tagediebe, Säufer und Kleinbetrüger, Tag und Nacht in unserer schönen Aussicht. Um Gottes willen, wann wird dieser Schandfleck endlich weggerissen. Der Führer hatte sie doch alle rausgeschmissen, ausgemerzt, diese Untermenschen. Jetzt tauchen sie wieder wie aus dem Nichts auf: Schwule, Kriminelle, Juden, Kommunisten, Sozis. Heimlich abfackeln sollte man ihre Hütten. Dann wäre unser Viertel wieder gute Mittelklasse“, meckerte der Alte, der „diese Welt“ nicht mehr verstand. Mutti, die doch sonst so „gut durchblickte“ schaute auf den Küchenboden und sagte wie so oft nichts. Wollte wohl ihren Frieden und gab ihm dadurch in meinen Augen, obwohl sie doch durchblickte; Recht …
Am 20. Juni 1948 lief dann die Währungsreform. Jeder deutsche Bürger bekam 40 Mark Kopfgeld. Freudig zeigte mir Mutti die neuen größeren Scheine: Den grauen Fünfziger und den grünen Zwanziger. Am folgenden Tag waren, wie durch ein Wunder, alle Schaufenster voller Waren. Vorbei waren Schwarzmarkt- und Hamstertouren.
Kurz danach entdeckte ich mit dem Feldstecher bei den „Kalusern“, wie sie auch bei uns hießen, eine Neubelegung. Eine alleinstehende, sehr abgemagerte junge Frau zog mit ihrer schwarzlockigen, hübschen Tochter Eva ein, die ungefähr in meinem Alter war und kurz darauf in unsere Volksschulklasse eingeschult wurde.
Nahe am kilometerlangen, gefährlichen Stacheldrahtzaun, der die Schiffswerft Bremer Vulkan vor Dieben schützte, nur Minuten von unserer Lindenstraße entfernt, befand sich ein ungepflegtes, verwildertes Wiesengelände mit vielen Bombenkratern. Ideales Freizeitgelände zum Versteckenspielen, Drachensteigen und Hüttenbauen. Eines Tages in den Sommerferien planierten meine Freunde Siegfried Scholz, Faller und ich hoch konzentriert eine Murmelspielbahn mit Sammelkuhle. Da bemerkten wir hinter uns ein grinsendes Mädchen mit langer, eng geschneiderter, tarnfarbener Armeehose, einem dick gestrickten grauen Rollkragenpullover und schräg gesetzter Pudelmütze.
Eva! Auf dem hübschen, stupsnasigen, schwarzhaarigen Köpfchen blitzten riesige, langwimprige blaue Augen und ein fast herzförmiger Mund zeigte eine rosane Zunge.
„Weiber, dumm, faul und gefräßig“, keifte Scholz frech.
„Haben oben wenig und unten wenig … und’n paar krause Haare“, ergänzte der „wissende“ Faller.
Hämisch lachten wir uns kringelig.
„Widerliche Witze über Damen machen und zu blöd mich zu besiegen“, rief meine lustige Nachbarin und hielt uns einen klickenden Leinenbeutel mit knallbunten Glasmurmeln unter die Nasen.
„Darf ich mitspielen?“
In ihrem Beutel befanden sich mindestens 50 Kugeln, das Stück zu 2 Pfennig und gierig gönnerhaft lud Faller sie ein, in unserem Spielkasino mitzuspielen. Er freute sich, als sie seinen modisch letzten Schrei bemerkte, eine echte amerikanische Levis-Nietenhose. Konnte sich trotzdem nicht einen doofen Spruch verkneifen:
„Aber nachher nicht Schnotten und Tränen weinen, hübsche Dame. Hier ist der Murmelsack schnell leer. Wir Profizocker lehren Großmäuler sich zu bescheiden!“
Ich warf die erste Kugel sehr, sehr nahe an die Kuhle. So zehn Zentimeter vor den Rand. Der schwerfällige dicke Faller runzelte die Stirn, bückte sich umständlich, kniff sein linkes Auge zu und warf konzentriert, ohne Kommentar, ganz ruhig eine halbe Distanz besser als ich. Erhob sich mühsam und drehte sich mit triumphierendem Grinsen zu uns herum:
„Der King macht heute wieder die große Kasse.“
Diese gekonnte Vorgabe war natürlich kaum zu übertreffen. Scholz, unser klassenbester Sportler, ließ sich darum Zeit und ging zum Pott hinüber. Dabei überprüfte er jede kleine Unebenheit, die er sorgfältig mit dem Handrücken glatt strich. Kam zurück, peilte das Ziel mit schrägem Kopf kurz an und warf seine Murmel mit hohler, sicherer Hand. Die schlug im letzten Viertel vor dem Ziel auf, rollte schnurgerade weiter und berührte ganz leicht Fallers von rechts. Dadurch kam sie von der Bahn ab und kickte dessen Murmel zugleich nach links weg. Also führte ich und brüllte freudig: „Bingo!“
„Dieser Weihnachtsmann. Hat’n Knick im Auge und bumst mich an. Madame sie sind dran.“
Eva nahm eine Kugel aus ihrem Beutel, spuckte, ihr Glück beschwörend, ein bisschen drauf, was wir natürlich mit gemeinem Johlen honorierten, und ging vor die Markierung. Sie trat mit ihrem linken Bein fast an den Strich, bückte sich langsam vor und warf ihre Kugel Richtung Pott. Die rot-gelb geflammte Glaskugel bumste auf und rollte zielsicher, „zack“, in das Loch hinein. Ihr Sieg. Wir waren sprachlos. Cool sammelte sie unsere Kugeln ein und steckte sie leise pfeifend mit spitzen, hübschen Lippen in ihren fetten Siegerbeutel.
Von diesem Tag an war sie zur wichtigen Persönlichkeit für mich geworden. Ich war nur 8 Jahre alt, aber mochte sie auf eine, mir noch nicht erklärbare, Art: Ihre Schönheit, Klugheit und kessen, weiblichen Überrumpelungszüge faszinierten mich so stark, dass ich mich zu ihr hingezogen fühlte.
Schon von Geburt an hatte ich mich daran gewöhnt, der letzte Arsch der Gegend zu sein. Erlebte schon als Kleinkind, dass mich meine gesamte Umwelt wie einen Aussätzigen mied oder als Mensch dritter Klasse behandelte. Die Nachbarkinder durften eigentlich nicht mit mir spielen, und wenn ich sie zu Hause besuchte, jagten mich ihre Eltern verachtend vom Hof oder warfen mich raus. Denn alle um uns herum waren eingebildete Inhaber kleiner Einzelhandelsläden und Hausbesitzer oder gut situierte Pensionäre, die sich eine einigermaßen anständige Eigentumswohnung leisten konnten. Wir Loser leider nicht: Unsere schäbige Souterrainwohnung ohne Badezimmer und Vaters schlecht bezahlter Kleine-Leute-Job stempelten mich zum Paria.
Eva war aufgrund ihrer Wohnkatastrophe erst mal noch schlechter dran. Weil wir den gleichen Nachhauseweg hatten und Nachbarn waren, entwickelte sich sofort ein enger Kontakt. So machten wir schon nach zwei Wochen gemeinsam unsere Hausaufgaben. Sie war eine Topschülerin und sehr intelligent. Kapierte ruckzuck komplizierte Zusammenhänge und hatte dazu ein sagenhaftes Gedächtnis. Ihre große Leidenschaft waren die großen Romane. Sie hatte in ihrer großen Strohtasche immer ein oder zwei Bücher stecken, in denen sie gerade las: Honoré de Balzac, Joseph Conrad, Pearl S. Buck. Immer nur die großen Namen. Das brachte mich dann in die Städtische Bücherei. Bei Eva konnte ich manches abgucken und lernen. Es haute mich natürlich um, als ich bei meinem ersten Besuch feststellte, wie armselig beengt sie und ihre Mutter in der Hütte hausten.
„Im Herbst werden die scheußlichen Baracken von der Stadt abgerissen, und wir bekommen hoffentlich von der Stadt eine neue Zweizimmersozialwohnung Richtung Bremen-Mitte. Mutter kriegt in den nächsten Wochen wohl ihren kleinen Erbschaftsanteil von der verstorbenen Tante aus Bremerhaven. Vielleicht reicht der sogar für die Anzahlung eines kleinen Häuschens. Wenn bloß Vati noch lebt und wieder bei uns wär, da würde alles anders aussehen“, seufzte sie und zeigte mir einen Brief vom Suchdienst, der ihn leider immer noch als „vermisst“ meldete. Ich erfuhr, dass ihr Vater Wilhelm ein richtiger Augenarzt war. Diese „vornehmen Herkunft“ imponierte mir natürlich sehr.
Meine freien Stunden verbrachte ich nun immer häufiger mit ihr: Wir gingen auf der Weserpromenade spazieren, aßen zusammen ein einkugeliges Waffeleis für 10 Pfennig im Eissalon Radloff und gingen sonntags gemeinsam in die Kindervorstellung des Vorortkinos. Meine alten Kumpels, die ich immer mehr vernachlässigte, lachten mich aus, machten blöde Witze und nannten mich einen „Weibersklaven“. Das war mir aber wurscht, weil es mich faszinierte zusammen mit diesem bildhübschen Mädchen auf der Lindenstraße gesehen zu werden.
Auf der Bank im Stadtpark küsste ich sie auf die Wange und flüsterte ihr ins Ohr, „Ich liebe dich, und wir werden später heiraten!“
Das mochte Eva, und dann erzählte ich ihr von meinen „großen“ Zukunftsplänen: Ich, der zukünftige, erfolgreiche Macher und, weil oft ohne einen Pfennig, wollte ihr dann beweisen, dass ich schon als Neunjähriger „was drauf“ hatte. So organisierte ich eine Zeitungspapiersammlung für die Nordbremer Fischgeschäfte. Sammelte jeden Tag nach Schulschluss, Straße für Straße alte Tageszeitungen und verkaufte sie gebündelt einmal wöchentlich an drei Läden. Aber nach kurzer Zeit kriegten das andere Schüler mit und machten es mir nach. Absatz und Papierpreis gingen langsam den Bach runter. Und dann wurde ich „arbeitslos“, weil mir ein Missgeschick passiert war: Mir kam als junger, unerfahrener Bursche niemals die Idee, die Zeitungen vor ihrem Verkauf nochmals sorgfältig durchzusehen, um verdreckte Seiten oder unbrauchbare Glanzmagazine herauszunehmen. In meinem letzten, gelieferten Stapel wurden dann zwei „schlüpfrige“ amerikanische Soldatenmagazine gefunden. Damals mit nur leichtbekleideten Pin-up-Girls: bloßer Busen mit verdeckter Brustwarze und runder blanker Frauenpo, clever von der Seite fotografiert. Damals der Inbegriff von wüster Pornosauerei.
„Du bringst mir in Zukunft keine Zeitungen mehr, mein Freund! Zwei Kunden waren richtig empört und haben mir ‚ihre Meinung‘ gesagt. Wie konnte dir das nur passieren?“, sagte der Fischhändler verärgert. Und damit war das gute Zusatztaschengeld futsch.
Dann erschacherte ich mir für Glasmurmeln und ein paar alte Spielsachen fünf Kasperlefiguren. Baute mir aus einem Seifenkarton ein Kasperletheater und führte unterhaltsam improvisierte Stücke für Kleinkinder auf. Auf dem Kinderspielplatz hinter dem Aumunder Krankenhaus. Das brachte jedes Mal ein paar armselige Groschen.
Eva lachte sich darüber schief, murmelte kopfschüttelnd:
„Mein Träumer … lieber Spinner. Irgendwann endest du bestimmt als berühmter Theaterdirektor.“ Was mir unpassend erschien. Ruhm? Nein! Es war mir doch ernst mit dem finanziellen Erfolg, verdammt noch mal.
Ich war kein guter Schüler und nicht besonders kräftig. Sah auch nicht besonders vorteilhaft aus: übergroße, gekrümmte Nase, spitzes Kinn und weit abstehende Ohren. Aber ich besaß eine Gabe, mit der kein anderer unserer Kleinbürgerstraße gesegnet war: Ich konnte die herrlichsten, mitreißendsten Märchen unter der Sonne erzählen. Das kriegte nicht nur Eva mit, sondern später, in der Teenagerzeit viele Teenies: Die ungewöhnlich hübschen Mädchen, an die sich die anderen Kerle nur holprig und unsicher herantrauten, weil sie doch eine vernichtende, demütigende Abfuhr fürchteten. Obwohl ich später mit 18 noch Jungfrau war, galt ich durch meine überzeugenden, malerischen Lügen bei den sich hinter vorgehaltenen Händen kichernd Liebeserfahrung austauschenden kleinen Schnallen, die, wie auch wir Jungs logen, dass sich die Balken nur so bogen, bald als der sexerfahrene Supercasanova. Klar kriegte ich die eine oder andere zu Petting rum. In den Fünfzigern war das schon so viel wie heutzutage Oralsex. Und ich liebte sie mit heißem Herzen, tagelang gesponnenen wüsten Traumorgien und der Hoffnung, irgendwann einmal eine von ihnen, so richtig f… zu dürfen.
Aber trotz meiner „Fremdgehversuche“, Eva war und blieb lange meine erste, einzige, große Liebe.
Eines Tages tauchte überraschend ihr brutal abgemagerter Vater auf und ein paar Monate später eröffnete er wieder seine Praxis in einem nur leicht beschädigten, frei stehenden Haus mit großem Garten in Grohn. Sie lud mich tatsächlich 1951 in den Sommerferien zu sich ins Haus ein. Ein Traumtag für mich: Sie empfing mich bereits singend an der Haustür: mit dem Saisonhit der Froboess „Pack die Badehose ein. Nimm dein kleines Schwesterlein …“ Verbunden mit einem blitzschnellen, süßen Wangenkuss. Das war ein neuer Höhe-Wendepunkt in meinem Leben: Zum ersten Mal erfuhr ich, wie wohlhabende Akademiker leben. Denn Evas Mutter war Miterbin des ehemals zweitgrößten Beerdigungsinstituts Bremerhavens, wo sie anteilig wertvollen Grundbesitz und viele Antiquitäten erbte. Welch ein Unsinn: Direkt nach der Baracke nun das großzügige 150-Quadratmeter-Haus mit noch verwildertem parkähnlichen Garten, vielen echten Antiquitäten, altdeutsch eingerichtet. Besonders faszinierten mich die vielen antiken Gemälde aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die sich fast alle mit Norddeutschland und der Nordsee befassten. In der Bibliothek beherrschten 14 alte Kapitänsbilder die Wände. Naive, streng detaillierte Drei- und Viermaster. Bekannte, wirklich gefahrene Segelschiffe der Zeit, mit Namen und Flaggen. Viele trugen auf ihren Rückseiten alte, rostbraun- und tintenfarbene Informationen über ihre damaligen Eigner und Kapitäne. Besonders gefiel mir ein Bild vom legendären Schiffsmaler Müller, das die vollgetakelte Bremer Brigg Marianne 1860 auf einer Fahrt nach Ostasien darstellte. Mit prallen Segeln, winzigen, an Deck arbeitenden Matrosen und der im Wind flatternden berühmten Bremer „Speckflagge“, rot-weiß wie eine frisch angeschnittene blutrote, mit weißem Fett durchwachsene Speckseite. Gott im Himmel, sie kriegten mich, diese alten Zeugen der damals noch fremdartigen, nur teilweise erforschten, viele Abenteuer versprechenden weiten Welt. Ich erlebte als „Gleichwertiger“ wie „die da oben“, die besseren Herrschaften, wohnen, nein, besser: residieren. Es haute mich um, ich war erregt von diesem Erlebnis und sog das Ambiente dieser gediegenen Wohnwelt gierig in mich auf. Ich sah altes handgemaltes Porzellan, Orientteppiche und Bücher. Unermesslich viele Bücher. Eva profitierte davon und erzählte mir oft von ihren erlesenen Abenteuern. Dann dachte ich an die fünf bei uns zu Hause im Büfett: ein Kochbuch, der Duden, Brehms Tierleben, Simmel: Es muß nicht immer Kaviar sein. Mein Buch: Tom Sawyers Abenteuer. Nach meinem Hausrundgang überraschte Eva mich mit einer neuen Erfindung: dem Taschenbuch! Von RoRoRo. Lesen wurde nun zu meinem neuen großen Abenteuer, und interessiert lieh ich mir von ihr einen Roman von Kipling aus. Evas Welt wurde zur wichtigsten Basiserfahrung meiner Jugend, weil sie mich zu neuen, wichtigen Wertvorstellungen führte. Mir war klar: So wollte auch ich später einmal leben.
„Mutters Großvater entstammt einer alten, nun ausgestorbenen Bremerhavener Kapitänsfamilie. Da musst du mal mit mir auf den Dachboden klettern, er ist meterhoch vollgestapelt mit Mitbringseln aus aller Welt. Unserem Erbschaftsanteil.“
Bei meinem zweiten Besuch bat ich sie, mir diese zu zeigen. Als wir eines Tages hochstiegen und die am Deckenbalken baumelnde Glühbirne erstrahlte, sah ich es dann in der Mitte vieler fremdartiger Souvenirs thronen, ein holzgeschnitztes, feuerrotgoldenes chinesisches Bett mit unbequemer Holzfläche ohne Kissen.
Atemberaubend. Unglaublich, all diese Hunderte hineingeschnitzte, bemalte Figuren raubten mir die Luft zum Atmen. Welch ein ungewöhnlich prächtig gefertigtes Kunstwerk. „Viel zu schade, um darin zu schlafen“, seufzte ich.
Eva lächelte das süßeste Lächeln ihrer süßen vierzehn Jahre, fiel geschickt rückwärts auf die harte, knallrote kissenlose Fläche und schloss mit ausgebreiteten Armen ihre Augen. Ich kapierte und krabbelte vorsichtig auf sie, um ihr Gesicht abzulutschen. Dabei spürte ich die Wärme ihrer Oberschenkel, ihre wohlgeformten weichen Brüste.
„Alles dein“, hauchte sie und ließ mich fast gewähren.
In meinen Teenagerjahren hockte ich Spanner oft, von der Gardine verborgen, am Souterrain-Kinderzimmerfenster. Wenn erwachsene, reife Hausfrauen draußen am Laden warteten, machte ich mir einen Harten. Nur Zentimeter vom verlockenden Paradies entfernt, tastete ich mit fiebrigen Augen von unten ihre Oberschenkel bis zum Höschenblitz ab. Jugend forscht.
Wir hatten jetzt immer genug zu essen. Simple, aber gute Hausmannskost: Senfeier, Graupensuppe mit unsichtbarer Fleischeinlage, Königsberger Klopse, wechselnde Steckrüben-, Linsen- und Erbsensuppen und diese sogar manchmal mit Würstchen. Einmal in der Woche bekam ich meine 60 Pfennig Taschengeld. Damit konnte man am Sonntag die Jugendvorstellung im Kino bezahlen oder zweimal die Woche Eis essen gehen. Eine damals gar nicht so schlechte, gut behütete Kindheit. Meine Volksschulnoten waren zwar nicht besonders gut, aber reichten für die Lehrstelle als Dekorateur im Veka, dem Vegesacker Kaufhaus, aus.
Irgendwann sah ich Mutti weinen. Vaters braune verstümmelte Zahnreihe sah immer schlimmer aus. Zeitweilig nuschelte er nur noch, oder sprach zu Fremden hinter vorgehaltener Hand. Um ja nicht sein optisches und damit auch finanzielles Elend zu zeigen: Er brauchte dringend neue Vorderzähne, und die kosteten dicke Kohle.
„Scheiße, ich werde mit dem Hausbesitzer sprechen müssen, damit er mir eine Miete stundet. An mein Erspartes will ich nicht, verlier sonst die Prämie. Ich zahl ihm dann jeden weiteren Ersten ein Fünftel zurück. Hoffentlich hilft er mir“, jammerte der Alte, weil seine Zahnlücke zur ständigen Demütigung wurde.
Mutter antwortete nicht. Schluckte nur mit Tränen in den Augen und verschwand im Schlafzimmer. Sie hasste den knallharten Kolonialwarenhändler, der uns am liebsten los gewesen wäre, und nannte Rode einen „Halsabschneider“.
„Ich mach aus meinem Laden sofort einen modernen Supermarkt, wenn ich sie raushabe“, schockte er sie damals. In dieser Zeit wuchs ein starkes Gefühl in mir: Es war der Hass gegen Hausbesitzer, die zig Wohnungen besaßen und, obwohl so unglaublich reich, ohne Hemmungen brutal den letzten Groschen aus uns Mietern rausquetschten und sie gewissenlos rausdrückten, wenn Profit winkte. Wenn immer ich an Rodes Wohnung vorbeiging, rotzte ich heimlich gegen seine Tür, zerriss Briefe, die aus seinem Briefkasten hingen, und warf ihm sogar, als er einmal im Urlaub war, als „Rächer“ sein Küchenfenster ein.
In unserer Familie waren alle arme, ungelernte Arbeiter gewesen. Vater glaubte tatsächlich, er wäre die erste Ausnahme:
„In meinem Beruf macht man sich nicht die Hände schmutzig und trägt eine gepflegte Dienstuniform, wie die Männer von der Feuerwehr, Polizei oder wir damals bei den Fliegern. Jeder sieht’s dir gleich an: Du bist jemand, der einem ehrlichen, rechtschaffenen Beruf nachgeht! Halt der Herr Baron. Vielleicht war einer unserer Vorfahren tatsächlich einer“, pflegte er immer stolz zu sagen und klickte melodisch mit den Tasten seines Münzspenders, fast wie mit einem Akkordeon. Noch vor ein paar Jahren war er „Held“ der Luftwaffe gewesen – diesen „Harte-Männer-Status“ vermisste er wirklich sehr.
„1944 stand ich kurz vor dem Feldwebelrang. Wär der Krieg doch bloß paar Monate länger gelaufen. Schade, da wär ich doch noch Portepeeträger geworden. Das tolle Schwert in Lederscheiden-Silberausführung hatte ich schon gekauft“, seufzte er und deutete auf seinen über dem Grundig-Radio schräg an die Wand gedübelten „Ehrendolch“. Daneben hingen zwei gerahmte Fotos. Auf dem kleinen, einem Crewfoto, zeigte er noch alle Haare und seine stolzgeschwellte, uniformierte Brust. In der Hand hielt er die Mütze mit dem Lackschirm.
„Flott sah er damals aus, in der schicken Uniform mit dem Eisernen Kreuz. Alle Mädchen in der Nachbarschaft beneideten mich. Schade, dass seine schönen schwarzen Locken nicht mehr da sind“, seufzte Mutti nachdenklich. „Und ich galt als eines der schönsten Mädchen des Stadtteils. Mein Vater war beim Vulkan Leiter der Mahnabteilung. Verdiente so gut, dass er als Erster in unserer Straße motorisiert war.“
Der Alte nickte müde, tippte mit dem Finger auf das zweite Bild mit einem antiken Motorrad und sagte:
„Schietekuchen, ich durfte seine legendäre Indian sogar fahren: Opa und ich bei einer Sonntagstour. Wie schnell doch die schönen Jahre davonrasten.“ Stopfte sorgfältig seine geliebte alte Meerschaumpfeife mit aromatisch duftendem Tabak aus dem Wildlederbeutel. Zündete sie mit kurzen kräftigen Zügen an der Zippoflamme und blies schnaubend den Rauch aus Mund und Nasenlöchern heraus. Dabei streichelte er lächelnd mit dem Zeigefinger das silberne, sich bumsende Liebespaar-Silberrelief des Feuerzeuges und rückte das etwas schief hängende größere Flugzeugfoto an der Wand gerade, auf dem die stolz grinsende Besatzung vor ihrer Heinkel posierte. Der lachende Uniformierte mit der Mütze in der Hand, hinten links, war Vati. Als Bordmechaniker musste er im Hintergrund bleiben.
„Bescheidenheit, Pflichtbewusstsein, handwerkliches Können und die realistische Gefahrenerkennung, -meisterung, haben uns damals die Feindflug-Erfolge beschert. Ein Ikarus war kein Vorbild für uns, weil er unrealistisch zu hoch flog.“ Später trat er tatsächlich, mit neuem Gebiss, das ihm wieder ein entspanntes Lächeln erlaubte, als Feldwebel in die neue Bundeswehr ein. Schon vorher gelang uns aber endlich ein weiterer großer Wurf: Wir hatten Aussicht auf eine heiß ersehnte Vorkriegssozialwohnung von der DeWoSa. Damals waren Wohnungen im freien Markt selten und wenn, nur überteuert mietbar. Mehrmals waren wir aufgrund von „günstigen“ Anzeigen zu Besichtigungen gerannt und, geschockt von den langen Interessentenschlangen, gaben wir irgendwann auf.
Eines Tages erzählte uns nämlich der Seemann Scholz, Siegfrieds Vater und alter Sportsfreund des Alten, von der gemeinnützigen DeWoSa-Wohnungsbaugesellschaft.
„Da musste erst mal Mitglied werden, etwas bezahlen und dann kommst du auf die Warteliste. Dauert lange. Ich bekam erst nach über zwei Jahren meine preiswerte Sozialwohnung. Aber es lohnt sich: Meine Miete liegt mindestens dreißig Prozent unter dem freien Marktpreis und bleibt auch in Zukunft im Keller. Ebend’ne Sozialwohnung. Manchmal kratzen aber mehrere alte Mieter ab, und dann werden ruckzuck über Nacht günstigere Vorkriegsbuden frei. Wenn’de die schnappst, Totogewinn!“
Der Alte war auf Zack und befolgte seinen Rat. Und nun hatten wir das unverschämte Glück, nur acht Monate später wurde eine frei. Direkt am zukünftigen Aumunder Schwimmbad, nördlich von der Lindenstraße mit ihren vielen Geschäften und ein Zufall, genau gegenüber von Fallers Mehrfamilienhaus mit Fleischverarbeitungshalle im Hof und Ladengeschäft zur Straße.
Fallers Vater, der stiernackige, rotköpfige reiche Metzger auf der anderen Straßenseite, fuhr schon damals einen gepflegten Mercedes und war wer in Vegesack. Unser Wohnzimmer in der Sozialwohnung hatte eine moderne Glastür zum lang ersehnten Balkon. Leider mit Blick in das großzügig verglaste, gruselige Schlachthaus gegenüber.
In der Woche stachen sie dort die vor Todesangst quiekenden, sich sträubenden Wurstkandidaten ab. Das Blut floss rot, und jeden Mittag baumelten Dutzende geteilte Tierhälften dampfend an den Fleischerhaken. Sie füllten kurz danach die fast platzenden blitzblanken Verkaufstheken des Metzgerladens mit ihren sorgfältig aufgereihten frisch geteilten Fleischspezialitäten und leckeren Wurstwarenbergen.
Obwohl gestopfter Sohn reicher Eltern, kehrte Faller das nie raus. Er war kein ausgesprochener Angeber. Okay, vielleicht ein bisschen großmäulig. Dazu immer fröhlich und obenauf. Nur ab und zu, wenn er seinen Rappel kriegte, wurde er zur linken Sau. Zuerst war ich nach dieser Erfahrung geschockt, gelähmt und später immer wieder erneut baff über jede seiner mir und anderen ausgeteilten Gemeinheiten, die er allen der Reihe nach wie ein Süchtiger verpasste und genoss. Ich verdrängte, vergaß sie dann wieder nach kurzer Zeit, weil er viel älter als ich war, zwei Klassen höher, und sich trotzdem mit mir jungem Armleuchter abgab.
Denn ich profitierte ja auch von seiner „Freundschaft“. Durfte mit seinem schicken Fahrrad fahren, seine tollen Mickymaushefte lesen und sogar durch sein geheimes Bohrloch im Dachboden gucken, das direkt auf das Bett des Dienstmädchens darunter zielte. Dazu soffen wir gemeinsam eine ganze Buddel Billigkorn und übten Selbstbefriedigung.
Als wir eines Morgens zu fünft auf dem Schulweg waren und an einem Apfelgarten vorbeikamen, lockten uns seine knallroten reifen Früchte. Der kräftige, aber sportliche Faller ging ein paar Schritte zurück, nahm dann einen Anlauf Richtung Gartenzaun und schwang sich mit einem geschickten Sprung auf diesen hinauf. Ließ sich, gekonnt wie ein Profisportler, unter den ersten Apfelbaum fallen, schnappte ein paar Äpfel und warf sie uns zu. Genauso flink wie zuvor nahm er wieder einen Anlauf und hechtete, nach Luft ringend, auf unsere Seite zurück.
„Schmeiß mal ’nen Appel rüber, Baron von und zu“, sagte er und ich gab ihm meinen. Grinste, biss krachend hinein und grunzte zu mir. „Warte, kriegst gleich deinen Anteil“, kaute schmatzend weiter, kam ganz nah zu mir rüber und zischte mit vollem Mund: „Dein Anteil, du Arsch.“ Dann spie er mir seinen ganzen durchgekauten Brei ins Gesicht.
Ich war geschockt. Wischte mir angewidert mit dem Taschentuch seinen rausgerotzten Ekel aus dem Gesicht und konnte die Tränen nicht stoppen. Alle lachten sich schief. Am lautesten johlte Faller. Bewundernd schauten alle zu ihrem Helden hoch. Warum lernte ich nichts daraus?
Faller war stark und sehr selbstsicher. So wurde er von allen Kindern respektiert. Auch weil er ein guter Schüler war und sich sehr gut mit Körperkraft zu verteidigen wusste. Und der ewige Besserwisser: Wenn er etwas Weißes schwarz sah, dann war es verdammt noch mal schwarz. Wer das nicht kapierte, kriegte eine Kopfnuss oder einen Hieb in den Unterleib.
Ich akzeptierte das „clever“ und so war meine durch Unterwürfigkeit „erkaufte“ Freundschaft profitabel. Als sein Freund, oder besser Kapo, stand ich auch unter seinem Schutz:
„Mein geliebtes kleines Arschloch“ titulierte er mich oft in der Gruppe, wenn er gut drauf war, drückte mich mit seinen Pranken an sich und trällerte:
„Ooooh, was biste schöööön. Oh, was bist du schön. So was hat die Welt noch nicht geseeeehn, soooh schööööön, so schöööön!“
Alle lachten. Ich grinste süßlich und addierte aber leider eine weitere Kerbe in meinem Ego.
Durch Evas Leselust holte ich mir Woche für Woche die vielversprechendsten Bücher, Moby Dick, Robinson Crusoe, Lockruf des Goldes, und sog die großen Geschichten der Welt in mir auf. Als ich Eva einmal besuchte, las sie eine ganz neue Übersetzung aus dem Englischen, Alexis Sorbas, und schwärmte begeistert von den dilettantischen, tanzenden Griechen und seinem englischen Kumpan. Aufgrund meiner angeborenen Tollpatschigkeit nannte sie mich fortan „Sorbas“. Das fand ich zwar zuerst blöd, aber weil sie mich immer sehr zärtlich mit diesem Namen ansprach, mochte ich ihn immer mehr:
„Lieber Sorbas, gehen wir am Sonntag ins Kino, sie spielen „Vom Winde verweht“?“
„Gerne mein Schatz.“
„Sorbas, küss mich, ich habe dich ja so sehr vermisst.“
„Viele Kinder müssen wir machen, geliebter Sorbas. Was meinst du?“
Ich guckte erschrocken an die Decke und wusste keine gescheite Antwort:
„Meinetwegen eine ganze Fußballmannschaft. Aber um Gottes willen keine Mädchen. Eine Verrückte ist genug.“
Mit Vaters Linie-18-Bus schaukelte jeden Morgen der alte Müller-Borkum, ein ursprünglich aus Emden stammender pensionierter fetter Loggerkaptän, in die City. Um seinen täglichen Besorgungen nachzugehen, die er mit einem „Gesundheitsspaziergang“ durch das Kaufhaus Karstadt abschloss. Vor der Rückfahrt wurde dieser täglich beim Essen in „Remmers“, Bremens „Hofbräuhaus“, mit einem halben Liter Haake Beck Bier „abgefeiert“, wie er Vati erzählte. Er wohnte im nördlichen Aumund in einer Arbeiterreihensiedlung mit einfachen Eigentumshaushälften aus den Dreißigern. So über die Jahre lernten sich beide, Schaffner und Passagier, gut kennen und wenn es keine Karten zu kaufen oder kontrollieren gab, führten beide so manches, freundliches Schwätzchen und mochten sich.
Dann starb überraschend Müllers Ehefrau, und Vater erlebte an dessen tiefer Trauer und Verzweiflung, dass er über ein volles Jahr unter ihrem Tod litt. So half er dem sympathischen Witwer instinktiv immer wieder auf der morgendlichen Fahrt ein bisschen über seinen Kummer hinweg: durch ein paar lustige Witzchen, Vorortklatsch und verrückte Sprüche.
Eines Abends kam mein Alter ganz aufgeregt nach Hause und erzählte Mutter bereits beim Ablegen der Uniform das Wichtigste vom Tage.
An diesem Nachmittag hatte er wieder mal seinen Stammfahrgast begrüßt:
„Hallo Käpt’n. Heute alles Okay auf der Borkum?“
Der dicke Rentner mit riesigem Hängebauch nickte schwer atmend.
„Segel voll gesetzt, kein Mann über Bord, lieber Baron. Bin heute gut drauf, hab neue Zukunftspläne gemacht und den Entschluss gefasst, auf meine geliebte Insel zurückzukehren. Borkum ich komme!“
„Was machen sie aber dann mit ihrem schönen Haus. Sie sind doch der Besitzer. Wollen sie es aufgeben, verkaufen oder vermieten?“
„Ich gehe jetzt über die Fünfundsiebzig und will meine Ruhe haben. Da ich, Klabautermann noch mal, mein halbes Leben mit Trampfahrt auf ausländischen Pötten und nur ein paar Jahre für die Rente auf deutschen Loggern fuhr, reicht sie von vorne bis hinten nicht aus. Ich denke an einen Verkauf auf Rentenbasis. Eingetragen im Grundbuch ist das was Sicheres im hohen Alter. Kleine fette Anzahlung und ewig gutes Bares aufs Leibrentenkonto: Monat für Monat. 100 Prozent abgesichert durch den Notar.“
Vater stimmte ihm nachdenklich zu und dachte an sein bescheidenes, aber wachsendes Bankguthaben. 2.000 Mark hatte er sich über viele Jahre mühselig zusammengespart, um seinen großen Lebenstraum zu verwirklichen: ein eigenes Automobil. Genauer, einen gebrauchten Borgward Isabella. Bei der Wehrmacht baute er acht Jahre vorher seinen kostenlosen Führerschein und der lag ewig ganz oben in seiner „Sammelsurium-Zigarrenkiste“. Bei den wichtigsten Lebensdokumenten, vom Freischwimmerausweis bis hin zum Arbeitsvertrag der BVG.
„Wie hoch wären denn Anzahlung und Monatsrate?“, stammelte Vati mutig.
„Hab ich alles schon lange im Kopf ausgerechnet: Zweitausendfünfhundert Anzahlung und monatlich einhundert, bis zum Lebensende.“
Vater schluckte nachdenklich. Er verdiente damals netto nur 380 Mark im Monat. Davon gingen 65 Mark Miete an jedem Monatsersten an die Wohnungsgesellschaft. Allerdings mit nur 35 mehr konnte er nun das bescheidene Häuschen abzahlen. Das rechnete sich gut. Dabei vergaß er erst mal die noch fehlenden 500 Märker der Anzahlung. Er riss sich also zusammen und sagte, bereits mit nervöszittriger Stimme:
„Herr Müller, ich wäre an ihrem Haus in…teressiert. Selbst die Anzahlung ist schon da“, denn er gebar in diesem Moment bereits eine Idee. Seine, seit früher Kindheit aufgebaute, geliebte Briefmarkensammlung! Sie würde aufgrund seltener Werte des 19. Jahrhunderts aus den Anfängen der deutschen Briefmarkengeschichte ausreichenden Verkaufserlös bringen. Er entschloss sich spontan, sie zu opfern:
„Wann könnte ich mit meiner Familie ihr Haus besichtigen?“
„Wie wäre es Sonntagvormittag, so um elf?“
Vater sagte zu. Muttis cooler Kommentar zu Hause:
„Klingt nicht übel. Ich hoffe, es ist keine von diesen Bruchbuden, wo man sich bei den Nachbarn für schämen muss. Vergiss nicht, ich stamme aus einer Büroleiterfamilie!“
Ich war ganz aufgeregt. Konnte den Sonntag kaum abwarten, und der Alte war für mich zum ersten Mal ein Held. Ich fand, er hatte richtig clever gehandelt. Am Sonntag marschierten wir dann auch sofort nach dem Kirchgang geschlossen, in besten Sonntagsklamotten, Richtung Nord-Aumund. Etwas über einen Kilometer bis zu Müllers Haus in der Borchshöher Straße. Nach hundert Metern hörte das „bessere“ Wohnviertel der individuellen Einfamilienhäuser auf und links und rechts standen lange Reihen immer gleich aussehender Reihenhäuser. Eine Reihenhaussiedlung langweiliger, älterer Dreifamilienhausgruppen, mit Mittelhaus und linkem, sowie rechtem Endhaus, zweistöckig, pro Geschoss mit je 40 Quadratmetern und einem kleinen dahinter geklebten, winzigen Waschhaus.
„Prost Neujahr. Hab mir so was schon gedacht. Wenn’de mal besoffen nach Heim kommst, findste dein eigenes Haus nicht mehr“, lästerte Mutti.
Vater sagte gar nichts und blieb nervös, mit zusammengekniffenen Lippen vor der Nr. 43 stehen. Aufgeregt murmelte er:
„Das, das ist es ja denn. Sieht doch recht gut aus, was?“
Das Eckhäuschen war frisch gestrichen und zeigte einen gepflegten, winzigen Vorgarten hinter einem billigen Hühnerdrahtzaun. Ein richtiges und vor allen Dingen bezahlbares schlichtes Einfamilienhaus. Vielleicht unsere einzige große Chance im Leben, doch noch zu was zu kommen.
Mutti schenkte dem Alten einen giftigen Blick, trabte durch den Vorgarten, knallte mit der rechten Faust auf den Klingelknopf, drückte den Tür öffnenden, sie freundlich begrüßenden Besitzer Müller zur Seite und brauste in das Haus hinein. Der Seebär, Vater und ich folgten ihr baff. Sie steckte ihren Kopf mit abweisender Mimik kurz in die Küche und lief dann mit großen Schritten weiter in das kleine Wohnzimmer. Das war super eingerichtet: die Wände mit exotischen Mitbringseln aus aller Welt bepflastert und viel alte Schiffsdeko, sowie mehrere antike Seegemälde. In einem Glasschrank präsentierte der alte Seefahrer seine selbst gebauten Schiffsmodelle und zwei aufgereihte, putzige Buddelschiffe.
Müller war mein Mann! Mutti aber war mal wieder rechthaberisch blind. Sah sich kurz angewidert um und linste durch die Terrassentür in den Garten. Dann keifte sie Müller an:
„Das rechts hinterm Haus, das kleine Häuschen. Was ist denn das?“
„Mein altes Waschhaus. Da lassen jetzt alle Nachbarn eine moderne, raumsparende Waschmaschine einbauen und gewinnen wertvolle, zusätzliche Nutzfläche.“
Sie unterbrach ihn zynisch:
„Mann, halten sie mich doch nicht für blöd. Ich meine das winzige Häuschen hinter ihrem Waschhaus. Das sieht doch aus wie ein stinkendes, mittelalterliches Plumpsklo! Hab ich recht?“
Müller nickte ganz verdattert. Vater war bestürzt:
„Liebe Mine … Schatzi. Das reißen wir sofort weg und bauen in die rechte Ecke des fast leeren Waschhauses eine richtige moderne Spültoilette ein, du …“
Mutti hatte genug. Sie drehte sich auf ihrem Absatz um, hob eingeschnappt ihren Kopf, ohne uns anzublicken und raste zurück, durch die noch offenen Türen hinaus auf die Straße. Dabei schrie sie:
„Dieser dusselige Verlierer. Bietet mir doch aufs Alter eine Bruchbude mit ’nem Bauernscheißhaus an. Oh, Gott im Himmel, warum habe ich nicht damals auf Vater gehört. Der wusste, was ich für ’nen Knallfrosch heirate.“
Eva war im Sommer 1956 verreist. Ihre Familie fuhr mit dem neuen Mercedes 220 nach Lloret del Mar. Teufel, waren das drei schlimme Wochen. Zum ersten Mal nach Jahren war sie nicht da, Tag für Tag, Woche für Woche. Ich litt unter der Trennung. Sehnte mich nach ihrem Augenblitzen, Stupsnäschen, langem glänzenden Haar, süßen Nacken, runden Brüsten, Po. Der Umarmung. Den süßen, feuchtwarmen Küssen, dem intimen erregenden Pettingspiel. Jetzt wusste ich, dass sie die große Liebe meines Lebens war.
Und ihr schien es ähnlich zu gehen. Als sie zurückkam, fiel sie mir jubelnd in die Arme und schluchzte:
„Ich hab dich ja so schrecklich vermisst lieber Sorbas. Küss mich besinnungslos. Ich liebe dich, liebe dich, liebe dich.
Eines Tages spendierte mir der Konditor Radloff, für den ich ab und zu eine Geburtstagsauslieferung übernahm, als Lohn nicht nur die üblichen 50 Pfennig, sondern obendrauf noch einen Eisbecher mit drei Kugeln, Schokolade, Zitrone und etwas ganz wildes Exotisches, Ananas aus Hawaii. Ich saß direkt am Fenstertisch. Hielt mit der Linken den silbernen, verchromten Metallbecher, und mit der Rechten kratzte ich, ganz ganz langsam immer abwechselnd den aufgetauten Teil der Kugeln ab. Genussvoll ließ ich jeden Löffel im Mund schmelzen und war so richtig gut drauf, da kam ein riesiger weißer amerikanischer Wagen herangeruckelt und blieb stotternd mit sterbender Maschine und den rechten Rädern auf dem Fahrradweg stehen. Emil Sawatzkis stadtbekannter Luxusschlitten.
Es war warm an diesem Maimorgen, und ich hörte durch die offene Ladentür wie Emil, der sich hinten an eine mollige, gut aussehende Blondine mit einem viel zu engen beigen Cordkostüm kuschelte, verärgert seinen Chauffeur anbrüllte:
„Willy, du Penner. Hast du schon wieder vergessen zu tanken?“ Er fasst sich an seine Stirn und wetterte weiter. „Das kann doch nicht wahr sein, da kommen wir tatsächlich zu spät zur Verabredung. Hat fast ein Jahr gedauert, den Vertrag mit Konsul Wagner auf die Beine zu stellen. Sein Lager ist exterritoriales Hafengelände. Da spar ich mir einen Haufen Geld und viel Arbeit mit dem Zoll. Was soll denn der Mann von mir denken, und sein Notar erst?“
Der Chauffeur meldete sich kleinlaut: „Tut mir leid, Chef.“
Die freche Blondine zeigte wenig Verständnis: „Emil, du bist und bleibst doch ein knickriger, kleiner Altwarenschacherer. Du hast einfach nicht das Zeug dazu, dich in der feinen Bremer Geschäftswelt zu etablieren. Einfach keine Klasse, weil du an den falschen Enden sparst, Mann. Dein Chauffeur ist ein ehemaliger Baggerfahrer, dein Verlobungsring mickrig und dein Schwänzchen, ha, winzig. Warum hat mich das Schicksal nur so hart bestraft?“
Darauf reagierte der abgebrühte Sawitzki überhaupt nicht. Nachdenklich zog er einen Zehner aus seiner goldenen Geldspange, reichte ihn dem Fahrer und kommandierte mit klaren Befehlen:
„Willy, die nächste Tankstelle ist drei Kilometer entfernt. Hier, nimm den Zehner und renn rüber in die Apotheke. Kauf zwei Liter Waschbenzin und sag dem Apotheker, dass er sein Glas gleich zurück erhält. Aber bisschen fix.“
Sprang aus dem Wagen, und während sein bestürzter Angestellter losraste, schraubte er bereits am linken Kotflügel den Tankdeckel ab. Einige Minuten später kam der Chauffeur angeschnauft, füllte hastig den glucksenden Treibstoff ein, verschraubte den Tank und rannte mit dem leeren Glas zur Apotheke zurück. Sawitzki freute sich:
„Den Termin kriegen wir noch hin, Schatzi. Aber eins sag ich dir, wenn die Importchose irgendwann den Bach runtergeht, mach ich hier die Mücke und setz mich in irgendeine Großstadt ab. München oder vielleicht Frankfurt, das sind Plätze mit Zukunft. Dicke, internationale Kohle! Und da mach ich dann auf Makler. Im großen Stil Häusergeschäfte. Ich mag Bremen, aber hier gibt’s zu viele arrivierte Familienbetriebe und arme Fabrikmalocher, die nichts drauf haben. Da fehlen der fette Mittelstand und die spekulativen Zocker, also muss ich logo runter in den Süden. Mein schwarzes Eingemachtes wird zum Startkapital und weil mich keiner kennt, kann ich erst mal unauffällig loslegen. Preiswert aufkaufen und die Kohle mit unkontrollierbaren Erhaltungsaufwendungen unterbringen. So legt man an und spart noch Steuer obendrein. In Bremen ist doch tote Hose angesagt: zu viel Loser und eine Klicke von Erbenheimern, die wie eine verschworene Mafia alles im Blick hat und keinen von unten ranlässt.“
Der arme Willy kam schweißtriefend zurück. Startete die Maschine, die zuerst noch etwas stotterte und sie rauschten davon.
Sawitzki, der Erfolgsmensch. So einer wie er wollte ich werden! Der war kein Ikarus. Der wusste genau, was lief, und kam bestimmt nie in die Nähe einer Selbstüberschätzung.
Die „Haus mit Plumpsklo“-Idee war also nichts geworden. Der Alte schien auch irgendwie erleichtert, weil er schließlich dem jahrelangen Abzahlungshorror entronnen war, und verschwand etliche Tage in seinen Feierabendstunden. Schweigsam, den Inhalt dieser verbergend, aber immer wenn er anschließend nach Hause kam, leuchteten seine Augen, und er pfiff gut gelaunt seine alten Wander- und Soldatenlieder:
„Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Fässern da faulte das Wasser. Und täglich ging einer über Bord.“
Eines Tages kam er dann samstagnachmittags sehr früh zurück. Mutti war noch in der City einkaufen, und so tätschelte er mir die linke Wange und sagte:
„Komm, Kerlchen. Machen wir eine kleine Spritztour auf der Lindenstraße. Zum Gemüse-Steller. Den will ich doch mal so richtig in die Eier treten. Glaubt doch, nur er hätte den Erfolg gepachtet. Der Herr Erbschleicher.“
Ich begriff nicht, warum ich bei seinem alten Schulkameraden, der eine Obst- und Gemüsehandel-Erbin mit Mietshaus geheiratet hatte, mit aufkreuzen sollte und überlegte mir bereits eine glaubwürdige Fluchtausrede. Da setzte er noch einen Hammer drauf:
„Und danach gönnen wir beide uns was und fahren cool zum Eissalon Radloff. Vor den Augen des staunenden Volkes essen wir dann jeder einen teuren Mambo-Becher. Den ganz großen, mit Plastikaffen und Palme.“
Der riesengroße sahnige Mambobecher. Traum meiner Genusslüste: Ich willigte ein. Das mit der „Spritztour“ begriff ich zwar nicht ganz, denn der Eisladen war doch nur zwei Straßen entfernt. Aber als wir beide auf die Straße traten, prunkte ein blitzblanker, schneeweißer, höchstens drei Jahre alter Borgward vor dem Haus.
„Hat nur 85.000 Kilometer drauf. Ich hab ihn als Unfallwagen gekauft, verbeulte rechte Seite. Zehn freie Nachmittage hab ich gebraucht, um Kotflügel und Stoßstange auszutauschen. Sensationeller Preis, ich brauchte nur lächerliche zweitausend zu zahlen“, blabberte der Alte aufgeregt.
Ich konnte es nicht glauben. Seine jahrelang mühsam angesparten paar Mille waren weg. Statt vernünftig handelnd das günstige Haus zu erwerben, hörte er auf meine spinnende Mutter und verschleuderte sein gutes Geld für ’ne Angeberkarre.
Trotzdem, ich fand der Isabella sah echt geil aus, vielleicht wie ein etwas zu klein geratener amerikanischer Straßenkreuzer. Allerdings der Cadillac-Superklasse! Beeindruckt rutschte ich auf den schicken marineblausilbernen Beifahrersitz. Der Alte zündete sich im linken Mundwinkel eine filterlose Juno an, startete den Motor mit reinklickendem ersten Gang und gab Gas. Dreimal fuhr er total „high“ die Lindenstraße, sehr sehr langsam, rauf und runter. Hoffte natürlich, dass uns möglichst viele Nachbarn erkannten. Es war ein warmer Sommertag, und wir hatten vorne die kleinen Dreiecksfenster halb aufgedreht. Als wir das zweite Mal am Stoppschild zur Vulkan-Schiffswert hielten, sah ich den vorbeischlendernden Möbelhändler Bahr ungläubig zu uns hereinstarren und kriegte mit, was er seiner Frau Ingeborg zujuchzte:
„Hast du das gesehen? Der kleine Schaffnerkacker von der Straßenbahn, mit dem Hochstaplernamen, fährt jetzt dicke Autos. Wenn er sich mal bloß nicht übernimmt.“
„Na besser, als dass er sich mit jungen Verkäuferinnen im Lagerhaus kuschelt“, keifte sie und lachte schrill auf, als sie an seiner wütenden Grimasse merkte, dass ihr Stachel saß.
„Dieser neidische Sargtischler. Ist ihm sofort auf den Magen geschlagen. Der Baron hats ihm endlich mal gezeigt. Genug mit dem Cruisen. Fahren wir zu meinem Freund Gemüse-Steller rüber. Der wird vor Neid in seine Gurken springen“, meinte der Alte in Hochform und griff mit der Rechten in das Steuerrad, um mit dem Wagen über Straße und zwei Bürgersteige zu drehen.
Nach fünf Minuten coolem, langsamem Gleiten erreichten wir Stellers Geschäft. Der Alte grinste supergut drauf. So kannte ich ihn gar nicht, ihn, den zeit meines Lebens immer stummen, unsicheren Mann. Der höchstens mal ein paar Worte des Tadels für mich fand. Nun als Angeber, Obermacker. Stellers Laden hatte zwei große Schaufenster. Im linken war eine niedrige Gemüselandschaft mit Kohl- / Gurkenbergen sowie Kartoffel- und Zwiebelsäckchen aufgebaut, und das rechte zeigte eine wohlsortierte Aufreihung von flachen, knallvollen Fruchtkörben mit ausgesuchten Äpfeln, Birnen sowie Weintrauben. Über beiden Fenstern stand in angeschraubten, hellgrünen Grotesk-Holzbuchstaben: „Obst & Gemüse Steller“. Vor der weit geöffneten Tür pries eine frischbekritzelte, frei stehende Kreidetafel die Sonderangebote des Tages: 1 A: Gurken in Gläsern! Der Alte parkte den Wagen protzend vor dem Eingang. Drückte sich seinen alten zerbeulten braunen Filzhut auf die Glatze und steckte sich seine schicke Piloten-Sonnenbrille, die er mal in der Bahn fand, ins Gesicht.
„Komm mit, Junge“, sagte er und wir stiegen aus. Wir betraten den Laden, in dem sich gerade niemand befand. Der Alte suchte eine Handvoll besonders lecker aussehende, dunkelrote Kirschen aus und reichte mir einige, die ich sofort mit Genuss konsumierte und ihre Kerne durch die offene Tür, Richtung Straße spuckte. Da kam Karl Steller schweißtriefend vom Lager zurück, beladen mit zwei staubigen Kartoffelsäcken. Die setzte er, als er Vater erkannte, vor uns auf den Boden und boxte uns beiden kameradschaftlich den Brustkorb.
„Hallo, wen haben wir denn da: Ihre Hochwohlgeborenen, die Barone!“
„Alles klar, Karl? Wie läufts Geschäft?“