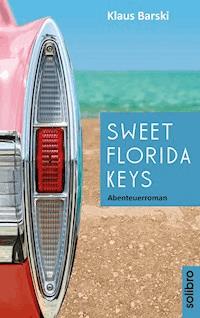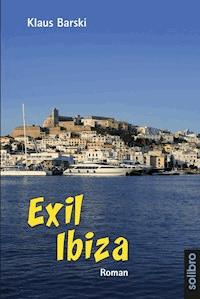Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Solibro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: cabrio
- Sprache: Deutsch
Das Aussteigerleben am Mittelmeer ist für viele ein Lebenstraum. Auch für Peter und Robby. Ihr Ziel ist eine Meeresblick-Wohnung im legendären Grandhotel Negresco in Nizza. Aber das kriminelle Potential des einen wird zum Schicksal des anderen. (Erfahrungs-)Millionär Klaus Barski zeigt auf sehr unterhaltsame Weise, welche Wege von Frankfurt an die Côte d'Azur führen, und was Kinderbücher, Kirche und Kriminelle damit zu tun haben. Sein Abenteuerroman führt in die schillernde Parallelwelt der Riviera. Der Glitzerwelt der oberen zehntausend Schönen, Reichen, Legendären einerseits und dem Paradies der wissenden Genießer: idealistischen Künstlern, Aussteigern und Sinnsuchern, die ihr Lebensglück in der einmaligen Atmosphäre von kristallklarem Meer, azurblauen Himmel und blühenden, duftenden Berghängen zu finden glauben. Im Kern geht es um die Geschichte eines suchenden, fast abgestürzten Losers, der sich zu einem rücksichtslosen Macher und Gewinner entwickelt. Klaus Barski geht seine Projekte auch im richtigen Leben nur im großen Stil an. Zur Autorenlesung von "Lebenslänglich Côte d'Azur" in Monte Carlo kamen Prinzen und Prinzessinnen des monegassischen Fürstenhauses, Milliardäre und Jetsetter. "Sagen Sie nicht ,Ja'. Sie dürfen auf gar keinen Fall ,Ja' sagen. Sonst sind Sie drin. In der Barski-Maschine. Im Erzählrausch. Im Schaumschläger-Universum. In Barskis Geschichte. Da kommen Sie nicht mehr raus." Volker Weidermann in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Barski, einer der von ganz unten kommt (Arbeiterfamilie, keine Schulbildung, Arbeitsbeginn mit 13 Jahren), schaffte mit harter Arbeit und gesundem Geschäftsinstinkt den Aufstieg vom Volksschüler und Sozialhilfeempfänger zum millionenschweren Immobilienkaufmann und Schriftsteller. In all seinen Romanen schildert er mitreißend, schonungslos und doch immer mit einem selbstironischen Augenzwinkern knallharte, oftmals abenteuerliche Erfahrungen, wie sie ihm auch auf seinem Lebensweg in ähnlicher Weise widerfahren sind. Klaus Barski ist dementsprechend natürlich kein Leisetreter. Gerne erzeugt der Werbeprofi Aufsehen. So als er anlässlich der Veröffentlichung seines Romans Der deutsche Konsul medienwirksam echte und gefälschte Dollars aus dem Fenster warf. Oder als er mit Luxuslimousine im Frankfurter Café Schwille aufkreuzte um seinen Ozelot an einer Eisenkette auszuführen – Klaus Barski: eben ein echter (Erfahrungs-) Millionär mit Tick und Charme.
Bibliografie
Der Frankfurter Spekulant (1999) •
Der Loser (2000) •
Der deutsche Konsul (2001) •
Exil Ibiza (2003) •
Lebenslänglich Côte d’Azur (2005) •
Blut-Zeitung (2008) •
Prügel für den Hausbesitzer (2012) •
Sweet Florida Keys (2014) •
Klaus Barski
LebenslänglichCôte d’Azur
Roman
1. Jöricke, Frank: Mein liebestoller Onkel, mein kleinkrimineller Vetter und der Rest der Bagage. Solibro Verlag 1. Aufl. 2007
ISBN 978-3-932927-33-1 / gebundene Ausgabe
ISBN 978-3-932927-36-2 / Broschur-Ausgabe
eISBN 978-3-932927-53-9 (epub)
2. Barski, Klaus: Prügel für den Hausbesitzer
Tatsachenroman eines Immobilienspekulanten
Solibro Verlag 1. Aufl. 2012; ISBN 978-3-932927-48-5
eISBN 978-3-932927-52-2 (epub)
3. Barski, Klaus: Sweet Florida Keys. Abenteuerroman
Solibro Verlag 1. Aufl. 2014; ISBN 978-3-932927-78-2
eISBN 978-3-932927-89-8 (epub)
4. Barski, Klaus: Lebenslänglich Côte d’Azur. Roman
Solibro Verlag 1. Aufl. 2018; ISBN 978-3-96079-049-5
eISBN 978-3-96079-050-1 (epub)
5. Barski, Klaus: Exil Ibiza. Roman
Solibro Verlag 1. Aufl. 2018; ISBN 978-3-96079-051-8
eISBN 978-3-96079-052-5 (epub)
6. Usch Hollmann / Markus Böwering: Wasserschloss zu vererben.
Ein Münsterlandroman
Solibro Verlag 1. Aufl. 2018; ISBN 978-3-96079-055-6
eISBN 978-3-96079-056-3 (epub)
eISBN 978-3-96079-050-1
1. Auflage 2018
© SOLIBRO® Verlag, Münster 2018
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: © Wolfgang Neumann
Coverfoto: © iStockphoto.com/SabinaS
Fotos des Autors: S. 2: © privat
www.solibro.de
verlegt. gefunden. gelesen.
„Sagen Sie nicht ‚Ja‘. Sie dürfen auf gar keinen Fall ‚Ja‘ sagen. Sonst sind Sie drin. In der Barski-Maschine. Im Erzählrausch. Im Schaumschläger-Universum. In Barskis Geschichte. Da kommen Sie nicht mehr raus."
Volker Weidermann in:Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Inhalt
DAS ANTLITZ
ST. TROPEZ 1975
CÔTE D’AZUR
LOSER?
FRANKFURTER HASARDEURE
DIE BANK
DIE KIRCHE
LIEBESLEID
KNAST IN KARATSCHI
SPANIENFAHRT
ARBEITSLOS
ORA ET LABORA
DAS SCHWARZGELD
BAHAMAS
FRANKFURT
DER MORD
NACH DEM KNAST
PALACIO PRINCI PE ANDORO DE STA. INÉS
NIZZA
DER RICHTER
DAS ANTLITZ
DAS ANTLITZ
Blut lief über Ralfs Gesicht, als Peter ihn zum ersten Mal sah. Blut, das sich am Kinn mit Tränen vermischte. Peter Beck war schockiert über Ralfs verzweifelten Blick. Der Priester schlug weiter unbarmherzig auf Ralf ein, wie von Sinnen. Ein fanatischer Diener Gottes, der glaubte, den wahren Glauben im Religionsunterricht in die Kinder reinprügeln zu können. Der Priester zeigte kein Verständnis für harmlose Jungenstreiche. Er hatte Ralf bei der stillen Post erwischt und züchtigte ihn dafür.
Mit seinem Verhalten verursachte der schwarzgekleidete Gottesmann bei Peter ein starkes Ekelgefühl. Es bildete das Fundament für seinen späteren Austritt aus der Kirche und seine ablehnende Haltung gegenüber Klerikern.
Peter mochte Ralf, den witzigen Kerl aus der Bad-Vilbel-Schule. Er hatte Mitleid mit ihm, als er so unsinnig bestraft wurde.
In der schlimmen Zeit, als sein Alter arbeitslos war und es nur am Sonntag Fleisch zu essen gab, sah er Ralf beim Bummel durch Sachsenhausen unverhofft wieder. Zum Mittagessen hatte Peters Mutter Senfeier auf den Tisch gestellt. Sie widerten ihn an, und er brachte nur ein halbes Ei herunter. Als seine Mutter kurz aus der Küche ging, kippte er schnell den Rest seines Mittagessens in den Müll, stopfte eine alte Zeitung darüber und träumte von wohlschmeckender Gulaschsuppe. Und von der pikanten Hackfleischbrühe im Picnic-Imbiß an der Hauptwache. Die kostete allerdings neunzig Pfennige. Sie war sein kaum bezahlbares Traumessen.
Peter verließ die Wohnung und schlenderte durch die alten Kopfsteinpflastergassen in Richtung Eiserner Steg. Durch die großen Fensterscheiben schaute er ins Restaurant Zum goldenen Böckchen. Schmausende Gäste luden sich riesengroße dampfende Fleischportionen von einer mit Petersilie dekorierten silbernen Platte auf ihre Teller und prosteten sich gutgelaunt zu. Es waren vermögende Leute, die sich die tollsten Genüsse im teuren Stadtrestaurant leisten konnten. Eine Welt, die Peter nicht kannte. Durch das große Fenster sog er sie gierig in sich auf.
Plötzlich entdeckte er Ralf. Zwischen den gutgekleideten Gästen saß er da und speiste. Anscheinend zählte er zu den Glücklichen, die mit einem silbernen Löffel im Mund geboren werden. Einer von denen da oben.
Viele Jahre später erlebte Peter Ralf auf dem Zenit seiner Karriere, ganz oben in der Frankfurter Gesellschaft. Bei einer Supervernissage in der Nr.-l-Galerie hielt er Hof, in Maßanzug, Rollkragenpullover und mit modischem Dreitagebart. Mit einem Glas Champagner in der Hand mimte er für die Presse den coolen Macher.
Fast ein weiteres Jahrzehnt später, nachdem Peter seelisch total am Ende wie der letzte heruntergekommene Straßenköter durch das nächtliche Frankfurt schlich, steuerte ein Penner mit Krückstock auf ihn zu. Starrte ihn an, blieb stehen, kratzte sich nachdenklich am Hintern.
»Biste nich derrr Beck? Der Peter Beck, Mann?«
Der Berber sah furchtbar aus in seinen abgetragenen, dreckigen Klamotten, den ausgelatschten Schuhen und einem Südwester auf dem Kopf. Den nahm er ab, hielt das bärtige, aufgedunsene Gesicht im Schein der Straßenlaterne hoch.
»Na, erkennste mich nun, Beck?«
Es verschlug Peter die Sprache, als er erkannte, wer vor ihm stand. Ralf Hagemann! Den linken Arm hielt er merkwürdig verdreht.
»Gelähmt. De ganze Seite … Schlaganfall. Scheiß Schlaganfall! Jetzt, wo ich ganz unten bin, will keine Sau mehr was von mir wissen«, erklärte er, als er Peters erschrockenen Blick bemerkte.
Ralf begann zu schluchzen. Peter blickte in das tränenüberströmte Gesicht und erinnerte sich an den kleinen geschundenen Jungen. Er bemerkte, wie sehr sich das Jungengesicht mit der gealterten, aufgeblähten Säuferfratze deckte.
Das Antlitz der gemarterten, menschlichen Kreatur war durch Ralf zu einem Symbol in Peters Leben geworden. Er verstand es als Antlitz des Herrn – sein Gewissen, sein Mitleid mit den Geschundenen und sein Erkennen der menschlichen Ohnmacht. Immer wieder tauchte es auf.
Peter war erschüttert. Gerührt nahm er den Penner in die Arme, konnte kein Wort sprechen. Er roch die Schnapsfahne und zog Ralf um so fester an sich. Peter kramte sein gesamtes Bargeld aus seiner Hosentasche heraus und drückte es dem alten Weggefährten in die Hand. Drehte sich zitternd auf dem Absatz um und hastete in Richtung Fluß. Diesem ernüchternden Wiedersehen fühlte er sich nicht gewachsen. Er lief einfach davon.
Als er den Main erreichte, setzte er sich schwer atmend auf eine eiskalte Bank, schaute den Raben zu, die sich in großer Zahl auf der Brücke, in den Bäumen, an der Uferböschung und auf den schaukelnden Sommergartenpontons herumtummelten.
Peter Beck dachte an damals, an die Jahre der Jugend, als er gierig nach dem Leben griff. Dachte an die siebziger Jahre …
ST. TROPEZ 1975
Der junge Beck war ein fauler Kerl. Er haßte die Schule, denn sie bedeutete zuviel Arbeit für ihn. Die Bemühungen seiner Lehrer betrachtete er eher als Schikane. So brachte er es nicht einmal bis zur Mittleren Reife, obwohl er ein intelligenter Junge war. Nach Verlassen der Schule gammelte er eine Lehre als Verlagskaufmann bei einem Offenbacher Verlag durch. Die Abschlußprüfung schaffte er mit Ach und Krach.
Zuhause war alles Scheiße. Der Alte arbeitete als Formulardrucker im Keller der Sparkasse, verdiente nur sehr bescheidene Kohle. Träumte statt dessen von der guten alten Zeit unter Adolf, als er bei der Luftwaffe ohne Flugzeuge diente.
»Wenn die Amis mit ihren mächtigen Juden nicht eingegriffen hätten, wär ich heute Rittergutsbesitzer im Osten. Der Führer hat es uns versprochen! Als Belohnung für alle Portepeeträger. Nach dem Endsieg«, lamentierte er oft, wenn er besoffen war. Dabei bohrte sich der alte, unbelehrbare Nazi in der Nase. War er fündig geworden, hetzte er weiter: »Juden in der Nase … Parasiten, die raus müssen. Glaub ja nicht ihre Lügen, Junge! Glaub sie nicht. Von wegen Millionen tote Juden und KZ-Greuel. Die hocken alle stinkreich in Florida und verjubeln unsere Wiedergutmachung!«
Kopfschüttelnd versuchte Peter, Einwände anzubringen, erntete allenfalls eine Kopfnuß und mußte sich die idiotischen Belehrungen seines Vaters anhören.
»Weil die unser gutes Geld stehlen, zahlen wir die hohen Steuern.
Bleibt nur ein beschissener Rest. Ich hoffe, Franz-Josef wird mal rankommen. Da werden se aber gucken, die Untermenschen, jawoll! War ‘ne tolle Zeit damals mit den Fackelmärschen, dem sauberen Jungvolk. Ja, und die deutschen Tugenden – sportlicher, fairer, klarer Geist in gesunden, gestählten Körpern. Jetzt werden wir von denen mit Amerikanismus vergiftet – Negermusik, Kaugummi, Jeans und Coca Cola. Wenn die uns nicht so ausnehmen würden, wär’s ein gutes Leben in unserem Land. Und ich könnte mir ‘nen Opel Kadett leisten.«
Das war sein Stichwort. Er schnappte sich einen Suppenteller, legte ein Kissen an die rechte Sofalehne und setzte sich in seinen imaginären Opel. Die Beine lang auf dem Sofa, trank er zuerst einen großen Schluck aus der Flasche, bevor er Motorgeräusche imitierte. »Brrrummm!« Hielt den Teller wie ein Lenkrad in beiden Händen, raste als Rennfahrer durch Kurven. »Brrrummm!« Und dann voll in die Bremse, mit dem rechten Fuß auf die linke Sofalehne.
Peter entsetzte dieses Spektakel jedesmal aufs neue. Der Alte war ein Narr, ein kompletter Idiot!
Mutters höhnischer Kommentar traf den Alten ins Mark. »Dein Schwager Walter spinnt nicht auf dem Sofa rum und träumt vom Autofahren. Der hat was im Kopf und fahrt Mercedes. Er hat einen 190er!«
Das saß. Vater schmiß wütend den Teller auf den Boden und brüllte: »Dein Bruder Walter! Ein Prolet! Macht die dicke Asche mit Plünnen und Oldiesen! Ein lausiger Altwarenschacherer, der arme Lumpensammler linkt! Und du läßt dich von seiner Penunze blenden! Sein Geld stinkt! Hätten wir nicht durch die vielen Verräter den Krieg verloren, dann wäre unsere Welt eine bessere!«
Mutter lachte an dieser Stelle immer befriedigt auf, weil ihr Stachel saß und den Alten schmerzte. Sonst war sie eher ruhig und zurückhaltend.
Mutter lebte für die Bibel. Mindestens viermal in der Woche rannte sie in einen Gottesdienst und hatte stets eine weise Bibelstelle als Lebenshilfe parat. Überall in der Wohnung hingen religiöse Drucke an den Wänden, von der Kreuzigung bis zum Verrat durch Judas war alles dabei. Von Adam und Eva bis zu Saulus. Und der kleine Peter durfte bei keiner Sonntagsmesse fehlen, wurde zum Meßdienerdienst und weiteren Laienarbeiten gezwungen. Und davon hatte er eines Tages genug.
Peter wußte genau, daß er diesen Mief verlassen mußte. An dem Tag, als er sein erstes Gehalt in Empfang nehmen konnte, zog er aus.
»Ein Esser weniger. Auch nicht schlecht«, schnauzte der Alte kalt. Mutter weinte.
Peter Beck hatte keine besondere politische Meinung. Daß die ganz Rechten auf dem falschen Weg waren, sah er beim Vater. Die Linken wußten es auch nicht besser. Das wiederum sah er an den Klugscheißern von nebenan, Arbeitern der nahen Kosmetikfabrik. Verblendete, mißbrauchte Parteimitläufer, die hart arbeiteten und trotzdem nichts drauf hatten.
Der normale Arbeitstag war nicht gerade nach seinem Geschmack. »Easy Street«, schrille Tagträume, das lag eher auf seiner Wellenlänge. Deshalb schmiß er bereits den zweiten Job – obwohl die Stelle in der Werbeagentur anfangs recht interessant schien. Erfüllung oder gar Spaß fand er nur in den Abendstunden beim Bier in der Jazzgasse oder im Club Voltaire. Unter gleichgesinnten Halbgebildeten und idealistischen Angestellten, die das Studium verpaßt hatten, aber trotzdem von einem erfüllten Leben als Kreative träumten. Unter Retuscheuren, die sich als zukünftige Maler sahen, unter Werbetextern, die von einer Schriftstellerkarriere träumten, unter wortgewandten Verkäufern, die eine Theaterkarriere planten.
Diese unausgegorenen Spinner besoffen sich mit Bier und hofften auf ein Wunder. Keiner von ihnen strebte nach Geld und Macht. Alles, was sie wollten, war ein kreatives Leben voller Ruhm. Das galt als erstrebenswert. Schließlich begegneten sie täglich denjenigen, die es bereits geschafft hatten. Die berühmten Macher jener Zeit besuchten immer wieder die Szenekneipen: von Zwerenz bis Ernsting kamen sie alle, mischten sich unters Volk, gesellten sich auf ein, zwei Bier dazu.
Peter schrieb in seiner Freizeit einige Gedichte und Kurzgeschichten, malte Aquarelle und formte Miniskulpturen aus Ton. Er konnte sich aber nicht entscheiden, wo seine wirkliche Begabung lag, kaufte sogar eine gebrauchte Kamera und verschoß eine Unmenge Filmmaterial. Dann hatte er die Idee, ein abenteuerliches Leben mit Erfahrungen à la Hemingway könne der Schlüssel zu seiner Kreativität sein.
Mit dem letzten Gehalt und einer üppigen Abstandszahlung, die sein Nachmieter ihm für drei wertlose Möbelstücke zähneknirschend zahlte, um an die preiswerte Wohnung zu kommen, machte Peter sich vor Sonnenaufgang auf den Weg. Er trampte zum Mittelmeer, hinunter nach St. Tropez sollte es gehen. Es war Mai und von Auto zu Auto wurde es wärmer.
Nördlich von Lyon nahm ihn ein pensionierter elsässischer Lehrer mit, der nach Marseille fuhr. Es war bereits dunkel gewesen, als der Mann aus einem Landgasthof an der N 83 gestolpert kam. »Riviera«, gab Peter als Ziel an, und der Mann lud ihn zur Mitfahrt ein.
»Italienische oder französische?«
»Französische natürlich. Dem Sommer entgegen.«
Der Fahrer startete den Motor des uralten, schwarzen Peugeot und begann sogleich einen lehrerhaften Vortrag über diesen Teil der französischen Mittelmeerküste.
»Der schmale Küstenstreifen zwischen Hyères und Italien heißt heutzutage Côte d’Azur. Welch wunderschöne Welt! Wurde bereits in den Wintern des 18. Jahrhunderts von englischen Marineoffizieren entdeckt. Zur Erholung für die Mittelmeerflotte. Als Nizza im 19. Jahrhundert zu Frankreich kam, entwickelte es sich schnell zum Winterquartier der Oberklasse – es liegt nämlich klimatisch ausgesprochen günstig. Der nördliche Adel folgte bald, besonders der englische und der russische. Die Zarenfamilie baute sogar eine eigene Kathedrale in der Stadt – St. Nicolas – mit sechs Kuppeltürmen. Es entstand in der Gegend ein richtiges kleines Rußland, mit vielen Kirchen und Villen.«
Der Lehrer roch ziemlich nach Alkohol, hatte wohl zum Abendessen einen Wein zuviel genossen.
»So richtig los ging es an der Côte doch erst Anfang dieses Jahrhunderts?« fragte Peter.
Der Alte nickte, schnappte sich eine Cognac-Flasche aus dem Handschuhfach und bat Peter, sie zu öffnen. Er möge ruhig auch davon trinken. Peter entkorkte die Flasche, gönnte sich einen kräftigen Schluck und reichte sie an den Spender weiter. Der soff die noch zu einem Drittel gefüllte Flasche ohne abzusetzen leer. Peter fühlte sich nun gar nicht mehr wohl. Was wußte er denn, wieviel sein Chauffeur bereits intus hatte.
»Richtig, junger Freund. Der Hochadel folgte: Bayernkönig Ludwig, Queen Victoria, Frankreichs Kaiserin Eugenie, Belgiens Leopold und so weiter. Und weil Lord Brougham Anfang des 19. Jahrhunderts wegen der Cholera in Cannes festsaß und dort blieb, erweiterte sich die Gegend, die als ›in‹ galt, nach Westen. Der Geldadel kam hinzu: Stahlbarone, Industrielle, Fabrikanten. In der Belle Epoque Anfang letzten Jahrhunderts wurde dann der Mythos Côte d’Azur geboren.«
»Spielplatz der Reichen, Berühmten und Mächtigen«, ergänzte Peter mit glänzenden Augen.
Inzwischen raste der Alte wie ein Wahnsinniger durch die Gegend, fuhr selbst unübersichtliche Kurven auf der linken Spur.
»Der Adel mied die Côte in der heißen Jahreszeit. Unterstützt von cleveren Hoteliers stieg die Côte trotzdem bald zum Sommertreff des Jet-set auf«, dozierte der besoffene Alte weiter, fuhr Zickzack und grölte zwischendurch ein Lied.
Peter wurde der Trip zu gefährlich. »Halten Sie an, Monsieur. Lassen Sie mich raus«, bat er. Doch der Betrunkene reagierte überhaupt nicht.
»Ich muß pinkeln, Mann! Merde, Sie haben zuviel Alkohol drin! Stoppen Sie endlich!«
Als auch das nicht half, griff Peter ins Lenkrad, versuchte den Wagen langsam nach rechts zu ziehen. Der Kerl kapierte es endlich, sein Beifahrer wollte raus. Also trat er voll auf die Bremse und hielt auf dem rechten Grasstreifen an. Beck zog seinen Rucksack vom Rücksitz, sprang hastig hinaus und knallte die Tür zu.
Da stand er nun, irgendwo in Südfrankreich. Es ging auf Mitternacht zu und es schien aussichtslos, einen weiteren Wagen anzuhalten. Hauptsache, dem stark alkoholisierten Fahrer entkommen, dachte er. Ein Stück von der Fahrbahn entfernt, unter schützenden Büschen, löste er seinen Schlafsack aus den Lederriemen, breitete ihn aus und kroch hinein. Den Rucksack benutzte er als Kopfkissen, summte leise seine heimliche Hymne »Find your place in the sun … « und schlief bald ein. Das war kurz vor Marseille.
Die Jahre, die er inzwischen als Angestellter hinter sich gebracht hatte, ermöglichten ihm einen langen Sommer ohne Arbeit – einfach Abhängen am Mittelmeer. Die monotone Achtstundenscheiße, die ihm das Leben vermiest hatte, war vorbei. Jetzt kam das Abenteuer. Und was danach kommen sollte – er wußte es nicht, hatte allenfalls ein vages, versponnenes Lebensziel, eine Mischung aus Paradiesfindung und romantischer Selbstverwirklichung. Es war ihm klar, daß er im Herbst sehr schnell zur Wirklichkeit zurückfinden würde. Zur erneuten Achtstundenfron. Aber er träumte trotzdem davon, vielleicht bis Ende des Jahres den Traumjob zu finden, der genug Geld für sein fernes, noch verschwommenes Lebensziel einbringen würde. Obwohl die Chance sehr gering war – ohne Abitur, mit zwei hingeschmissenen guten Arbeitsstellen.
Wer nicht zielstrebig, mit klug aufgebautem Fundament plant, dessen Möglichkeiten sind begrenzt. Da gibt es kaum Chancen, an die Sonne zu kommen. Aber das ahnte Peter Beck nicht.
Am nächsten Morgen trampte er weiter in Richtung Côte d’Azur. Er war noch nie dort gewesen, träumte allerdings seit Jahren von diesem Spielplatz der Reichen, von diesem göttlichen Verbund von blauem Himmel, Meer und Lebenslust. Er las seit Jahren gierig Bücher und Zeitschriftenartikel über seine Traumküste.
Und die Wirklichkeit haute ihn prompt um. In Hyères stand er ehrfürchtig vor einer Palme, der ersten seines Lebens. Die Palme – sein persönliches Symbol für südliche Zauberwelten!
Beglückt fuhr er mit der Hand über ihren rauhen Stamm, schaute hoch in die Wedel und bemerkte nicht, daß im gleichen Moment ein kleiner verdreckter Straßenköter an ihren Stamm pinkelte.
Peter hielt sich nicht lange in Hyères auf, St. Tropez war sein Tagesziel. An der Ortsausfahrt wartete er nun, mit dem Daumen nach oben, auf eine Mitfahrgelegenheit. Ein vergammeltes, blaues VW-Cabrio aus Frankfurt näherte sich. Als Peter merkte, daß der Fahrer nicht halten wollte, brüllte er los: »Ich bin Frankfurter. Halt, ich bin Frankfurter!«
Im Wagen saß ein müder Mitdreißiger mit schulterlangen, fettigen Haaren. Er hatte offensichtlich keinerlei Interesse, irgendwelche fremden Tramper zu chauffieren. Als er jedoch »Frankfurt« hörte, reagierte er schnell. Ein bißchen deutsche Konversation könnte vielleicht interessant sein und ihn außerdem wachhalten. Schließlich war er schon den ganzen Tag alleine und gelangweilt durch Südfrankreich gezuckelt. Also hielt er an.
»Wo willst du hin?« rief er.
»Nach St. Tropez«, antwortete Peter, der dem Wagen nachgelaufen war.
Der Fahrer öffnete einladend die Beifahrertür. Sonst nahm er nie Tramper mit, wollte keine Scherereien riskieren. Deshalb schaute er sich diesen hier aufmerksam an und kam zu dem Schluß, daß er einen ordentlichen Eindruck machte. Freundlich hielt er Peter die rechte Hand hin.
»Robert Schulz-Gris. Für meine Freunde Robby. Wie lange willst du am Mittelmeer rummachen?«
»Bis ans Ende meiner Tage, hoffentlich. – Angenehm, dich kennenzulernen. Ich heiße Peter Beck. Vorgestern wohnte ich noch in Sachsenhausen.«
»Dein erstes Mal an der Côte?«
Peter nickte mit erwartungsvollem Gesicht.
»Wie lange bleibst du, ganzjährig? Im Winter ist es lausig hier, ziemlich kalt und alles ausgestorben. An der Côte ist es dann nur in den Städten angenehm. In Cannes, Nizza, und wenn du die große Kohle hast, in Monaco.«
»Hab ich nicht.«
Beide lachten.
»Ich persönlich liebe Nizza. Habe meinen letzten Saisonjob in St. Moritz geschmissen und einen Sommerjob für sechs Monate in einem deutschen Erholungsheim angenommen. Hoch oben in den Bergen über Juan-les-Pins. Nicht weit entfernt von Picassos ehemaligem Atelier. Arbeite als Halbtagskraft im Büro. Meine Mutter ist Französin, deshalb bin ich perfekt zweisprachig. Hab da freies Wohnen und Essen, gutes Cash auf die Hand und schon mittags Feierabend. Mach die zweite Saison da rum. Fühl mich wie ein Prinz, lieg schon nachmittags am Privatstrand zwischen lauter Millionären, Filmstars und Models. Direkt vor dem weltberühmten Negresco. Hab meine eigene Liege, weil Franky, der deutsche Beachmanager, ein alter Kumpel von mir ist. Geh ihm täglich für ‘n bißchen Cash zur Hand. Und neben mir liegt dann die weltberühmte Anita Eckberg mit bloßen Riesentitten«, gab Schulz-Gris an.
Peter war fasziniert, jemanden mit Südfrankreicherfahrung kennenzulernen. Einen Insider, mit der Hand am Puls des Geschehens und echten Kontakten zur Glamourwelt.
»Ich mach aus Geldgründen auf Camping. Das kann man nicht in ‘ner Großstadt wie Nizza«, antwortete er betont bescheiden. »Haste ‘n Autogramm bekommen?«
»Von wem?«
»Na, von der scharfen Anita.«
Schulz-Gris schüttelte angewidert von soviel Spießigkelt den Kopf. Fast verächtlich belehrte er seinen Beifahrer: »Mensch, hast überhaupt kein Gefühl für Stil. Wie’s bei denen da oben läuft und so. Willste im Jet-set akzeptiert werden, einer von denen sein, mußte auf cool machen. Auf interessant und selber Autogramme geben.«
»Wie das, Mann?«
»Na, für die bin ich ein bekannter deutscher Nachwuchsmaler. Geb meine eigene Vorstellung, tu so, als wär ich regional in Hessen bereits eine Berühmtheit. Seit letztem Jahr male ich in Öl. Hab acht fertige Bilder dabei und meinen gesamten Arbeitskram – Staffelei, Leinwand, Pinsel, Farbe. Hoffe, in diesem Sommer gut zu verkaufen. Ende der letzten Saison habe ich ein paar Leute vom Heim überredet, zum Strand zu kommen, mich zu belagern und nach Autogrammen zu verlangen. Das war echt scharf! Ich habe vier Leuten mein Künstlerportrait signiert. Die Stammgäste haben vielleicht Augen gemacht! Hab ‘n Topimage am Beach. – Die Menschheit will verarscht werden. Merk dir das, Kumpel. Das ist ein kostenloser Rat für deine zukünftige Lebensbewältigung«, philosophierte Schulz Gris und reichte Peter sein Künstlerportrait aus dem Handschuhfach, ein mehrfach gefaltetes Blatt, weißes Papier mit schwarzem Aufdruck. »NEW ARTWAYS of painter Robby Schulz-Gris.« Unter dieser Überschrift prangte ein Foto von Robby, der nackt unter der Dusche stand und sich ein kopfloses, bluttropfendes Huhn vor den Unterleib hielt.
Peter guckte reichlich irritiert. Aha, moderne Kunst? Irgendwie interessant, aber … Da er keine Erfahrung mit diesem Bereich der Kunst hatte, ließ er sich sicherheitshalber nicht zu einem Kommentar hinreißen.
»Hieß deine Mutter Gris?« fragte er statt dessen.
»Nein. Gris war ein berühmter Pariser Maler Anfang des Jahrhunderts, ein Kubist. Er ist mein Vorbild. Ich male unter dem Doppelnamen Schulz-Gris, das ist mein Künstlername. Compris?«
Der Künstler steuerte den Wagen bereits den Berg hinunter nach La Croix-Valmer, dem Urlaubsort, der an einem alten Pfad aus der Antike liegt, den schon Griechen, Kelten und Römer als Verbindung zwischen Italien und Frankreich benutzt haben sollen.
»Was für ‘n Stil malst du denn?« fragte Beck mutiger.
»Reformierten Kubismus! Noch abstrakter, alles im Höllen- und Dämonenbereich. Die Welt wird mich später ›Höllenkubist‹ nennen.«
Toll«, sagte Beck und sonst nichts, weil er keine Scheiße reden wollte. Er hatte absolut keine Ahnung.
»Unten an der Kreuzung laß ich dich raus. Das ist die Abzweigung direkt nach St. Tropez. Kannst sogar den Omnibus nehmen.«
Peter stieg aus, bedankte sich und rief dem abfahrenden Schulz-Gris zu: »Viel Erfolg und auf Wiedersehen! Wenn ich mal in Nizza bin, sag ich dir Hallo!«
Im Club Voltaire in Frankfurt hatte er mal von einem wilden Hippielager gehört, das westlich von St. Tropez am Strand von Pampelonne liegen sollte. Ein letzter Wagen brachte ihn in die Nähe, und den Rest des Weges ging er zu Fuß.
Es war bereits dunkel, deshalb sah er schon von weitem das Lagerfeuer neben dem bekannten Strandrestaurant Chez Louis. Rund zwanzig junge Leute, zwei Drittel davon männlich, saßen nackt, in Badehosen oder arabisch wirkenden Fantasieklamotten rund um die auflodernden Flammen. Viele quatschten, jemand jazzte auf einer Mundharmonika. Eine gigantische Korbflasche voller Rotwein, die bestimmt zwanzig Liter faßte, wurde herumgereicht.
Peter war sprachlos. Das wilde, freie Leben am Mittelmeer – es existierte tatsächlich. Und er hatte es gefunden.
Er rollte seinen Schlafsack aus, kramte eine Dose Ölsardinen aus seinem Rucksack hervor und verschlang hungrig sein karges Abendessen. Dann machte er es sich gemütlich, mit dem Rucksack als Rückenlehne lagerte er in dem weißen Sand und ließ die Szene in aller Ruhe auf sich wirken. Neben ihm lümmelte ein heruntergekommen wirkender Deutscher im Lumpenlook, der ihm seinen Joint gab.
»Willkommen, Wanderer, Erleuchteter! Willkommen bei der Fête Latine!« Der Mann plärrte ziemlich laut und musterte eingehend den spießig wirkenden, normal gekleideten Ankömmling.
Peter übernahm dankend den Joint, tat einen vorsichtigen Zug und gab ihn zurück. Daß sein Nachbar ein Spinner zu sein schien, verzieh er ihm wegen der freundlichen Begrüßung auf der Stelle.
»Peter Beck aus Frankfurt«, stellte er sich etwas förmlich vor und reichte dem Spinner die Hand.
»Dirk Baumann, Kassel. Ex-Soziologiestudent, jetzt Maler. Auf dem großen Trip. Mein Ziel ist das Ende des Universums.« Dirk lächelte entrückt, inhalierte tief und gab den Joint weiter.
Jemand reichte Peter die große Weinflasche. Zuerst schlürfte er den Ölrest aus der Sardinendose, dann packte er mit beiden Händen die Griffe der schweren Korbflasche und hob sie vorsichtig an seinen Mund. Als er die halbvolle Flasche kippte um zu trinken, schwappte der dunkelrote Wein heraus und lief ihm an Kinn und Oberkörper herunter. Peter starrte so ungläubig auf sein verfärbtes Hemd, daß alle um ihn herum auflachten. Also hob er die Flasche erneut an den Mund, schluckte und schluckte und schluckte. Er störte sich nicht mehr daran, daß ihm die rote Brühe vom Kinn auf die Brust tropfte und seine Klamotten einfärbte.
Er reichte die Flasche an Baumann weiter, zog seine Hose aus und rannte in Hemd und Unterhose ins Meer hinein – in der Hoffnung, die Rotweinflecken so aus dem Hemd herauswaschen zu können.
Das Meer war noch eiskalt im Mai. Das heiße Frühlingswetter und das wärmende Feuer hatten dem überraschten Peter den Sommer nur vorgegaukelt. Das Bad erfrischte ihn trotzdem, spülte Schweiß und Reisestaub ab.
Zitternd zog er sich trockene Klamotten an. Er baute sein vergammeltes Einmannzelt auf einer kleinen Anhöhe auf, breitete die nasse Wäsche auf dem Dach zum Trocknen aus, schmiß den Rucksack ins Zelt hinein und kehrte zum Feuer zurück. Er staunte über die vielen Sprachen, die er hier zu hören bekam. Englisch dominierte allerdings. Jemand klimperte auf einer Gitarre und sang dazu: »… going to San Francisco … wear some flowers in your hair … «
Nach einer Weile riefen ein paar der Jungs im Chor: »Sasha leg los, fang endlich an!«
Ein einbeiniger Kerl, der wie ein Araber aussah, stand auf und humpelte Richtung Feuer. Er verbeugte sich lächelnd mit einer unterwürfigen Geste und verlas im Schein der Flammen in fehlerhaftem Englisch einen Begrüßungstext.
Peter hörte interessiert zu, auch wenn es nicht ganz einfach war, Sasha zu verstehen. An der Côte hatte sich demnach schon in den Sommern der 20er Jahre eine Gruppe von Bohemiens um bekannte Künstler wie den Bildhauer Tuby und seinen berühmten Freund, den Freidenker Wyngaard, geschart. Um das freie, wahre Leben in der Natur und die schönen Künste zu feiern. Das Motto hieß: Befreit euch von der Belastung durch Geld, Macht und Ruhm. Nur dieser Verzicht garantiert euch das erfüllte, echte Zelebrieren, das ewige Ausleben der Fête Latine. Nur so werdet ihr glücklich, kreativer …
»Wir setzen ihre in den Kriegsjahren vergessenen Ideen heute fort, praktizieren ihre Ideale. Laßt uns das Leben feiern«, schloß Sasha und alle klatschten. Einige Typen lagen nackt am Feuer, sogar Mädchen. Peter genoß die Szenerie, genauso hatte er sich in seinen kühnsten Träumen den Totalausstieg am Mittelmeer vorgestellt.
Als Peter am nächsten Morgen erwachte, kochten nebenan zwei junge, hübsche Kanadierinnen auf einem Campingkocher Kaffee. Er schaute gierig hinüber, und sie schenkten ihm einen Becher Kaffee ein. Ein Stück Weißbrot bekam er auch dazu.
Er hatte in seinem Rausch aus Alkohol und Glücksgefühl hervorragend geschlafen. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, die heranrollenden Wellenberge waren von weißen Schaumkronen geschmückt und die Luft roch nach Salz und Seetang. Vom abgebrannten Lagerfeuer stieg ein dünnes Rauchfähnchen in den Himmel. Höchstens zehn Leute waren noch da.
»Everybody went to town«, sagte eine der Kanadierinnen. Beim Frühstück erzählten ihm die beiden Mädchen begeistert vom malerischen Hafen und den gigantischen Privatyachten.
Peter duschte blitzschnell in der Süßwasserdusche der nahegelegenen Beachbar, packte seinen Rucksack und marschierte erwartungsvoll Richtung Stadt. Der Fahrer eines Butangastransporters nahm ihn ein Stück mit und ließ ihn Minuten später direkt am Rathaus aussteigen.
Da stand er nun, auf dem großen, ungepflasterten Platz unter den gerade ergrünten Platanen. Er blickte umher und konnte sich gar nicht satt sehen an der fremden Stadt. Typisch südländische Häuser mit Holzläden und alten, vom hellen Ocker bis fast zum Schwarzbraun reichenden Ziegeldächern. Der achteckige, aus wuchtigen Felssteinen gemauerte Glockenturm der mittelalterlichen Altstadtkirche und der dahinter aufragende Zitadellenberg überragten die Häuser. Die grauen Festungsmauern der Zitadelle schimmerten durch das junge Frühlingsgrün der Bäume. Kurzgestutzte Platanen beschatteten den Platz. Ältere Männer und nur wenige Frauen warfen ihre Boulekugeln. Überlautes Geknatter der vielen Mofas hing in der Luft, das Lärmen von Flipper- und Musikautomaten drang aus vollbesetzten Straßencafés. Das Geräusch von zahllosen Stimmen schuf den brummenden, summenden Hintergrund.
Peter reihte sich erwartungsvoll in den größten der langsam abfließenden Touristenströme ein und ließ sich in das Gassengewirr der Altstadt hineinziehen. Überall lauerten Touristenfallen: Boutiquen, Andenkenläden, Hotdog- und Sandwichstände, Antikläden sowie Kitsch- und Kunstgalerien. Und natürlich die vielen Restaurants mit verlockenden Essensdüften – und schmerzhaft hohen Preisen.
Plötzlich entließ ihn die mit drängelnden Menschen gefüllte enge Gasse in den offenen, turbulenten Hafenbereich. Er stand direkt vor dem Café Gorilla. Die riesigen Luxusyachten verschlugen ihm die Sprache. Einen solchen zur Schau gestellten Reichtum hatte er nie zuvor gesehen.
Peter war völlig hingerissen. Diese Klotzerei faszinierte ihn – er, der Schlichtmensch aus der Kleinbürgerfamilie, erfuhr zum ersten Mal, was mit dem Duft der großen weiten Welt gemeint war. Er kannte ihn sonst nur aus dem Werbefernsehen. Unglaublich, was mit viel Geld alles möglich war!
In seiner staunenden Naivität fiel Peter auf die protzigen Großabkocher herein. Berauscht stolperte er von Yacht zu Yacht und glotzte gierig auf das operettenhafte Getue auf den Achterdecks. Gigantische Blumenbuketts, Champagnergelage, Freßorgien mit dem Feinsten, Lakaienservice – eigentlich nur eine aufdringliche Selbstdarstellung der schlimmsten Sorte. Aber das ahnte Peter nicht.
Er wußte nicht, zu welchem Rummelplatz das einst so hübsche, beschauliche Fischerdorf verkommen war. Es wurde wachgeküßt von den Malern der Jahrhundertwende – Matisse, Monet, Seurat, Signac – und Dichtern wie Maupassant, die seinem Charme erlagen. In den 40er Jahren folgten weitere Maler – Chagall und Leger – und Literaten wie Cocteau, die ihren unersättlichen Lebenshunger hier stillten. Regelrecht vergewaltigt wurde der Ort in den 60ern von Filmstars und Jet-settern: Juliette Greco, Brigitte Bardot, Curd Jürgens, Jean Marais, Gunter Sachs oder Billy Hallyday. Denn im Schlepptau ihrer legendären Auftritte und Selbstdarstellungen folgten Millionen von Touristen.
Peter erinnerte sich an Mick Jaggers Hochzeitsfoto. Das hatte er in der Zeitung gesehen, vier Jahre zuvor. Jagger stand mit seiner Braut Bianca vor dem weltberühmten Hafencafé Senequier.
War es das, was Peter in diesem Leben erreichen, auskosten wollte? Jedenfalls war er richtig gut drauf und summte ein Lied von Chevalier, »Sweeping the clouds away«.
Ein nagendes Hungergefühl brachte ihn irgendwann in die Wirklichkeit zurück. An der Ecke der Papagayo-Bar bemerkte er plötzlich Dirk Baumann, den Hippie aus Kassel. Er saß auf einem umgestülpten Plastikeimer vor einer kleinen Staffelei. Zeichnete mit gekonnten Strichen das Portrait eines fröhlichen kleinen Mädchens, das vor ihm auf einem Klappstuhl saß. Baumann war fast fertig, die Mutter des Blondköpfchens schien begeistert. Er signierte das Bild und präsentierte es den neugierigen Umstehenden mit einem stolzen »Voilà!«. Zufrieden zählte die Mutter der Kleinen ihm fünfzehn Franc in die geöffnte Hand.
»Hab heute schon drei Portraits verkauft. Der Rubel rollt. Jetzt mach ich Pause und hol mir was zum Fressen. Kommste mit?«
Beck war überwältigt von soviel Lässigkeit, konnte nur nicken. Staunend preßte er seine Lippen zusammen. Diese Mittelmeerbohemiens waren tatsächlich pfiffige Überlebenskünstler.
»In den Restaurants wirste nur beschissen. Die nehmen, obwohl sie sehr gutes Essen kochen, unkritische Touristen aus. Der clevere Hobo geht also dahin, wo ‘ne Abkoche wie St. Tropez den guten Einkauf bietet – ins Monoprix. Das ist das französische Gegenstück zur deutschen Kaufhalle«, dozierte Baumann, füllte seine übergroße, perlenbestickte Tasche mit Malutensilien, Zeichenblock und der komplett zusammengeklappten Patentstaffelei. Eimer und Stuhl kettete er an ein abgestelltes Fahrrad.
Sie schlenderten zum großen Parkplatz am diesseitigen Hafenende und tauchten von dort in die Altstadt ein. Durch eine enge Wohngasse, die von Hunden recht beachtlich vollgeschissen war, erreichten sie Minuten später die Hauptstraße mit dem Lebensmittelmarkt.
»Mit meinen Portraits komme ich finanziell gut über die Runden. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. In diesem Frühjahr ist es Klasse! Bei Regen läuft allerdings überhaupt nichts, dann mußte eisern mit der Kohle kalkulieren. Das heißt, preiswertes, vom Staat subventioniertes Brot kaufen oder auch Milch. Und Sachen essen, die länger sättigen, also gekochte Eier, Ölsardinen, Schabefett oder Hülsenfrüchte aus Dosen. Brauchst die Kohle schließlich fürs süße Leben – Weiber, Saufen, Zigaretten, Hasch und natürlich fürs Überwintern.«
Beck stimmte nickend zu.
»Wie willste finanziell über den Sommer kommen?«
»Hab noch ein paar Mark. Vielleicht kreide ich ab morgen auf dem Trottoir.«
»Das bringt in diesem Touristengewimmel immer schnelle Knete ein. Allerdings kommen dauernd die Bullen und jagen dich weg. Manchmal kassieren sie dich auch für ein paar Stunden ein. Chauffieren dich mit der grünen Minna, die hier blau ist, auf die Wache. Die wollen dich nur ‘n bißchen schocken. Lassen dich am Abend wieder frei. Trotzdem, mit dem Kreiden machste gute Kohle.«
Im Monoprix kauften sie ein noch warmes Baguette, Camembert, Butter und eine Flasche Mineralwasser. Damit bummelten sie langsam zum Hafenbecken zurück und setzten sich auf einen der niedrigen Elektrokästen der Mole. Baumann bastelte mit Hilfe seines Taschenmessers für jeden ein Sandwich, dazu tranken sie das Wasser. Entspannt unterhielten sie sich über die Côte und schmatzten genußvoll das Brot.
»Nach dem Essen lad ich dich zu ‘nem Café Noir ein. Ins Gorilla. Da verkehrte früher der Hollywoodstar Errol Flynn, wenn seine Segelyacht im Hafen ankerte. Der Mensch muß sich auch mal was gönnen«, meinte Dirk.
Ein paar Minuten später machten sie es sich in den blauen Segeltuchklappstühlen des berühmten Hafencafés bequem und beobachteten das Schauspiel auf der Straße. Es war eine Dauerzirkusvorstellung von zahllosen Selbstdarstellern. Die schönsten Frauen der Welt flanierten in sehr knappen Klamotten vorbei. Ein Cabrio, Rolls Royce natürlich, fuhr vor eine der Superyachten und holte einen kräftigen Mann ab. Mit seinem Panamahut und der dicken Goldkette wirkte er irgendwie britisch. Fotografen rannten sofort auf die Mole, ein Blitzlichtgewitter folgte. Jemand rief: »Da ist er … Richard Burton ist da!« Die Menge teilte sich und der Rolls brauste davon.
Ein dürrer, glatzköpfiger Feuerschlucker rotzte brennenden Spiritus in die Luft. Straßenmusikanten spielten an jeder Ecke, lösten sich gegenseitig ab. Von Gitarre spielenden Folkloresängern bis zu geigenden Musikstudenten reichte das Angebot.
Peter und Dirk hielten sich fast eine Stunde lang an ihrem teuren Café Noir fest. So schnell wollten sie ihren Beobachtungsposten nicht räumen.
»Das ist das Leben, wie ich es mir erträumt habe«, seufzte Peter.
Baumann knuffte ihn zustimmend in die Rippen. »Logo! Die Scheißspießer in Deutschland haben doch keinen Schimmer, was sie in diesem Leben verpassen. Der Verzicht auf die Scheißkohle, auf Karriere und sonst was, das zahlt dir die ewige Fête Latine doppelt und dreifach zurück. Du hast wenig Arbeit, aber viel Spaß an den schönen Künsten. Gras und Wein sind fast umsonst, dazu ein fröhliches Umfeld. Sieh dir all die Leute um uns herum an. Urlaubsspaß. Jeder ist gut drauf, genießt den blauen Himmel, den ewigen Sonnenschein und das knisternde Côte-Ambiente. Das steckt an. Und abends unsere heiße Strandparty, die jede Menge Weiber anlockt. Für dich und für mich. Jede Menge Frischfleisch zum Bumsen. Hahaha!«
Sie trennten sich bald, weil Baumann noch ein paar Stunden Kohle machen wollte. Peter zog allein weiter, ließ sich treiben und die Umgebung auf sich wirken. Später holte er seinen neuen Freund wieder ab. Zusammen fuhren sie mit Dirks Fahrrad – Peter hockte auf der Fahrradstange – zum Pampelonne-Strand. Unterwegs hielten sie beim Monoprix, kauften zwei Koteletts und Kartoffeln.
»Die grillen wir nachher im Lagerfeuer«, schlug Baumann vor.
Die nächste Nacht wurde zu einem tollen Fest. Nachdem Peter dieses Mal den Weinkonsum besser meisterte, hievte er anschließend die Flasche zu einer der beiden Kanadierinnen rüber. Die blonde Penny – die ruhigere der beiden – stieg schnell zu seiner Traumfrau auf. Er begann, sie systematisch anzubaggern.
»Take the basket handles with both hands. Ich halte die Flasche von unten«, half er eifrig.
Sie schaffte es, ohne einen Tropfen zu verschütten.
»Warum kauft ihr keine normalen Flaschen? Die große Korbflasche ist so unhandlich.« Penny war von dem gutaussehenden Mann gefangen. Sie fand Peter sehr interessant.
Allerdings beantwortete nicht Peter, sondern Dirk ihre Frage.
»Das sind Pfandflaschen von der Cavalaire-Weinkoop für Großverbraucher. Guter Tafelwein zum extremen Niedrigpreis. In den Riesenflaschen ist er am billigsten. Wir Männer wechseln uns mit dem Kauf ab.« Er guckte kurz zu Peter. »Du solltest übermorgen die nächste kaufen.«
»Wie krieg ich sie hierher?«
»Ich leih dir mein Fahrrad. Da bist du im Nu dort. Bloß der Rückweg ist gemein. Du mußt die Henkel der Flasche an die Querstange binden und das Rad schieben. Dauert fast ‘ne Dreiviertelstunde zurück. Meist bergauf.«
»Okay. Wieviel Leute machen mit?«
»Zur Zeit zehn. Jeder von uns muß circa zweimal im Monat hin. Du wirst es überleben.«
Im Hintergrund spielte Sasha Ragtime auf der Mundharmonika und ließ dabei seine Augen wild in ihren Höhlen rollen.
Die beiden Studentinnen blätterten in Pennys Skizzenblock herum. Er enthielt sehr gekonnte Stadtszenen von St. Tropez und dem Leben am Strand. Sie diskutierten, kritisierten die Qualität der einzelnen Blätter. Peter verstand das nicht, für ihn schienen sie alle von einmaliger Schönheit zu sein. Handwerklich astrein. Druckreife Meisterwerke. Penny war eine begnadete Künstlerin. Mit ihrer Freundin trampte sie bis zum Semesterbeginn im August durch das südliche Europa.
Penny saß da in einem knappen, grellbunten Bikini. Peter verschlang sie fast mit seinen Blicken. Kurz vor Mitternacht, als sie bereits ziemlich betrunken waren, ließ sie sich von ihm küssen. Er schwebte auf einer gewaltigen rosaroten Wolke, war verknallt wie nie zuvor in seinem Leben.
Obwohl sie nahe beim Feuer saßen, spürten sie plötzlich, daß ein kalter stürmischer Wind aufkam. Bald begann es zu regnen, und er machte ihr den Vorschlag, mit in sein Zelt zu kriechen.
»Leider nur ein Einmannzelt«, rief er ihrer Freundin zu, die Schutz unter dem Vordach der nächsten Beachbar suchte. Sie lachte zu ihnen herüber, drohte mit dem Zeigefinger. »I’ll watch you guys!«
Im Zelt kroch Penny sofort in ihren Schlafsack. Rein gar nichts spielte sich ab. Sie ließ sich nur küssen und ein bißchen befummeln.
»Mich ficken ist nicht drin, Darling. Ich bin streng katholisch erzogen«, flüsterte sie Peter ins Ohr.
Beim Frühstück konnte er seine Augen nicht von Penny lassen, gaffte ständig auf ihren zarten Erdbeermund, die Stupsnase, die kleinen, hochstehenden Brustwarzen unter ihrem T-Shirt, den runden Apfelpo. Gerne hätte er ihre leuchtenden Augen geküßt.
Nebenbei erzählte er den Mädchen vom Kreiden. Penny fand die Idee gut und wollte sofort mitmachen. Ihre Freundin schüttelte amüsiert den Kopf. Sie blieb am Strand, weil sie etwas für die Uni lesen wollte – sie studierte englische Literatur.
So machte sich Peter mit seiner neuen Flamme auf den Weg. Sie trampten in das Städtchen hinein und kauften sich im Mono eine Schachtel mit bunter Kreide und eine große Flasche Orangina.
Am Bouleplatz setzten sie sich zunächst auf eine alte, schmiedeeiserne Bank und diskutierten das Kreidemotiv. Penny schlug vor, als Grundform ein großes Herz zu malen. – War das vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl? Peter wurde es heiß. In seinem Überschwang sah er die nackte Penny vor sich, und ihm wurde noch heißer. Um sich ein bißchen zu beruhigen, konzentrierte er sich mühsam auf das Thema Kreiden.
»Wir teilen das Herz in zwei Hälften. Links malst du eure Flagge mit einem kanadischen Motiv, und ich rechts eine deutsche Flagge mit einem Bild meines Landes.«
Penny fand die Idee toll. Händchenhaltend suchten sie sich eine Straßenstelle in der Nähe des gewinnversprechenden Touristenstroms. Neben dem Nachtclub Papagayo wurden sie fündig. Hier störten sie auch nicht das Geschäft, das erst am Abend begann.
Peter zeichnete mit weißer Kreide die Umrisse eines drei Meter breiten Herzens mit einer Trennlinie in der Mitte. Er war sehr ordentlich, kniete mit dem rechten Bein auf einem dreifach gefalteten Taschentuch. Penny setzte sich einfach hin.
Sie malten zuerst ihre Flaggen, die rot-weiße mit dem Ahornblatt und die schwarz-rot-goldene. Dann kam er auf die Idee, unter dem Herzen in drei Sprachen: »Danke – Thank you – Merci« zu schreiben und ein paar Münzen hinzulegen. Und siehe da, nach wenigen Minuten warf jemand einen richtigen silbernen Franc.
»Merci!« riefen beide erfreut und grinsten sich an.
Peter empfand die Kreiderei als unangenehm, schien sie ihm doch so etwas wie Bettelei. Er war froh, daß Penny so ungezwungen mitmachte. Sie malte sehr gekonnt einen Wasserfall, aus dem ein goldfarbener großer Lachs gezogen wurde. Von einem angelnden, kanadischen Mounty in roter Polizeijacke. Peter hingegen versuchte sich an einem bayrischen Lederhosenträger, der ein gigantisches, schäumendes Maß Bier in der Hand hielt. Trotz aller Mühe, kriegte er die Figur nicht hin. Das war ihm peinlich, denn immer mehr Leute blieben stehen und warfen Geld. Penny schaute sich seine dilettantische Malerei an und lächelte.
»Mal den Himmel auf meiner Hälfte weiter, hier, nimm dieses Blau«, sagte sie und schob ihn sanft nach links.
Mit ein paar markanten Strichen korrigierte sie Peters Bild. Es sah nun richtig gut aus.
Er schätzte die Geldmenge ab und steckte ungefähr dreißig Franc weg, zehn Franc ließ er auf dem Bild liegen. Die Kreiderei hatte in den ersten zwei Stunden über vierzig Franc gebracht. Unglaublich!
Er griff nach der roten Kreide und schrieb das Wort »love« über das Herz. Penny grinste und gab ihm einen Kuß auf die Wange. Ein paar Zuschauer klatschten Beifall und warfen Münzen.
Inzwischen war es sehr heiß geworden und die Malerei hatte beide geschafft. Die Uhr auf dem Kirchturm zeigte zwei Uhr an. Er zählte wieder das Geld – über hundert neue Franc.
»Machen wir Schluß«, sagte er schwitzend, griff nach Pennys Hand und zog sie hoch. Sie taumelte, denn stundenlanges Arbeiten auf dem Boden war sie nicht gewöhnt.
»Ohne deine Malkunst hätte ich noch Geld dazuwerfen müssen«, lobte er sie.
Sie freute sich und drückte sich an ihn.
»Was machen wir mit unserem hart erarbeiteten Geld?« fragte er.
»Ich wünsche mir ein richtig gutes, französisches Essen.«
Sie packten ihre Utensilien zusammen und spazierten weg vom Touristenrummel, hinein in eine Seitengasse, die auf einen Platz führte, der als Parkplatz benutzt wurde. Sie studierten die Speisekarten der etwas abgelegenen, preiswerteren Restaurants und entschieden sich nach längerer Suche für ein kleines Lokal in einem Keller an der Gendarmeriestation. Das einfachste Essen kostete zwanzig Franc und bestand aus Pot au Feu, Gemüsesuppe mit Rindfleisch, und Pudding und dazu eine Karaffe Wein. Begeistert gaben sie ihre Bestellung auf, denn das Essen ihrer Tischnachbarn sah sehr appetitlich aus und duftete entsprechend gut.
Ausgehungert stürzten sie sich auf die dampfenden Teller, prosteten sich verliebt zu und genossen in vollen Zügen das erste richtige Mittagessen nach langer Zeit.
Durch ein kleines Fenster konnten sie den Platz beobachten. Dort spielte sich das Leben einer typisch französischen Kleinstadt ab. Mütter holten ihre Kinder von der Schule ab, Uniformierte gingen auf der Polizeistation ein und aus, Touristen erfrischten sich am großen Brunnen, alte Damen führten kleine Hunde an der Leine spazieren. Männer und Frauen jeden Alters trugen lange Baguettes nach Hause. Junge Leute aßen im Gehen dampfende Pizzaecken. Ein Pärchen knutschte verwegen in einem Hauseingang. Wohlhabende Mitglieder der Jeunesse dorée fuhren langsam mit ihren teuren Sportwagen die Straße entlang. Dazu die vielen Palmen, das heiße Sommerwetter und die Aussicht in die bunte, belebte Hafenöffnung am Ende des Platzes.
»Das ist mein tollster Urlaub bisher – und mein erster ohne Eltern. Hoffentlich endet er nie«, schwärmte Penny und legte ihre Hand in die seine.
Vanna, Pennys Freundin, wurde von einem holländischen Beachboy zu einer Autofahrt nach Le Lavandou eingeladen. Er hieß Harry und besaß eine schrottreife Ente ohne Schiebedach.
»Irgendein Arsch hat mir vor zwei Wochen das Ding geklaut. Ist bei dem Schrotti zwar egal. Aber wenn’s während der Fahrt regnet und das Wasser dir am Leib entlangläuft, ist das einfach grauenhaft«, schimpfte er verärgert.
Harry und Vanna nahmen Penny und Peter auf ihrer Spazierfahrt mit. Es dämmerte bereits, als sie aufbrachen. Sie tuckerten am Meer entlang nach Cavalaire-sur-Mer, das sie nach wenigen Minuten erreichten. Vor dem Ortseingang entdeckte Peter das bunte, verrottete Werbeschild der Weinkooperative. Er bat Harry, langsamer zu fahren. Auch zu später Stunde wurde da noch fleißig gearbeitet. Zwei offene Uraltlaster wurden hinter einem stacheldrahtgesicherten Dreimeterzaun mit Wein beladen.
»Warum arbeiten die so spät?«
»Vielleicht wollen sie morgen ganz früh losfahren. Es ist bestimmt nicht gut für den Wein, wenn er den halben Tag dieser Hitze ausgesetzt wird«, vermutete Harry.
Auf der Straße, direkt vor dem Zaun, stand eine typische Mittelmeerpinie. Sie war leicht nach Osten geneigt, mit dem Wind sozusagen, und zwei ihrer starken Äste ragten über die Laster.
Die vier Urlauber erreichten nach einer halsbrecherischen Fahrt die abendliche Fischerstadt Le Lavandou. Dort wurde gerade das Fest zu Ehren von St. Pierre gefeiert. Sämtliche Terrassen von Bars und Restaurants waren knallvoll besetzt. Die vier wanderten durch die Backsteingassen und kehrten in verschiedenen Bars auf ein, zwei Gläser Rotwein ein. Auf der Mauer zum Strand hockten ein paar langhaarige Amerikaner mit Gitarren. Sie spielten und sangen bekannte Folksongs. Peter und seine Freunde setzten sich dazu und sangen mit.
Am nächsten Abend lieh Peter sich Baumanns Fahrrad aus und griff sich an der angrenzenden Beachbar heimlich ein fast zwanzig Meter langes Seil ab, mit dem der befestigte Parkplatz abgegrenzt war. An das Seil knotete er ein fingerlanges, dickes Stöckchen.
»Die Weinkoop hat schon Feierabend«, merkte Baumann stirnrunzelnd an.
»Nicht für mich«, prahlte Peter. Fröhlich pfeifend trat er in die Pedale, fuhr zunächst die Küstenstraße hoch und rollte später gemütlich zum Ort hinunter. Er erreichte schnell die Kooperative, die dank des wolkenlosen Himmels gut im Mondschein zu sehen war.
Peter stellte sein Rad an die schiefe Pinie und kletterte mit dem Seil über der Schulter in den Baum hoch. Irgendwo bellte ein Hund.
Langsam ließ Peter das Stöckchen auf die Weinladung herabsinken. Er versuchte, es gezielt in die Grifföffnung einer Korbflasche zu bugsieren. Es dauerte sehr lange, bis ihm dies gelang. Als das Hölzchen endlich durch den Griff gerutscht war, ruckelte er ein wenig an dem Seil und zog vorsichtig an, als sich das Stöckchen verhakt hatte.
Plötzlich kam der Wachhund angerannt, eine große, gelb-schwarze Bestie, die ziemlich gefährlich wirkte.
Der Hund knurrte laut, sprang aufgeregt hin und her.
Peter versuchte, seine Beute langsam hochzuziehen. Die Flasche war enorm schwer. Vorsichtig ließ er sich am Baum herunter und hievte die Flasche so mit seinem Körpergewicht in die Höhe. Sie rutschte zum offenen Wagenende. Dann entglitt ihm das Seil und die Flasche fiel aus dem Wagen. Klatsch! Sie zerbrach auf dem Betonboden.
Der Hund bellte wie verrückt. Wein schwappte über den Boden.
Der Hund wurde neugierig, hörte mit der Bellerei auf und begann statt dessen das köstliche Naß aufzulecken.
Peter zog den nun leichten Korb hoch – was den Hund zu einem halbherzigen Knurren veranlaßte – und befreite das Stöckchen aus dem Griff. Konzentriert begann er, nach dem nächsten Korb zu angeln. Dieses Mal war er cleverer. Erst als er am Boden stand, zog er mit kräftigen, ruhigen Griffen den Korb hoch. Als der oben am Ast baumelte, band er den Strick fest und kletterte wieder hoch. In mehreren Schritten schaffte er es, den Korb über den Zaun zu hieven und ihn vorsichtig zu Boden zu lassen.
Er wunderte sich zunächst, warum der Hund nicht mehr bellte. Aber der hatte sich einen Rausch angesoffen und war eingeschlafen. Er lag neben der Weinpfütze am Boden und schlummerte selig.
Peter wollte gerade die schwere Korbflasche am Fahrrad befestigen, als ihm von kräftigen Händen die Arme nach hinten gerissen wurden. Jemand hielt ihm kichernd die Augen zu.
Er erschrak heftig, riß sich los und drehte sich um. Nun erst erkannte er Dirk und Harry. Die beiden brüllten vor Vergnügen. Als sie sich einigermaßen erholt hatten, beschlossen sie, ein paar weitere Flaschen mitgehen zu lassen. Zu dritt klauten sie in dieser Nacht insgesamt zwölf Korbflaschen.
»Wir haben genug. Das reicht für unseren Urlaub«, verkündete Baumann stolz, als sie Körbe und Fahrrad in Harrys Ente verstauten.
Im Morgengrauen verbuddelten sie heimlich elf der Flaschen am Strand von Pampelonne, zweihundertzwanzig Liter Tafelwein, gekeltert von den Winzern aus Cavalaire-sur-Mer. Unter Lebensgefahr geklaut – sie fühlten sich wie die Posträuber von England.
»Wenn ich die erste Million verdient habe, mache ich das bei den Weinbauern wieder gut«, lallte der besoffene Beck, als sie die erste Flasche leerten.
Was war aus der Idee des Verzichts geworden, einer Voraussetzung für die ewig anhaltende Fête Latine? Egal!
Der »große Weinraub« wurde zum beliebten Gesprächsstoff. Als Peter es sich am nächsten Abend mit Penny unter Decken am Lagerfeuer bequem machte und die erste kostenlose Runde springen ließ, wurde er begeistert gefeiert. Harry grölte betrunken: »Hoch lebe er, unser Held, der uns diese Genüsse schenkte. Thront wie ein Pascha auf seinem Papasan. Hahaha! Das soll sein neuer Titel sein: Papasan! Prost!«
Alles klatschte Beifall und Penny belohnte ihn mit heißen Küßen.
Der Sommer schien plötzlich doch so furchtbar kurz. An einem stürmischen Morgen vernahm Peter leise Mundharmonikatöne und folgte ihnen. Der Himmel war grau, tieffliegende, schwarze Wolken rasten vorbei. Das Meer kochte und warf sturmgepeitschte Wellen an die ins Wasser hinausragende Felsnase am Ende des Strandes. Oben auf dem Felsen thronte Sasha. Er spielte eine arabische Melodie, die Peter gefiel. Er kletterte vorsichtig den Fels hinauf und setzte sich zu dem Musikanten.
»Hallo, Papasan! Genieße mit mir das ewige Spiel von Himmel und Meer. Es erinnert mich an eine alte Melodie des Orients, die mir von meiner verlorenen Heimat erzählt. Ich kämpfte für ihre Freiheit und …« Er deutete auf sein rechtes Bein, dessen Unterschenkel fehlte. Tränen glitzerten in seinen Augen.
Wortlos legte Peter seinen Arm um Sashas Schultern.
Peter und Penny kreideten zum dritten Mal – mit beachtlichem Ergebnis. Sie hatten bereits über dreihundert Franc eingenommen, als es ohne jede Vorwarnung und sekundenschnell passierte.
Ein blaugrauer, vergitterter Polizeitransporter stoppte, die Türen sprangen auf. Beide wurden an den Armen gepackt und durch die Hecktür auf die rechte der beiden langen Sitzbänke gestoßen. Jemand schnappte sich Tasche und Rucksack der beiden und warf sie hinterher. Laut wurde die Tür zugeknallt.
Im gleichen Moment fuhr der Wagen an und brauste mit durchdringendem Signalton durch das dichte Verkehrsgewühl des späten Nachmittags davon. Peter war vorgewarnt und regte sich nicht weiter auf. Für Penny hingegen kam das Einkassieren vollkommen unerwartet. Sie war verzweifelt.
»Oh Gott, was tun sie mit uns? Oh Gott!«
Peter wiegte sie in seinen Armen und beruhigte sie. Ein paar Tränen kullerten, dann faßte sie sich.
Wenige Minuten später hielt der Wagen erneut an. Die Tür öffnete sich und ein stinkender Penner wurde hineingeschoben.
»Bonsoir«, sagte er, eine gewaltige Alkoholfahne vor sich her blasend, und fiel der Länge nach auf den hölzernen Lattenboden. Dabei stieß er etwas unglücklich gegen die linke, leere Bank, so daß er sich eine Schramme an der Stirn zuzog und blutete.
»Die greifen noch ein paar Leute auf, bis der Wagen voll ist, dann werden wir in der Polizeistation in einen Käfig gesperrt. Dort kontrollieren sie unsere Papiere. Wenn damit alles okay ist, lassen sie uns kurz vor Mitternacht laufen«, tröstete er Penny.
Der nächste Stop war am Ende des Hafens. Eine Staffelei flog in den Wagen, zwei Ölportraits und zum Schluß Dirk Baumann.
»Tag, Leute! So trifft sich die Prominenz«, lachte er.
Penny begriff langsam, daß die Sache wohl nicht so schlimm war und versuchte zu lächeln.
»Im Gefangenentransport, von der Polizei einkassiert, oh Gott, wenn das meine Eltern wüßten«, grinste sie verschmitzt.
Erst eine halbe Stunde später wurden die nächsten Verbrecher eingeladen: vier ziemlich dicke, dunkelhaarige Landfahrer mit einem Berg falscher Orientteppiche. Es wurde eng. Zuerst setzte sich der Chef der kleinen Sippe, danach die anderen. Sie legten sorgfältig ihre Teppiche zusammen.
Der Wagen fuhr scharf um die nächste Ecke und hielt erneut. Peter, nicht darauf vorbereitet, fiel fast von der Bank auf die Straße, als sich die Tür plötzlich öffnete.
Zwei Polizisten drückten einen Mann, der sich mit Händen und Füßen wehrte, in den Wagen. Als sie die Klappe zuschlugen, verstand Peter von der in Französisch gebrüllten Anschuldigung nur das Wort »voleur«. Penny übersetzte ihm den Rest. Den Mann, einen gesuchten Taschendieb, erwischte ein Polizist zufällig auf frischer Tat. Bei der Durchsuchung fanden sich zwei weitere gestohlene Geldbörsen in seinen Taschen.
Der Kerl warf sich auf den Boden neben den Penner und tobte herum. »Police. Merde!« schrie er. Alle lachten.
Die ältere der beiden Zigeunerfrauen öffnete ihre Tasche und kramte eine Flasche Cognac heraus. Jeder der vier nahm einen tiefen Schluck. Als der Sippenchef, zumindest wirkte er so, die Flasche absetzte, wischte er sie mit dem Handrücken ab und hielt sie Peter vor die Nase. Der griff dankend zu, trank einen gewaltigen Schluck und reichte sie Penny. Die lehnte ab und gab sie Baumann. Der hielt sie hoch, nickte den vier Gitanos mit den Worten »Merci, mes amis!« zu und soff die Flasche glucksend halb leer. Dann reichte er sie dem erstaunten Dieb, der sie, obwohl der Anführer der Sippe ihn daran hindern wollte, gierig leerte.
»Einmal ein Dieb, immer ein Dieb«, grölte Baumann.
Die Zigeuner sahen sich erstaunt an. Das war Baumann wiederum nicht geheuer. Unsicher langte er in seine Tasche, zog einen Zehn-Franc-Schein heraus und steckte ihn dem verdutzten Chef in die offene Brusttasche.
»Ich bin doch nicht verrückt, Beck. War meine Schuld. Solche Leute stechen schnell zu, ruckzuck ist deine Gurgel durch. Die verstehen keinen Spaß. Ich hätte die Flasche nicht an den Dieb weiterreichen sollen«, erklärte Baumann einsichtig.
Der Transporter mitsamt seiner Ladung stand über vier Stunden auf dem Hof der Gendarmerie. Gleich nach dem Halt wurden ihre Pässe eingesammelt, aber erst um elf Uhr führte man sie in das Gebäude. Ein Beamter griff sich die drei Hippies heraus, verwarnte sie, erklärte ihnen, daß sie nicht in der Stadt betteln dürften, und entließ sie.
In der nächsten Zeit verringerte sich die Zahl der Strandbewohner. Dann kam der Tag, an dem sich Harry verabschiedete und Penny und Vanna ihre Abreise für die nächste Woche ankündigten. Peters Stimmung sank ins Bodenlose, und in seiner Trauer über die bevorstehende Trennung war er besonders zärtlich zu Penny. Er wollte sie nicht verlieren.
Bei einem Bummel durch das quirlige, farbenfrohe St. Tropez schlenderten sie an den aufgemotzten Achterdecks der Luxusyachten entlang. Fast am Ende der Mole, am Eckhaus der letzten Seitenstraße, deutete Penny auf ein großes Bronzerelief. Die in der Hauswand verankerte Platte zeigte übergroß das Profil eines Mannes mit Spitzbart. Sein Blick ging in die Weite, schien sich über die Bucht hinweg in Richtung der Alpen zu verlieren. Am oberen Rand des Reliefs stand ein Name: Frédéric Mistral.
»Das wird ein berühmter Naturwissenschaftler sein. Nach ihm ist wohl der bekannte Sturm benannt, der Mistral«, vermutete Penny.
»Signierte Bronze. Schau unten in die Ecke: Tuby! Ist er nicht Mitbegründer der Fête Latine. Ein Bildhauer und Philosoph? Davon müssen wir den anderen unbedingt erzählen«, freute sich Peter und schloß Penny in seine Arme.
»Peter, wirst du mir treu bleiben bis zu unserem Wiedersehen?« flüsterte Penny.
»Klar, halte das schon durch, die paar Monate. Wann bist du mit dem Bachelor fertig?« Er gab sich lässig, doch tief innen bedrückte ihn die bevorstehende Trennung sehr.
»Im Frühjahr, dann komme ich zu dir.«
Mit dem Kreiden konnte in der Stadt inzwischen kein Geld mehr verdient werden, die Haupttouristensaison war vorbei. Baumann und Peter beschlossen, mit den restlichen Korbflaschen ins Weingeschäft einzusteigen. Acht volle Flaschen hatten sie noch. Nacht für Nacht verkauften sie nun den Wein becherweise für je einen halben Franc. Das war preiswert und der Absatz stimmte.
Die jungen Leute spielten Lieder auf ihren mitgebrachten Instrumenten, sie sangen, lasen Gedichte, zeichneten, tranken, rauchten und liebten sich am Strand von Pampelonne. Die Gelage dauerten meist bis zum frühen Morgen. Am Tage wurde Ball gespielt, in der Stadt gebummelt und ausgiebig im Meer geschwommen.
Es war ein verzauberter Traumurlaub für Peter, beinahe unwirklich. Außerdem erlebte er zum ersten Mal die richtige Liebe. Er mochte Penny, konnte sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen.
Und dann kam der Tag. Ein Bekannter mit einem VW-Bus chauffierte Penny – natürlich von allen Freunden begleitet – zum Bahnhof von St. Raphael. Baumann und Peter verabschiedeten sich von den Mädchen. Pennys Kuß dauerte ewig. Er spürte ihn noch Stunden später auf seinen Lippen. Tränen standen ihm in den Augen.
Peter hatte Angst, daß sie sich nie wiedersehen würden. Gott, wie sehr vermißte er sie schon am ersten Abend. Mit einem ordentlichen Rotweinvorrat zog er sich deprimiert auf den Felsen am Strandende zurück. Hier dachte er über sein weiteres Leben nach. Er mußte Penny unbedingt wiedersehen!
Es war eine dunkle, stürmische Nacht. Ab und zu erhellte der Mond zwischen Wolkenfetzen hindurch die Erde, und Wellenberge mit weißen Schaumkronen reflektierten sein Licht. Der Wind war ausgesprochen warm, obwohl er, sich zum Sturm verstärkend, nun aus Nordwesten kam.
»Wie sind deine Pläne, Papasan? Wohin gehst du am Ende des Sommers?« fragte plötzlich eine Stimme im Dunkeln. Dirk setzte sich zu ihm.