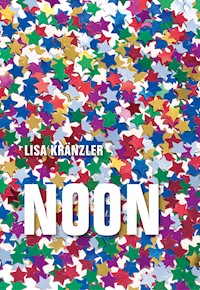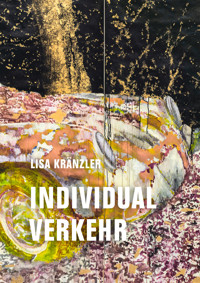Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Kanada, diesem für sie fremden Land, muss sich Lisa Kerz in das Highschool-Leben mit seinen neuen Regeln und Hierarchien einfügen. Und sie ist hin- und hergerissen zwischen den Extremen: auf der einen Seite das aufregende Neue, die Stoner, verlorene Jungs, die sie kennenlernt und mit denen sie schließlich in eine Wohngemeinschaft zieht - mit Punkrock, Drogen, Alkohol, Hunger und Zärtlichkeit. Auf der anderen Seite stehen die sonntäglichen Kirchenbesuche mit der Schwester, mit Predigten, die einer ausgeklügelten Choreografie folgen und angefüllt sind von Gottesliebe, aber auch von Warnungen vor dem Teufel und dem Bösen - und die unbedingte christliche Demut und Enthaltsamkeit verlangen. Lisa droht, zwischen der Angst vor der ewigen Verdammnis und ihrem wilden Leben zerrieben zu werden. Als sei das noch nicht genug, geschieht Lisa etwas Unsagbares, das alles verändern wird, und sie lädt eine Schuld auf sich, die sie ihr ganzes Leben begleiten wird. In Rückblenden und mit feinsinniger Montagetechnik erzählt Lisa Kränzler in einer wunderbaren Sprache vor der Folie einer in Eis und Kälte erstarrten Landschaft, die Isolation bedeutet, von Einsamkeit und Erwachsenwerden, von Ekstase und Schuld. Ein packender Debütroman!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lisa Kränzler
EXPORT A
ERSTER TEIL
1.
Die Mendenhall Subdivision liegt ca. 120 km nördlich von Whitehorse. Wer die Gegend nicht kennt, wird die Ausfahrt verpassen, weiter dem Alaska Highway folgen und nach Norden treiben, vielleicht bis Old Crow.
Der Sog, der von diesem Nichts ausgeht, das manche Weite oder Himmel oder Busch nennen, ist stark. Man kann nie wissen, wen er wohin mit sich reißen wird.
Schwester und Schwager allerdings kennen sich aus und biegen rechtzeitig mit mir ab. Über Schlamm und Schotter rumpeln wir über ein großes Stück Land und ein kleines Stück Lichtung, beides im Besitz meines Schwagers. Die beiden frischverheirateten Landbesitzer haben diesen September eine zweifache Verantwortung übernommen: für ein Versprechen, bis dass der Tod sie scheidet, und für mich, eine 16-Jährige, dieoffizielleAufsichtspersonen benötigt, um im Ausland leben zu dürfen.
Aus dem kniehohen Gras der Lichtung erheben sich eine winzige Holzhütte und ein blauer VW-Bus, Baujahr 1979. In der Hütte steht ein Ofen, im Bus eine Petroleumlampe.
Gestern schlief ich noch unter dem Dach meiner Eltern, in einem Zimmer mit mannshohen Fenstern nach Norden; heute schlafe ich ein, dicht unter dem Busdach, ohne Fenster, dafür im Norden, während ich auf die heulenden Schlittenhunde und das stöhnende Ehepaar lausche.
Am Morgen spüre ich meine Zehen nicht mehr. Es hat geschneit. Der Schnee beendet mein Wildcamper-Dasein.
Wider Erwarten treiben wir schon binnen einer Woche eine neue Bleibe für mich auf. In der Zwischenzeit gewöhne ich mich an die weißen Flocken und finde ausreichend Platz zwischen dem VW-Bus-Mobiliar für meine Liegestützen – die beste Art sich aufzuwärmen.
Die Woche ist voll von ersten und letzten Malen. Zum ersten Mal gelber Schulbus, zum letzten Mal schwesterliches Lunchpaket, um nur diese beiden zu nennen …
Ich erinnere mich daran, wie ich den »fruit-to-go«-Streifen, eine pürierte, getrocknete, klebrige Fruchtmasse, 14 Gramm leicht, etwa von der dreifachen Größe eines Kaugummistreifens, aber im Gegensatz zum Kaugummistreifen aus zwei aneinandergeklebten Hälften bestehend, aus der Lunchbox fische. Mit dem Daumennagel fahre ich zwischen Vorder- und Rückhälfte und ziehe die dünnen Blättchen auseinander. Meine Finger halten 7 Gramm getrocknetes Erdbeer-Fruchtpüree gegen die schwächsten und schrägsten Sonnenstrahlen, die ich je gesehen habe.
Ahmt die Innenseite, das Unterfutter meiner Haut, diese glühende Erdbeerfärbung nach, überlege ich, oder ist bereits zu wenig Licht in mir und nichts als Dunkel, ein violettes Dunkel?
Ich breche meine Überlegungen ab, rolle die roten Hälften zusammen und stecke sie, eine nach der anderen, in den Mund. Den Rest meines Lunchs schiebe ich mit aufmunterndem Nicken in Richtung Kat.
Die schräge Sonne, die frühen weißen Flocken, die Kälte im Bus und dieser Sog, dieses Ziehen an meinen Gliedern, das Gefühl einer nahenden Dunkelheit, haben mich alarmiert. Ich spüre, ich werde hier mit dem Nötigsten auskommen müssen. Es wird mir zu wenig sein, viel zu wenig. Es wird die Grenzen dessen, was ich mir ertragen zu können zutraue, verschieben, mich an die unmöglichsten Orte ziehen.
Ich wiederhole mein Zunicken. Schließlich reagiert Kat. Sie greift und beißt zu, während meine Blicke besorgt zwischen Sonne und Schuluhr hin- und herwandern.
Kat.
Kat wird keine wichtige Rolle spielen. Aber sie war die Erste, die mich ansprach. Alle Worte, die auf sie zutreffen, schmecken irgendwie süß, und ich habe beschlossen, mir diese süße Sünde zu genehmigen:
Kat heißt eigentlich Kaisha, ist etwas jünger als ich und kommt aus Kamloops (Kamloops, Fruitloops, da geht’s schon los), einer Stadt in British Columbia. Sie ist klein, ihr Kopf reicht mir gerade bis an die Schultern, und solange ich sie kannte, wechselte die Haarfarbe dieses Kopfes von Rosa zu Rot, von Rot zu Orange, von Orange zu Blau und schließlich zu Wasserstoffblond. Ihre Fingernägel waren stets in der entsprechenden Komplementärfarbe zu ihrer jeweiligen Haar- oder Lidschattenfarbe lackiert. Auf ihren Lippen glänzte, glitzerte und roch es nach einer ganzen Palette von künstlichen Farb- und Geschmacksstoffen. Im Unterricht schrieb sie mir kleine Zettel, einige habe ich bis heute aufbewahrt. Sinnlose Sprüche und Wortfetzen wie »feet are pink, trees are purple«. Um die Schrift rankten sich Nadelbäume in verschiedenen Violetttönen und mehrere Paare pinkfarbener Füße.
Kats Augen zierte ein auffälliges, kühn geschwungenes Brillengestell mit dicken Gläsern. Sie hatte einen schönen, vollen und ständig offenen Mund. Sie hielt sich für eine begnadete Sängerin. Wenn wir auf dem Schulklo Hosen tauschten – sie war versessen darauf, ständig Kleidungsstücke auszutauschen, und verließ das Schulgebäude selten so, wie sie es am Morgen betreten hatte – kreischte sie mir ihre Songs, meistens Pophymnen der 80er Jahre, ins Ohr.
Kat ist ein Klischee. Vielleicht hätte ich doch darauf verzichten sollen, all diese zuckrigen Worte in Sätze zu schmelzen? Jetzt karamellisieren sie hier und verkleben die Seiten.
Wer Kat erleben will, kann sich den Umweg über diese Zeilen sparen und einfach beim nächsten Einkauf vor dem Süßwarenregal stehenbleiben, sich eine Packung Smarties (viele, viele bunte) und eine Tüte Skittles (taste the rainbow) herausnehmen und sich intensiv der Betrachtung von Produktdesign und Inhaltsstoffen widmen – das wäre dann ihre äußere Erscheinung.
Will man tiefer in ihr Wesen eindringen, etwas über ihren Charakter erfahren, so sollte man eine Packung kaufen, eine andere aber stehlen; anschließend die gekaufte Packung ungeöffnet in den nächstbesten öffentlichen Mülleimer werfen, während man sich den Inhalt der gestohlenen, schon aufgerissenen Packung entweder mit beiden Händen in den Mund schaufelt, oder wahlweise eine einzelne, bunte Zuckerkugel minutenlang andächtig in der Daumen-und-Zeigefinger-Zange hält, bevor man sie vorsichtig, als handle es sich um den Leib Christi, mit der Zunge empfängt, um sie genüsslich aufzulutschen. Unter Umständen motiviert der Zucker den Lutschenden zu tänzerischen Zuckungen, was wiederum die Stimmbänder zum Vibrieren bringen könnte …
Mehr braucht es nicht, um Kat zu kennen. Kat aus Kamloops. (Fruitloops).
2.
Ich beziehe ein Zimmer in der Fir Street, ästhetisch gesehen ein Rückschritt, in Sachen persönlicher Freiheit jedoch ein gewaltiger Fortschritt. Der VW-Bus war für mich ohnehin kein »Designklassiker«, sondern schlicht Schlafplatz. Eine entlegene, eiskalte Schlafstätte,von der ich mich bereits um 5.30 Uhr aufrappeln musste, um 6.10 Uhrin den Schulbus zu steigen und zwei Stunden Fahrt durch denBusch auf mich zu nehmen, wenn ich pünktlich zum Unterricht erscheinen wollte. (Ob ich »wollte« oder nicht, war allerdings keine Entscheidung, die ich hätte treffen dürfen. Ich musste).
Wenn Himmel und Horizont weit und das Elternhaus noch weiter entfernt sind, entwickelt man schnell ein Bewusstsein für die Zwänge, für die »musts«, denen man unterliegt. Man bildet Widerstände und einen Abscheu gegen die Gönnerhaftigkeit aus, mit der Aufsichtspersonen und Erziehungsberechtigte »Freiheiten« und »Privilegien« zuteilen oder vorenthalten. Was man als sein gutes Recht auf Freiheit ansieht, stellt sich als »Privileg«, das man »genießt«, heraus. Den volljährigen Machthabern gänzlich ausgeliefert sieht man sich mit dem Unterschied zwischen Recht und Privileg konfrontiert, der offensichtlich darin besteht, dass Privilegien entzogen werden können.
In der Hoffnung, meinen Freiheitsdrang mehr oder weniger konfliktfrei ausleben zu können, ziehe ich also in das schrecklich möblierte, dunkelbraune Zimmer im ersten Stock eines gelben, zweistöckigen Holzhauses und kritzle »des Menschen Wille ist sein Himmelreich« auf Hefte, Ordner, Rücksäcke und Klowände, den schwarzen 3000er Edding stets griffbereit.
Es wird Oktober. Das Thermometer zeigt 20 Grad unter null. Die öffentlichen Verkehrsmittel streiken, und ich kann nirgends hinfahren, geschweige denn laufen. Die Wochenenden sind unendlich lang. Ich sitze in der Falle; einer dunkelbraun möblierten Falle. In meinerVerzweiflungnehme ich mir das Oxford English Lexikon vor und fange bei A an:
abandon,abandoned (ich), ability, able (nichts kann man tun, nichts!), about, above, abroad (ich), absence (of friends and family), absent, absolute (solitude), absolutely, absorb (these words), abuse, academic, accent (trying to loose mine),acceptable (NOT!),accept (I won’t!), access, accident …
Ich lerne, lese und kommentiere, bis alle Wörter ununterscheidbar und die Kopfschmerzen unerträglich werden. Und Liegestütze! Liegestütze, bis meine Arme zitternd nachgeben, und ich schweratmend mit dem Gesicht voran in den widerlich stinkenden, abscheulich gemusterten Teppich falle.
Zwischenzeitlich schalte ich den kleinen Fernseher ein und spreche die Dialoge der Sitcoms nach – ehrgeizige Bemühungen, meinen »german accent« auszumerzen. Fernsehschauen … Eine Beschäftigung, die Untätigkeit und stilles Sitzen mit sich bringt, und damit Traurigkeit sowie ein überdeutliches Bewusstsein meiner Einsamkeit undHilflosigkeit.
Im Versuch, diese unerwünschten Gefühle niederzubrennen und die Isolationshaft, in die ich da geraten bin, erträglicher zu machen, entfache ich kleine, wütende Feuer; sprinte hitzig zwischen Zimmer und Bad hin und her, springe an die Zimmerdecke, putsche mich tüchtig auf und bearbeite mein Kopfkissen mit Faustschlägen. Ich vermesse die Längen und Breiten des Zimmers in Fuß- und Handlängen, dusche mehrmals täglich brandheiß-eiskalt-brandheiß-eiskalt und rede mir ein, es ginge mir nur um Abhärtung und Stärkung der Abwehrkräfte.
Leider fällt mir, nachdem ich mich mehrmals durch diesen Parcours gehetzt habe, doch wieder ein, dass, selbstWENNich auf die Straße ginge, ich außer dem Supermarkt keine weitere Anlaufstelle hätte, und bei den gerade herrschenden Temperaturen jeder Fußmarsch länger als 15 Minuten ohnehin Selbstmord wäre.
Apropos Supermarkt. Da ich weder geübt, noch besonders gut darin bin, mich selbst zu versorgen, kaufe und ernähre ich mich fast ausschließlich von runden Brötchen mit Loch in der Mitte. Eine Tüte Kringelbrötchen (die Kanadier sagen »Bagels«) deckt meinen Nahrungsmittelbedarf für mehrere Tage. Von wegen »der Mensch lebt nicht vom Brot allein« …
Wenn im gelben Haus im braunen Zimmer die Vesperzeit anbricht, stelle ich mir vor, wie meine Ration Brot und Milch durch eine Luke geschoben wird, wie es milchig aus dem Blechbecher schwappt und das Kringelbrötchen aus der Tellermitte rutscht: DerWärter hat das Tablett eine Idee zu fest mit dieser kleinen automatischen Bewegung aus dem Handgelenk, in die er all seine Verachtung für mich legt, geschubst. Bevor er zur nächsten Zelle weitergeht, spuckt er aus. Ich kenne das Geräusch.
Im Übrigen fühle ich mich in der Fir Street zwar einsam, bin jedoch nicht allein. Meine Vermieterin, eine 60-jährige, leicht reizbare, optisch reizlose Frau mit Lippenstift auf den Zähnen und geschmackloser Perücke, betreibt tagsüber in den angrenzenden Zimmern ein Daycare und durchschnüffelt, während ich in der Schule bin, leidenschaftlich gern meine Sachen. Sie kann mich oder die Tatsache, dass ich ein junges Mädchen bin, nicht ausstehen und wirft mir giftige Böse-Stiefmutter-Blicke zu. Im Nachhinein frage ich mich, warum sie mir das Zimmer überhaupt vermietet hat.
Deshalb plagt mich kein schlechtes Gewissen, als ich an Halloween einige Handvoll Süßigkeiten aus ihrer Küche stehle und ihre Brownies vorsichtig mit dem Brotmesser beschneide – jeden einzelnen um wenige Millimeter, für den Fall, dass sie sie insgesamt abgezählt haben sollte.
Ich verbringe die Nacht zwischen den Spielsachen fremder Kinder. Puppen sind Zeugen mit weit aufgerissenen Glasaugen, wie ich meine schmelzende Beute vernichte; sie reißen ihre obszönen Plastikmünder auf und bleiben doch stumm. Meine Finger sind braun und klebrig.
Im Zimmer, an den Händen, im Magen: braune Völle all überall. Ich wünschte, ich hätte mich mit Milch und Lochbrötchen begnügt; beides ist rein und kalt und weiß – wie der Schnee vor meinem Fenster. Jetzt sitze ich da, besudelt mit der Schokolade einer neidischen, geldgierigen Alten.
»Hast du dich dennoch von Leckerbissen verführen lassen, steh auf, erbrich sie, und du hast Ruhe …«, so heißt es doch!
Ich stehe also auf und befolge, gute Christin, die ich bin, erst den Bibelratschlag, bevor ich mich erschöpft ins Bett fallen lasse.
3.
Die Fir Street ist nicht besonders lang, vielleicht 1000 Meter, und wird nur von einer einzigen Querstraße, der 14th Avenue, durchschnitten. Das Holzhaus mit dem braunen Zimmer sitzt an der Ecke und markiert den Schnittpunkt gelb. Wenn ich die 14th Avenue überquere und der Fir Street in südlicher Richtung folge, befinde ich mich nach weniger als hundert Schritten vor einem weißen, länglichen Gebäude mit Flachdach, von dem man annehmen könnte, es sei fensterlos, bis man bei genauerem Hinsehen am äußersten Rand des gestreckten Rechtecks schließlich ein einzelnes, kleines Fenster entdeckt. Vor Jahrenwurde das Gebäude an den Straßenrand geschwemmt, jetzt liegt esda wie ein gestrandeter Wal, einäugig, angegraut, schäbig. Nichts lässt auf sein Innenleben schließen und darauf, was die Geschehnisse innerhalb der hellhörigen Holzwände noch in meinem Innersten anrichten werden.
Die korrekte Bezeichnung für ein Gebäude dieser Bauart erfahre ich erst später. Sie lautet »Trailer«, was so viel bedeutet wie »billiges, minderwertiges, in Leichtbauweise zusammengezimmertes Möchtegern-Haus, welches auf Lastwagen verladen und in andere Städte, Bundesstaaten oder Länder verfrachtet werden kann«, im übertragenen Sinn: »Unterschicht«.
Im Oktober 2000 blieb der Trailer an Ort und Stelle. Kein Lastwagen-Schlachtschiff mit einem bärtigen Fernfahrer namens Ahab verhinderte rechtzeitig, dass ich meiner Schwester in den Bauch diesesweißen Ungetüms, halb Haus, halb Wohnwagen, folgte, wo ich PastorLeroy kennenlernte. Keine Warnung vor dem Erlöser, keine Rettungvor dem Retter. Und so lernte ich das Haus, das kein Haus, sondern ein Trailer ist, sich aber nicht Trailer, sondern »Trinity Baptist Church« nennt, auch von innen kennen.
Ich bin in Süddeutschland umgeben von Barockkirchen mit Zwiebeltürmen aufgewachsen, wurde vor einem marmornen, endlos verschnörkelten, mit Blattgold verzierten Hochaltar katholisch getauft, umsorgt von fetten Pfarrern, Putten und Verwandten. Folglich hätte ich in diesem fensterlosen Bau alles erwartet, nur keine Kirche.
Was ich mir vom Kirchgang erhoffte, waren ein paar Stunden Gesellschaft und die Nähe meiner Schwester, die die Fahrt in die Stadt bald nur noch mittwochs und sonntags auf sich nahm, den beiden Tagen, an denen Gottesdienste abgehalten wurden.
Wir stehen in diesem kleinen, fensterlosen Raum: meine Schwester, mein Schwager und ich. Neben, vor und hinter uns etwa zehn, an gutbesuchten Tagen fünfzehn, weitere Gemeindemitglieder. Die jungen Frauen tragen Haare und Röcke lang, die Anzüge der Männer sitzen schlecht. Die meisten tragen Turnschuhe. Die Kombination Schildmütze und Sportschuhe zu Krawatte und Anzughose scheint hier en vogue zu sein. Die wenigen Indianer – keiner spricht von ihnen als »Angehörige der First Nations«, Diskriminierung hin oder her – bilden eine eigene Gruppe. Offensichtlich halten sie es für überflüssig, sich für den »service« herauszuputzen, tragen ausgebeulte Jeans und speckige Lederjacken. Vorne stehen ein kleines Klavier aus hellem Holz, ein Rednerpult und eine Art transportabler Swimmingpool, der mit einem Plastikdeckel verschlossen ist und an Tupperware erinnert; man erklärt mir, dies sei das Taufbecken. Der spärliche Blumenschmuck ist genauso unecht wie der Schmuck der Frauen. Die monströsen Haargummis, die die Pferdeschwänze zusammenhalten, sind ebenso wie die roten Bezüge der Stühle aus Kunstsamt.
Die Anwesenden wissen nicht recht, wohin mit ihren Händen, blicken verschüchtert auf ihre Schuhspitzen. Werden sie angesprochen, so bemühen sie sich um ein offenes Lächeln und ein möglichst einladendes, freundliches und mitfühlendes Gesicht.
Susanna, eine junge, dauergewellte Weiße, reicht mir zur Begrüßung eine Hand, die wie ein kalter Fisch in meine Handfläche gleitet und nicht auf meinen Druck reagiert. Worte wie »Schicht« und »Klasse« steigen in mir hoch, ich fühle mich nicht dazugehörig, kein neues Gefühl für mich, sondern ein allgegenwärtiger Zustand, mit dem ich mich, seit ich denken kann, herumschlagen muss. Einsamkeit war zu allen Zeiten mein Motor, und so betrete ich diese Kirche mit wirbelnden Kopfrädchen in der höchsten Umdrehungsfrequenz.
Wenn man erst ein-, zweimal menstruiert hat, kann man noch glauben wie ein Kind; man träumt noch von allem Möglichen und davon, dass alles möglich ist, unterhält sich nachts mit »Gott« und vertraut auf dessen spontane Eingebungen, wenn man wieder einmal unvorbereitet in eine Klassenarbeit geht.
Man zählt Straßenlaternen, Knöpfe und Gänseblümchenblätter genauso ernsthaft und andächtig wie die Kugeln im Rosenkranz, und ob man nun den Fingerring dreimal dreht oder sich am Portal der St. Johann Kirche dreimal bekreuzigt, ist völlig einerlei, denn beides sind heilige Handlungen, beides könnte das Gewünschte herbeiführen, auf beides hofft man inständig.
Wenn ich damals ganz, ganz still lag und mit ihm sprach – ich werde nicht sagen, mit wem, sein Name war niemals wichtig, nicht für mich – wenn ich also dalag, die Sinne geschärft, Poren und Stirn geöffnet, dann konnte ich ein Netz aus Gedanken bis hinauf in die Unendlichkeit weben, mit Bett, Körper und Kopf an seinem Ort. Die Fäden meines Glaubens hefteten sich an den schwarzen Mantel und füllten sich wie Arterien, durch die etwas Lichtes, Leichtes, Goldenes in mich hineintanzte, michauflud, volltankte, und zugleich schwerelos werden ließ. Wir kannten uns. Meine Fragen, seine Antworten und das Nichtige von beidem.
Wann schließlich meine Unruhe begann, ist nicht mehr auszumachen. In der Fir Street konnte ich schon lange nicht mehr still, geschweige denn ganz, ganz still liegen.
Pastor Leroy.
Leroy Garrison ist Amerikaner. Ein Südstaatler, geboren und aufgewachsen in Louisiana. Sein überdehnter Kaugummidialekt, die Art, wie er die Vokale zwischen seinen Zahnlücken zu Schlagwörtern aufbläst und platzen lässt, prägt sich den Zuhörern ein, bleibt haften, und jede Geste, jeder Schritt verstärkt den Klebeeffekt.
Die Predigt wird von seiner ausgeklügelten Choreografie begleitet. Den Bauch brav hinter dem Rednerpult versteckt steht er mit verschränkten Fingern und still gesenkten Lidern vor der Gemeinde, vom Scheitel bis zur Sohle gottesfürchtiger Diener des Herrn. Nach den ersten Sätzen schleicht er auf die Sitzreihen zu, dirigiert die eigene Stimme, peitscht sie vorwärts und lässt sie zu einem durchdringenden Fortissimo anschwellen. Die Absätze seiner Cowboystiefel drücken sich in den grauen Teppich wie in frischen Zement. DieSchäfleinfolgen seiner Spur quer durch die Bibelverse, lauschen seiner Rede und fürchten sein vorwurfsvolles Schweigen. Viele Hundert Widerhakenworte verfangen sich in ihrer Wolle und kletten sich fest.
Plötzlich sieht er mich an. Die fleischige Trutzburg seines Gesichts zieren zwei blitzende Äuglein, aus denen er Blicke auf mich abfeuert, mich durchschaut, ertappt und enttarnt. Ich starre vergeblich zurück, pralle an seiner Oberfläche ab. Brillengläser, Cowboyhut, eine rosa Zunge, spitz wie seine Stiefel. Mehr lässt er mich nicht sehen.
Nach dem Gottesdienst schüttelt er meine Hand, lässt sie mit einem »Hello there, little Miss!«, in seiner Pranke verschwinden. Das Schwarz seines Anzugs weitet meine Pupillen.
So stehen wir uns gegenüber, die »little Miss« in Jeans und der »man in black«, ein Johnny Cash ohne Gitarre, der vom »Lake of Fire« singt.
4.
Ich sitze auf rotem Samt im Geruch meiner Schwester. Unsere Schultern und Oberschenkel berühren sich sanft. Als die ersten Klaviertöne erklingen, fühle ich mich fast erleichtert, fast zu Hause. Wir teilen uns das Gesangbuch, die erste und zweite Stimme, teilen die Luft zum Atmen, teilen das alles schwesterlich wie früher unser Stockbett und die Aufmerksamkeit der Eltern.
Die Lieder haben zu wenig Strophen. Ich wünschte, wir könnten ewig so stehen und unsere Stimmen aneinandergeschmiegt in jenen Raum hinausschicken, von dessenHerrlichkeit der Text erzählt; einfachstehen, mit aller Kraft gegen die Angst ansingen, den Kampf singend austragen bis zum Ende; singen, bis ich keine Stimme und keine Angst mehr habe, bis meine Knie nachgeben und meine Schwester mich nach Hause tragen wird; bitte; in eine Heimat, wo immer sie sein mag.
Schon sind die Noten aufgebraucht und alles leergesungen bis zum letzten Klangtropfen aus dem Klavier, dessen Welle abflacht, sich verflüchtigt und verstummt. Die Pastorenfrau nimmt den Fuß vom Pedal. Kein Hall mehr für mich, nur Räuspern und Stühlerücken und raschelnde Röcke beim Hinsetzen. Wir schweigen im Chor, die Stille begleitet den Solisten auf seinem Weg ans Rednerpult. Ich höre Leroys Stimme:
»Everything in our physical world possesses certain qualities that make it what it essentially is. We recognize things not only by the characteristics that they possess, but also by those that they do not possess.«
Das scheint der Gemeinde einzuleuchten. Hier und da nickt es neben mir.
»You’re not likely to ever see a horse with antlers growing out of its head, or a deer with a trunk hanging from its face …«
Er macht eine kleine Pause, will uns etwas Zeit geben, sicher gehen, dass das Pferd mit dem Geweih auch tatsächlich vor unserem inneren Auge erscheint. Während es an mir vorübertrabt, fährt er fort.
»… if they did, they would be considered freaks of nature!« Wir werden aufmunternd angelacht. Nein, keinem von uns wächst ein Geweih aus der Stirn, wir sind keine Freaks und lächeln erleichtert zurück.
»Today as we deal with the topic of hell, I want to talk about some of the things that will not be there …«
Um mich her wird es still, sehr still. Für heute hat es sich wohl ausgelacht. Leroys Miene ist ernst, besorgt, voller Entschlossenheit.
»… by doing so, we will get a vivid idea of hell’s characteristics. I can assure you …«,sein Blick scannt die Stuhlreihen,»if you are normal, you won’t like what you see.«
»If you are normal?« Ich rutsche auf meinem Stuhl hin und her, blicke über die rechte Schulter nach hinten, mich vergewissernd, dass da eine Tür, ein Ausgang, ist.
»What the bible has to say about hell is not simply metaphorical or allegorical. I believe that hell, the one the bible speaks of, is a literal place, filled with literal people enduring literal unbearable pain. I believe our worst nightmare would not come close to the horrors of hell.«Er verlässt das Pult, breitet die Arme aus und blickt zur Decke.
»One might ask ›why would a loving god create such an awful place?‹«Leroy senkt Arme und Stimme, flüstert uns zu:»Folks, I believe that god wanted to make hell so horrible, so hot, that everybody who seriously considered it would be repulsed by it.«
Ich suche nach den Augen meiner Schwester. In meinem Rücken die Tür. Die Schwester sieht mich nicht, die Tür bleibt fest verschlossen.
»Let’s see what god’s word has to say about it.« Er nimmt die Bibel vom Pult. »In hell there will be no light.« Jetzt fliegen seine Finger über die Seiten, das Zitatfeuer auf uns ist eröffnet, Salve um Salve schlägt in meinen Kopf ein.
»Matthew 8,12: But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness … bind him hand and foot and take him away, cast him into outer darkness …«
Ein dunkler Zustand. Ein Einsamkeitszustand, in dem man nicht sieht und nicht gesehen wird, blinde Körperlosigkeit. Ich suche die umstehenden Schemen, den Chor, die Gemeinde, die Schwester, nach Augenpaaren ab und finde keine. Niemand erwidert meine Blicke. Bin ich bereits eine von denen,»to whom is reserved the blackness of darkness forever«?Die Pastorenstimme unterbricht meine Gedanken:
»Can you imagine never seeing the light again? When lost souls have suffered the darkness of hell for a thousand years, they will still be tormented by the memories of the warm glow of the sunlight that once caressed their faces … But they will never see the light of day again. What more fitting punishment could there be for those who ›loved darkness rather than light‹?«
Zustimmendes Nicken der Gemeindeköpfe, ein paar Mutige rufen »Amen!«, was offenbar so viel bedeutet wie »korrekt«, »ganz deiner Meinung«, »richtig so«.
Mit lieblich hoher Stimme und grausamem Lächeln fährt Leroy fort:
»I am told that one who is forced to remain in total darkness for an extended period of time becomes very agitated and irritable…«
Ich will hier raus. Ich will hier raus!
»… and in hell he will lift up his eyes, being in torment.«
Ich hebe meine Augen nicht mehr. Sie sind zu nass.
»… there shall be weeping and gnashing of teeth.«
Wie lange noch? Ich starre auf mein nacktes Handgelenk, spähe in die Reihe vor uns, suche vergebens nach einer Armbanduhr.
»… and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever.«
Ich sitze in der Todeszone. Es hagelt Worte. Der Munitionsnachschub scheintunerschöpflich. Flammende Worte, ewiges Feuer, und beides will kein Ende nehmen.
»The pain will be forever. The darkness will be forever. The thirst will be forever. The languishing and torment will be forever.«
Endlich ein Blick.
Es sind Pastorenaugen, die mich ansehen, und es ist die Pastorenstimme, die sagt:
»Folks, there will be no exit signs in hell. There will be no escape. Once a person arrives in hell, it will be forever.«
Irgendwann setzt endlich das Klavier ein. Ich singe um mein Leben, hetze durch die Strophen und aus der Tür, über der ein rotes Exit-Schild leuchtet. Noch.
5.
Ich hatte keine Argumente. War nicht bibelfest.
Kirchgang. Das war für mich bislang ein sinnlicher Rausch aus Weihrauch, Kerzenwachs und Sonnenstrahlen, die durch bunte Glasfenster fielen; das Murmeln von Gebeten und alten, geheimnisvollen Worten wie »Versuchung« und »Erbarmen«, begleitet von dunklen Adjektiven wie »gebenedeit« oder »würdig«. Blattgold an den Wänden, mit Amethyst verzierte Kelche, lange Gewänder aus Leinen, über denen handbestickte Stolen in Festtagsfarben hingen. Eine Abfolge feierlicher Rituale zum Klang der Glocken und Orgelpfeifen.
Was hatte man mir beigebracht? Wer war dieser »Gott« für mich?
»Gott ist mein Schutz, mein Schild, mein Stab, meine Burg und mein Fels. Er befiehlt seinen Engeln, mich zu behüten, auf all meinen Wegen. Sie sollen mich auf Händen tragen, damit mein Fuß nicht stößt an einen Stein. Über Nattern und Schlangen werde ich schreiten, treten auf Löwen und Drachen.«
Was verlangte er für all das, welchen Preis hatte das?
»In deinem Haus darf ich wohnen, mein Leben lang; wie ein Wurm in der Erde, ein Schwan auf dem See, ein Tiger im Dschungel, eine Katze im Hof.«
Und das alles ohne Gegenleistung? Wer konnte das glauben?
Das jahrelange Gerede über Güte und Barmherzigkeit – von »seiner Hand, die er über mich hält … Er, der mich speist und sanft schlafen lässt, weil er mich liebt; es sei alles gesegnet, was er mir gibt« – war mir inzwischen zur leeren Formel verkommen.
Irgendwo da oben saß er, der liebe Gott, der nur das Beste für mich wollte. Ein bisschen Ehrlichkeit, ab und an beten, möglichst nicht morden und stehlen, mehr verlangte er nicht. Und sollte ich dennoch lügen, morden oder stehlen, würde ihm meine wahrhaftige Reue genügen. Mit hängenden Schultern und schamvoll gesenktem Kopf wäre ich vor ihn hingetreten, hätte gebeichtet und die Sache bereinigt. So einfach war das, oder vielmehr: so einfach schien es bisher.
Mir wurde schnell klar, dass ich den flammenden Reden des Pastors nichts entgegenzusetzen hatte. Mein Glaube schien mir nichts weiter als ein Ammenmärchen zu sein, ein Kinderglaube, hohl und lächerlich. Ich hatte nicht nachgedacht, nicht nachgefragt, nur empfunden; hatte Ergriffenheit und Sentimentalität mit Wahrhaftigkeit verwechselt. Plötzlich musste ich mich ernsthaft fragen, mit wem ich da nachts redete. Was wusste ich wirklich von ihm?
Wie konnte ich jahrelang vor einer Macht niederknien, die ich nicht kannte, nicht begriff, nicht hinterfragt hatte?
Ich hatte die Bibel nicht gelesen; ich war verdammt nochmal 16 Jahre alt! Wer studiert denn mit 16 die Bibel?
Ich hatte stets die höchsten Ansprüche an mich, verabscheute nichts mehr als Halbheiten; wollte absolute Entscheidungen, klare Trennungen und präzise Definitionen. Die Textunterschriften und Sprechblasen zu den Bildern meines Lebens sollten radikal sein. Ich war durchaus empfänglich für Parolen; solange Großes, Schimmerndes, Hoffnungsvolles verkündet wurde, durfte der Refrain gerne etwas pathetisch sein. Das war nicht meine Schuld. Die Hormonpest der Jugend hatte mich voll im Griff.
Und so hatte es Pastor Leroy geschafft, zu meinem in sich selbst versponnenen, wuchernd wachsenden Teenager-Selbst vorzudringen. Seine Worte brachten eine Lawine aus W-Fragen ins Rollen, beförderten mich mit einem Arschtritt in die nächste Lebensphase, die bestimmt sein würde von all den Qualen und Zweifeln, die mit demWARUMeinhergehen. In meinem Hirn sollte fortan Absolutismus herrschen: Die königliche Fragen-Familie hatte mein altes Ich gestürzt und den Thron bestiegen.
Meinem Leben erging es wie dem Sauerteig. Eine kleine Handvoll Ws durchsäuerte den ganzen Teig und ließ ihn aufgehen. Ich sprengte die Schüssel meiner Kindheit und breitete mich wild in alle Richtungen aus, ohne zu wissen wohin.
6.
Jeden Morgen stapfe ich durch den Schnee, die 14th Avenue entlang, überquere die Holly Street, nehme die Abkürzung durch das kleine Waldstück, rutsche auf vereisten Trampelpfaden – nicht selten auf dem Hosenboden – der Porter Creek Secondary High School entgegen. Ob Jesus für meine Sünden gestorben ist, interessiert hier niemanden. Von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr beschäftige ich mich vor allem damit, die hier herrschenden Machtverhältnisse, Rangordnungen und Hierarchien zu entschlüsseln. Mit wem sollte man sich zeigen, mit wem besser nicht; wer ist der Aufmerksamkeit wert, wer zu ignorieren? Wie groß ist die Distanz zwischen den beiden hintersten Tischen der Cafeteria, einer rund, der andere rechteckig, um die sich die Crème-de-la-High School versammelt, und die ich im Stillen »Alpha« (rund) und »Beta« (rechteckig«) taufe? Welche Kontaktpersonen braucht man, um in diese Runde eingeschleust zu werden, oder bin ich bereits zufrieden mit meiner prompten Aufnahme an den Betatisch, inklusive boyfriend, der Matt heißt und ein bereits geachteter, im oberen Drittel der Schulgesellschaft angekommener Mann bzw. Junge bzw. irgendetwas dazwischen ist …
Nichts könnte profaner sein als dieser Schulalltag, der bestimmt wird von Eitelkeiten und Skandälchen, von Kindereien und Flirtereien, vom Herzeigen der mannigfaltigen Statussymbole, die vomschon gut entwickelten Busen oder Bartwuchs über Marken-Jeans bis hin zu einer möglichst großen Anzahl durchstochener Körperteile reichen. Wie oft man am Wochenende auf den Rasen der Nachbarn gekotzt hat – die Zeugen, die dem Kotzen beigewohnt und die Nachricht an Freunde und Nebensitzer weitergeleitet haben, können von ungeheurer Bedeutung sein und das eigene Image wunderbar aufpolieren: »Damien pukedSEVEN TIMES, man,SEVEN TIMES…!«
Nun habe ich das Glück (oder Unglück), ein Exot mit einer ganz beachtlichen Anzahl von Statussymbolen zu sein, und so kennt bald jeder das »german chick« mit den braunen Augen und den abgewetzten Jeans, das in dieser speziellen Nacht, als Damien siebenmal auf das Nachbargrundstück gekotzt hat, den Wodka für sich entdeckt hat, und von dem es heißt »she drinks like a sailor!«.
Ich hatte mich wohl zu lange dagegen gesträubt zu akzeptieren, dass so ein bisschen Feuerwasser überhaupt irgendeine Wirkung auf mich haben könnte, was dazu geführt hat, dass ich die Flasche schnell, sehr schnell, geleert habe. Schnell genug, um während des Trinkens keine besondere Veränderung an mir feststellen zu können. Wer weiß, vielleicht bin ich ja immun dagegen, dachte ich noch, ohne zu bemerken, dass der Typ neben mir längst nicht mehr Matt war, was mich nicht davon abhielt, ihn weiterhin mit diesem Namen anzusprechen und ihm feierlich zu erklären »I want you to be my first«.
Dann folgte ein harter Schnitt. Der Schnaps hat die Nacht verschluckt, restlos. Die Bilder sind ausgelöscht und kehren nicht wieder. Mein Talent zum Filmriss ist eine Entdeckung jener Nacht. Endlich etwas Nützliches, bei dem ich nur noch lernen muss, wie man es beherrscht, mit und ohne Hilfsmittel, über kurze oder lange Strecken, so wie ich es brauche. Mein Mittel gegen Angst und Zweifel und (später) gegen Lebendigkeit.
Damien hat also siebenmal gekotzt und ich – ich schlage irgendwann die Augen auf. Ein Erwachen in der Fremde. Der erste Schock ist der, nicht in Deutschland zu sein. Vor mir dämmert die Umgebung herauf, der Raum öffnet sich. Ein Kellerraum mit Regalen und Wäschekörben. Ich habe auf den zusammengeschobenen Waschmaschinen- und Trocknerwürfeln geschlafen. Keine Ahnung, wie lange. 10 Stunden? 15? Die Uhr in mir hat keine Zeiger mehr. Ich stelle mich hin, mein Blick taumelt an mir hinunter, fällt auf eine mir bis dato unbekannte Boxershorts mit gelbem Smiley im Schritt. Mehr habe ich nicht am Leib.
Am Montag bekomme ich die Quittung für mein Seemannsgebaren in Form von anerkennendem Schulterklopfen und bewundernden Blicken. Mein Mythos beginnt, sich zu formen, die Jungs vom runden Tisch schielen zu mir rüber. Wer mich noch nicht gekannt hat, kennt mich jetzt.
Meine Panik, meine bösen Ahnungen und die verzweifelten, vergeblichen Versuche, mich an die Geschehnisse der gelöschten Stunden zu erinnern, erweisen sich als überflüssig. Was immer ich getan habe oder mit mir geschehen sein mag, es hält Matt nicht davon ab, mich weiterhin zu besuchen. Dann drehen wir die Heizung auf. Wir ziehen uns die T-Shirts aus und lassen uns vom Exmann meiner Vermieterin erschrecken, der sich wütend brüllend gegen die Zimmertür wirft: »The fucking paint is melting off the walls«. Auch ich schmelze dahin, allerdings nicht wegen Matt, sondern wegen Gavin Rosdale, der für uns singt:
»I don’t wanna come back down from this cloud, it’s taken me all this time to find out what I need …«
Später gleiten wir in Matts Auto, in dem uns niemand daran hindern kann, die Heizung voll aufzudrehen, durch eine Dunkelheit, die keine Laternen braucht; Mond und Schnee erleuchten die Straßen. Wir machen Besuche. Matt fordert mich zum Deutschsprechen auf, er mag den Klang. Damien lässt sich von ihm anstecken, und da er nicht nur kotzen, sondern auch singen kann, lässt er sich Song-Texte von mir übersetzen. »Under the Sea« wird zu »Unter dem Meer«. Ich kenne das Lied in- und auswendig, der beste Song in Disneys »Arielle, die Meerjungfrau«; besser ist nur noch die Punkcover-Version von Damiens Band – heute, mir zu Ehren, sogar mit deutschem Text. Ich stehe am Bühnenrand und ahne, dass meine Aufnahme und Eingliederung viel zu leicht, verdächtig reibungslos verlaufen ist. Wo ist der Haken, was ist der Preis, frage ich mich. Die Aufmerksamkeit, dick und dicht wie Bepanthen, mit der ich vollgekleistert und eingeschmiert werde und die ich dankbar aufsauge, sie wird mir nicht umsonst und ewig zuteilwerden … Trotzdem lasse ich mich ein, lasse mich gehen und mir mein Ego wie Segel aufblasen von all der heißen Luft, im vollen Bewusstsein, dass in mir eine Teilung im Gange ist, eine Spaltung, da ist mehr, ein Meer aus Mehr, ein Ozean, eine Tiefe, in der es schnell kalt und schwarz wird. Blau sein, blau sehen, blauäugige Jungs; die Oberfläche ist dünn. Meine weltliche Schale treibt es bunt und schwimmt, schwimmt oben und lacht und lügt, so gut sie kann. Was ich denke und tue, wie ich fühle und handle, Inneres und Äußeres sind nicht mehr eins. Aus Rissen werden Spalten, werden freischwimmende Schollen; es bilden sich Inseln, zwischen denen ich hin- und herspringe, eine Pendlerin zwischen Persönlichkeiten. Winde und Strömungen kommen auf, vergrößern die Abstände, erschweren das Pendeln.