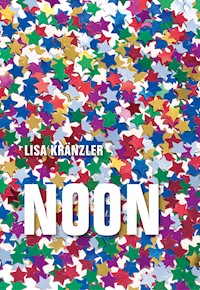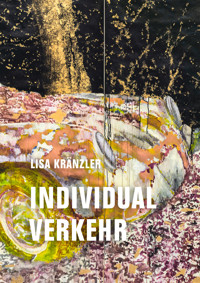Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman "Nachhinein" erzählt von der Entwicklung zweier Mädchen und ihrer schwierigen Freundschaft. Zwischen beiden gibt es einen wesentlichen Unterschied: Die eine wächst gut behütet auf und wird geliebt, darf sogar rebellisch sein, die andere hingegen kommt aus schwierigen sozialen Verhältnissen, wird angegriffen und in ihrer Familie missbraucht. Bald verändert dies auch die Beziehung der Mädchen zueinander, die von kindlicher Liebe, bald auch von Eifersucht und erwachender Sexualität, von Machtspielen und Grausamkeit geprägt wird. Bis die Ereignisse außer Kontrolle geraten ... Im Juli 2012 erhielt Lisa Kränzler den 3sat-Preis beim Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb für einen Auszug aus diesem Roman. "Ein sehr intensiver und durchkonstruierter Text, dabei aber nicht spröde - hier wird der Leser wieder seinen eigenen Kindheitserfahrungen ausgesetzt", meinte seinerzeit der Juror Paul Jandl. "Nachhinein" war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2013.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lisa Kränzler
NACHHINEIN
TEIL 1
1.
Unwahrscheinlich, dass sich das Gefühl ihrer frisch gesprossenen, streichholzkopfkurzen Haarspitzen unter meiner Handfläche nach mehr als 24 Jahren noch wiedererwecken lässt …
Glücklicherweise schert sich meine Erinnerung einen Dreck um Wahrscheinlichkeiten und lässt meine kleine, dickliche Hand wieder und wieder über ihren großen, kurzgeschorenen Kinderkopf streichen.
Im Hintergrund grölen gnadenlose Zwergstimmen einen heute harmlos anmutenden Spitznamen: »Igel«.
»Igel-Igel-Igel!«, tönt es aus Kinderkehlen, die so lange am I ziehen, bis einIHHHdraus wird, – wodurch aus dem Igel einIHHHgel und somit etwas Ekelerregendes wird.
Später hat sie behauptet, ich sei die Einzige gewesen, die sie beim Namen, ihrem richtigen Vornamen, der vielleicht Jasmin, vielleicht Celine, vielleicht Justine lautete, gerufen hat, dass meine Weigerung, es den anderen gleichzutun und ihr einen Tiernamen zu geben, unsere Freundschaft begründet hat.
Ich hingegen halte es für viel wahrscheinlicher, dass mich das pelzige, perserteppichflauschige und dabei doch seltsam störrische Kitzelgefühl, das ihr Haar meiner Handfläche bescherte, geradezu magnetisch angezogen und eine Lust auf mehr in mir ausgelöst hat, mehrmaliges Streichen, mehrmaliges Fühlen, mehrmaliges Genießen, dieser mir bisher unbekannten Oberflächen- und Haarstruktur.
Folglich würdeICHsagen, dass der Grundstein unserer Freundschaft keineswegs meine Enthaltsamkeit in Sachen Hänselei, sondern vielmehr jener Bordstein gewesen ist, der ihr, kurz vor Kindergarteneintritt, den Schädel gespalten hatte.
Ich kenne den Hügel und auch die Stelle genau, an der ebendies geschah und die wir in den darauffolgenden Jahren oft mit roten X-en aus Straßenkreide markierten. Den Unfallhergang, den ich nur aus Erzählungen kenne, und das Bild einer furchtlosen Kamikaze-Jasmin oder Celine oder Justine auf einem klappernden, trotz Stützrädern wenig verkehrssicheren Zweirad, kann ich jederzeit, ohne die geringsten Schwierigkeiten und mit zuverlässiger Kameraschärfe, in mir aufrufen. Das Unfallbild, dessen Existenz ich der erwähnten Weigerung meiner Erinnerung, sich um Wahrscheinlichkeiten zu scheren, verdanke, verteidigt seinen Platz in meinem Bilderspeicher seit unglaublichen 24 Jahren, während andere »live« miterlebte Bilder längst im Trubel der Lebendigkeit verloren gegangen sind. Die Ursachen für diesen Verlust an Bildmaterial sind bislang ungeklärt und meine These, dass die durch Stoffwechselprozesse erzeugte Wärme Gespeichertes langsam zersetzt, dass mein Hitzkopf auch die hartnäckigsten Bildträger einschmilzt und verkocht, verdampft und verflüssigt, ist noch unbewiesen.
Wenn mich, wie jetzt, plötzlich die Erkenntnis überfällt, dass die Zahl der Eindrücke, die den täglich stattfindenden Auslöschungen zum Opfer fallen, undarstellbar ist, dann erschweren Schwindelgefühle, kurze, heftige Erschütterungen des inneren Gleichgewichts, das Weiterleben. Ich schwanke, taumle vorwärts und kralle mich zuletzt, wie immer, an einer der wenigen unzerstörbaren Säulen meiner Erinnerung fest, diesen vereinzelt in der Hirnlandschaft für mich strammstehenden Gewissheiten, die nur von Demenz und Alzheimerscher Krankheit gefressen werden können, und zu denen auch das Bild deines fast fatalen Sturzes gehört.
Die Suche nach anderen Stützen, Krücken oder Geländern verlief bislang erfolglos.
2.
Schädelbasisbruch und bumsen.
Zwei Worte, die ich durch sie gelernt, gehört, begriffen habe, deren Besitzerin sie, Jasmin oder Celine oder Justine, war, ist und bis in alle Zukunft sein wird.
Besonders bemerkenswert: Beide Buchstabenkombinationen erzählen von großen Durchbrüchen, vom Austreten von Blut-, Gehirn-, Gleit- oder Samenflüssigkeiten, von klaffenden und glitschigen Spalten, vom Eindringen und Aufnehmen, Biegen und Brechen, Leben und Tod, vom frontalen Aufprallen und von horizontalen Stößen, vom Bums, vom Krachen und Quietschen, vom Risiko, Hinfallen und Zufällen, vom Erwachsenwerden, von hart auf weich und hart auf hart und von der Allmacht der physikalischen und chemischen Gesetze, denen unser Menschsein von Anfang an unterworfen war, ist und sein wird.
Bumsen …
Ein Wort mit vielen Verwandten, unter denen der »Zeugungsakt« wohl eher zu den entfernten Vettern zählt …
In meiner persönlichen Geschlechtsverkehr-Wortfamilie halten sie sich dennoch an den Händen, sodass der Sprung von »bumsen« nach »Zeugung« meinen Gedanken nur wenig Sportlichkeit abverlangt. Natürlich ist dies noch längst nicht das Ende der von »bumsen« ausgelösten Gedankenverkettung, und normalerweise drängt sich an dieser Stelle der Begriff »Empfängnis« auf, der mich unweigerlich zum »Mutterbauch« und, da mein Aufenthalt dort sich der Erinnerung entzieht, stattdessen zum Gesicht meiner Mutter zurückführt.
Die Gesichter und Bäuche unserer Mütter hätten unterschiedlicher nicht sein können.
Auf der einen Seite der Straße, die vielleicht Hirsch-, vielleicht Reh-, vielleicht Frosch- oder Eulenstraße hieß, Gesicht und Bauch der Akademiker-Mutter, auf der anderen dagegen Züge und Nabel der Arbeiter-Mutter. Hüben Lehrplan, drüben Schichtplan; da Eigenheim, dort Mietwohnung; rechts Standpauke, links Arschvoll. Frischobst und Frischluft und Kompost im Osten, Dosen und Kippen und Ascher im Westen.
Nichtsdestotrotz verbanden unsere so verschiedenen Mütter einige nicht unwesentliche Gemeinsamkeiten: Auf beiden lastete die Herkulesaufgabe der Instandhaltung von Haus, Hof und Familienfrieden, wobei sie ihre chronisch übermüdeten Gesichter stets mit einem tapferen Lächeln schmückten …
Was sie, Jasmin oder Celine oder Justine und mich, das Mädchen, deren Name vielleicht Lotta, vielleicht Luisa, vielleicht Luzia lautet, jedoch am meisten faszinierte, und was uns unserer kindlichen Meinung und Überzeugung nach regelrecht zur Freundschaft, wenn nicht gar Schwesternschaft, verpflichtete, war die Tatsache, dass beide Mütter auf Namen getauft worden waren, deren Ursprünge in der Botanik wurzeln. Sowohl auf der Ost- als auch auf der Westseite der Hirsch- oder Reh-, Frosch- oder Eulenstraße, blühte es auf Briefen, Buchdeckeln und Dokumenten, und wenn unsere Väter Wünsche hatten, riefen sie einen Blumennamen, der vielleicht Iris, vielleicht Margarita, vielleicht Rose oder Susanne lautete.
Die Logik deiner Locken.
Selbstverständlich mussten ihr Locken wachsen.
Bereits wenige Wochen nachdem sie ihren geborstenen Schädel rasiert und zusammengeflickt hatten, also zunächst von störenden, blutverklebten Haarmassen befreit, und diese durch die feingezackte, knotige Linie des sterilen, in der Chirurgie eingezogenen Spezialfadens ersetzt hatten, machte sich die gekräuselte Unregelmäßigkeit bemerkbar, die wohl das Resultat der gewaltigen Erschütterung, des ungeheuren Aufpralls war.
Oft stelle ich mir die noch Monate nach dem Unfall leise zitternden Haarwurzeln vor, jede einzelne durchruckelt von kleinen Nachbeben, die an das große, das verheerende Unglück gemahnen. Eine Tausendschaft haariger Erinnerungsstützen, welche unbedachte Übermütigkeiten und Überstürzungen verhindern wollen. Um auf die permanente Bedrohung der Schädelplatte durch plötzliche, gewaltsam verursachte Erschütterungen rechtzeitig aufmerksam zu machen, senden sie korkenzieherförmige Warnhinweise aus, die über Ohren, Schläfen, Stirn und Augen fallen.
Warnende Wellen.
Ein hellbraunes bis mittelblondes Meer aufgezeichneter Schwingungen, die einen widerspenstigen Nimbus um ihr Gesicht legten. Ein Heiligenschein, unter dem es im Sommer entsetzlich heiß wurde, dessen Widerborstigkeit beim Kämmen die Arbeiter-Mutter zum Fluchen und das Mädchen, ängstlich geduckt unter den Hieben der Bürste, zum Weinen brachte.
3.
Die Kindergärtnerinnen müssen das zukünftige gewellte Strahlen vorhergesehen haben, als sie die Kleine mit dem Stoppelkopf der »Sonnengruppe« (»rote Gruppe«) zuteilten.
Mich dagegen steckten sie in die sogenannte »Mondgruppe« (»gelbe Gruppe«), was mich etwas betroffen machte, als ich herausfand, dass der Mond in Wirklichkeit eine Art Almosenempfänger der Sonne ist, ein passiv Angestrahlter ohne leuchtende Wirkkraft.
Waren wir, die »Gelben«, lediglich kurzbeinige Mitläufer?
Eine Bande Abglanz?
Oder sollten wir, die wir allesamt aus gutbürgerlichen oder neureichen Familien stammten, uns so früh wie möglich in der Kunst des Understatements üben und den Anderen, den Arbeiter- und Ausländerkindern, großherzig und uneigennützig den Vortritt in unserem katholischen Kindergarten-Sonnensystem überlassen, sie einmal im Zentrum, im Mittelpunkt stehen lassen, bevor sie in unseren gutgehenden mittelständischen Betrieben als kleine und kleinste Rädchen arbeiten würden?
Wer will, wenn es um Namen, Farben und Gruppenzusammenstellungen geht, an Willkür oder Zufälle glauben?
Ich nicht.
Die Zuweisung ihres Stoppelkopfes zur Sonnengruppe war genauso wenig zufällig, wie die Besetzung der Rollen unseres, im letzten Kindergartenjahr aufgeführten, Theaterstücks.
Das Schauspiel, eigentlich mehr Musical und Tanz als Theaterstück, das wir Ende Juli vor Müttern, deren Fingerkuppen noch zerstochen vom Nähen der Kostüme waren, Geschwistern und vereinzelten, wahrscheinlich arbeitslosen, Vätern aufführten, hieß »Safari«.
IHHHgel/Stoppelkopf/JasminCelineJustine übernahm den Part einer »Wilden« oder, korrekter ausgedrückt, einer »Stammeskriegerin«. Ich hingegen wurde von den Erzieherinnen ermutigt, die Rolle des »Safari-Guides« zu übernehmen, was mich zum einzigen Kind mit Sprechrolle, Lampenfieber und Auswendiglernzwang machte …
Während Stoppelkopf sich also nach beliebenWILDund ungestüm gebärden durfte, musste ich einen unhandlichen, gefährlich scharfkantigen Jeep aus Pappkarton über die Bühne schleppen und nebenbei Verse rezitieren:
»… aus dem großen, blauenNIIIIIILE
kommen jetzt dieKROKODIIIIIILE!!«,
brüllte ich die Zuschauer voller Stolz an. Um den Zuschauern außerdem die bestmögliche Sicht auf meine neue, extra für diesen Anlass erstandene Oberbekleidung zu ermöglichen, galt es, den hellblonden Jungen, der den männlichen Safari-Guide verkörpern sollte, mit Hilfe des Ellbogens möglichst weit vom Jeepfenster abzudrängen. Bei dem meiner Meinung nach äußerst sehenswerten Kleidungsstück handelte es sich um eine fingerhutfarbene, also dunkelviolette Bluse, deren Stoff sich nach einem kurzen Weg von fünf Knöpfen in »zwei Zipfel zum Knoten« teilte und dank dieser Besonderheit ungehinderte Sicht auf meinen Nabel ermöglichte. Jene handbreite Nacktheit empfand ich als überaus spektakulär, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass bauchfreie Tops für mich der Inbegriff von Sexiness waren.
Da ist es! Das Reizwort mit vier Buchstaben, hier mit kesser -ness-Endung zum Substantiv geformt. Schamlos quetscht es sich zwischen modale Präposition und Hilfsverb:DASWort, das in allen Vokabeln, die ein X in sich tragen, von nun an immer mitklang.
Sexy.
Darunter verstand ich das schlängelnde, geschmeidige, katzenhafte Körpergefühl, das sich einstellte, wenn ich die glatten, sanft geschwungenen Hautlandschaften meines Körpers abfuhr, und das durch die Berührung ausgelöste Bedürfnis nach mehr Fingern, fremden Fingern.
Es, Eh, Ix, Ypsilon.
Mysteriöses Erwachsenenwort, das irgendwie mit der Entdeckung der Vollkommenheit der eigenen Form und dem Vorsatz, diese mit mehr als zwei Händen zu erforschen, zusammenhängen musste.
Aber das ist nicht, nein, dasKANNunmöglich alles sein …
Die Ahnung, dass das, was ich fühlte und mit dem X-Wort verband, nur einen Teil seiner Möglichkeiten erfasste und meine Erfahrungen lediglich Andeutungen und Hinweise auf die tatsächliche, ausgewachsene Bedeutung des WortesVERKÖRPERTEN, verstärkte sich mit jedem gelebten Jahr. Irgendwo in den verwinkelten Tiefen zukünftiger Abgründe, fernab vom Scheinwerferlicht der Selbstdarstellung, lauerte noch mehr: ein dunkles, leicht bösartiges, immer durstiges Carnivor-Mehr, das sich alles und jeden einverleiben würde; ein nimmersattes Kriechtier, das sich im Blutrausch vor lauter Fleischeslust den Kiefer ausrenken und eines Tages an den Knochensplittern seiner gierig verschlungenen Beute ersticken würde. Solch ein Tier spürte ich unter meinen Haut- und Muskelschichten heranwachsen und auf den Moment seiner Entfesselung warten.
Doch zurück zur Safari.
Ich erinnere mich, dass der Anblick der übrigen, unter plumpen Tiermasken aus Pappmaschee versteckten Kinder unsexy war und mich abstieß.
Die Mädchen und Knaben mit den grauen Fladen an den Ohren, die sich umständlich verrenken und die Elefantennase mittels ihrer Arme darstellen mussten, empfand ich als besonders unattraktiv. Auch die Darsteller der Riesenschlange, insbesondere die Füllsel, die weder das Kopf- noch das Schwanzende der Schlange verkörperten, hatten nicht den Hauch einer Chance, sich meine Sympathien zu erspielen.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich den ein oder anderen neidischen Blick auf JasminCelineJustines kurzes Kriegerinnen-Baströckchen geworfen habe …
Nicht unwahrscheinlich, dass mein begehrliches Schielen in Richtung Mini-Bastrock die bittere, zum Ausspucken reizende »Man-kann-nicht-alles-haben«-Sprechblase aus dem Mund einer Erzieherin in mein Gesicht platzen ließ, womit sie mir zu verstehen geben wollte, dass man sich wohl oder übel für eine der beiden Daseinsvarianten entscheiden müsse, da der Reiz eines verwilderten, nackten Arsches und die Kultiviertheit vorgetragener Verse nicht zusammengehen.
»Nicht alles haben …«
Wie hätte mir, dem kleinen, bauchfrei Gedichte rezitierenden, von einem ausgeklügelten Triebsystem gesteuerten und zu diesem Zeitpunkt problemfreien Zweibeiner, dieser Satz je plausibel erscheinen können?
»Man kann nicht …«
Der Unsinn der Erwachsenen.
Ich kämpfte meine Neidgefühle mit der nüchternen Feststellung nieder, dass das Baströckchen ohnehin hinter den tarnfarbenen Jeeptüren verschwunden und somit für das Publikum unsichtbar geblieben wäre. Meinen nackten Bauch dagegen sah jeder. Die Wahl zwischen Nacktheit oder Kultur erübrigte sich.
Um die scheinbare Unbeschwertheit der Krieger, Schlangen, Elefanten und Krokodile – von ein paar läppischen Refrains abgesehen zur Sprachlosigkeit verdammt – hatte ich meine plump kostümierten Kameraden nie beneidet.
Die Vorstellung verlief ganz nach meinem Geschmack.
Mein blonder Co-Moderator überließ mir, nachdem er bereits in den ersten Spielminuten seinen Text verpatzt hatte, bereitwillig Fensterplatz und Moderation. Mit hochrotem Kopf verzog er sich in den Fond des Pappjeeps und betätigte sich fortan schweigend als Heckantrieb unseres 4-Feet-Drives.
Das lag ihm bedeutend besser, fand ich, und vergaß ihn.
4.
Meine Becken- und Schambeinknochen dort, wo das Glück der Erde liegt.
Stolz spanne ich Rücken und Bauch an, halte mich gerade und fest, hier oben.
Ich sitze in deinem Hohlkreuz, die Unterschenkel, vorantreibend oder zurückhaltend, gegen deine schon zaghaft gerundeten Hüften gepresst. Rechts und links umwickeln meine schwitzigen Fäuste schwarze Schnürsenkelzügel, die mit dem Gürtel, den ich dir, eng wie ein Kropfband, um den Hals gelegt habe, verknotet sind. Damit deine wiehernden Laute, diese Folge kurzer, abgehackter Töne, die in hoher Tonlage beginnen und in der Tiefe enden, klar und schallend bleiben, lenke ich vornehmlich mit einer Kombination aus Schenkeldruck, Zisch- und Schnalzlauten. Ich greife in deine gelockte Mähne, raune Richtungswechsel, feuere dich mit jubelnden »HÜAH-HÜAH«-Rufen an.
Widerspenstige Launen, die ich mit zügelndem Ruck züchtige, sind zum Glück selten. Denn der seufzende, ein wenig dumpfe, wie ein ersticktes Husten klingende Abwürgeton, den du im Moment der Maßregelung von dir gibst, klingt unangenehm unfein. Ein solches Geräusch ziemt sich nicht für edle Tiere.
»HÜAH!HÜAH, mein Ross!«
Wir galoppieren über grüne Teppichlandschaften, rasten im Schatten der Eckbank. Du steckst die Nase in deinen, mit Cornflakes gefüllten, Futterbeutel.
»Ja … Friss schön! Bist ein braves Mädchen!« Lobend tätschle ich dein jeansblaues Hinterteil.
Dann wird es Zeit für ein wenig Sprungtraining.
Mithilfe einiger mühselig vom Stoß aus dem Garten gehievter Holzscheite, an deren Nässe der Teppich wie Löschpapier saugt, errichte ich einen komplizierten Parcours aus Steil-, Hoch- und Weitsprüngen. Die Oberflächen der nach Regen, Harz und Fäulnis duftenden Tannenholzblöcke sind Minenfelder aus Spreißeln, Mäusekacke und Kellerasseln.
Ich wische mir die harzigen Hände an einem Sitzkissen ab.
Beginn der Trainingsstunde.
Deine Sprünge sind nicht die eines Reittiers … Die langen, kräftigen Hinterläufe, mit denen du dich abstößt, und die kürzeren, huflosen Vorderbeine lassen dich wie einen fetten Feldhasen mit kupierten Ohren aussehen. Irgendwie schwerfällig.
Kaum ein Hindernis, das du nicht umreißt.
Dir hinterherzuräumen, ist langweilig.
Im Schritt und im Trab, wenn sich der Vorder- und darauf der entgegengesetzte Hinterlauf auf die immer gleiche Weise heben und senken, gefällst du mir besser.
Plötzlich weiß ich, was dir fehlt.
»Warte, ich hol kurz was!«
Bald darauf bin ich zurück.
Ich, der Schmied.
Mutters Küchenschürze schlackert mir um die Beine. Mit dem Kartoffelstampfer in der Linken und einem 3000er edding in der Rechten, nähere ich mich breitbeinig dem Tier, das es zu beschlagen gilt.
Bereitwillig lässt du dir Handflächen und Fußsohlen mit wasserfesten, nach Lösungsmittel stinkenden Hufeisen verzieren. Zur Sicherheit wird jeder neue, U-förmige Pferdeschuh mit kurzen, präzisen Kartoffelstampfer-Hammerschlägen doppelt und dreifach festgeklopft.
Der schweigsame, schmerbäuchige Schmied, dieser ungehobelte Klotz von einem Mann, der Menschen meidet und die Gesellschaft der Tiere vorzieht, ist’s zufrieden.
Nach Feierabend wird er ins Wirtshaus marschieren, wo ihm die dralle brünette Bedienung wie jeden Abend sein Herrengedeck serviert.
Im Frühjahr wäre noch Zeit für eine Prügelei in der Schankstube, einen Ausritt oder eine kurze, tierärztliche Untersuchung deiner kleinen, milchweiß glänzenden Füllenzähne gewesen.
Aber leider ist es Herbst, und bei Sonnenuntergang musst du zu Hause sein.
5.
Über den Rosensträuchern wabert eine süßliche Wolke Lockstoff. In jeder Blüte ein Brummen.
Es ist ein besonderer Tag.
Heute werden wir das Ritual vollziehen, den heiligen Akt, der uns endgültig und für alle Zeiten in ewiger Schwesternschaft aneinanderschweißen wird.
Unsere Augen spiegeln einander ernste, feierliche Mienen.
Der Dorn will mit Bedacht gewählt sein.
Ich entscheide mich schließlich für einen, der mir besonders blutdurstig erscheint: Einer bräunlich gefärbten Haifischflosse gleich ragt er aus der Mitte eines daumendicken Zweigs. Kleine Dörnchen folgen ihm im Gänsemarsch.
Mit chirurgischer Präzision amputiere ich das spitzgezackte Ding.
Was nun?
Ratlos sehen wir einander an.
Ein schneller, gnadenloser Streich mit dem scharfen Dorn ins Finger- oder Handflächenfleisch würde zweifelsohne den ersehnten Blutstropfen aus seiner violetten Abgeschlossenheit ans Licht sprudeln lassen …
Der Gedanke an Selbstverletzung ruft einen plötzlichen, heftigen Widerwillen in mir wach. Ich knabbere nicht an Nägeln, kratze nicht an Schnakenstichen, mag meine Krallen, liebe meine Unversehrtheit.
Um die Verletzung zu vermeiden, suche ich meine Arme nach alten Wunden ab. Unweit vom Ellbogen werde ich tatsächlich fündig und beginne, mit dem Dorn an dem alten, schon im Abfallen begriffenen Wundschorf herumzuschaben.
Ein kurzer Seitenblick zeigt mir, dass du dich für eine ähnliche Methode entschieden hast. Genug Auswahl hast du ja.
Nicht lange, und die zerbissene Nagelhaut deines rechten Daumens blutet übermütig drauflos.
Bei mir dagegen: Nichts.
Unter der Kruste hat sich bereits neue, helle, heile Haut gebildet.
Erwartungsvolle Blicke von rechts.
Ich schabe verbissen weiter.
Am Ende meines Kratzers stoße ich auf ein paar Millimeter nässendes Rosa, welches ich so lange bearbeite, bis es sich den Anschein gibt, ein kleines Bluten zu sein.
Das muss ausreichen.
Ich beeile mich, deinen Daumen gegen meinen Unterarm zu pressen. In dieser, etwas merkwürdigen Position verweilen wir sodann mehrere Minuten.
Ob der rote, schmierige Fleck, der, als du schließlich deine Hand zurückziehst, meinen Kratzer wie ein Ausrufezeichen aussehen lässt, von dir oder mir oder uns beiden stammt, ist nicht mehr festzustellen.
Um jeden Verdacht auf Blutsbetrug im Keim zu ersticken, wies ich mehrmals eifrig darauf hin, dass meine Haut, egal ob unversehrt oder verwundet, dein Blut ohnehin »wie Wasser« an-, auf- und eingesaugt habe. Zur Bekräftigung entrollte ich den Gartenschlauch und ließ einige Wassertropfen auf meinen Handrücken fallen.
30 Sekunden später schallte ein triumphierendes »Siehst du!? Alles weg!!« durch den Garten.
Der Beweis meiner Redlich- und Weißwestigkeit war mindestens genauso wichtig wie die Erhaltung meiner Unversehrtheit. Zu lügen bedeutete, meinen Namen mit unschönen Schleifspuren zu besudeln, wie man sie aus den Kloschüsseln öffentlicher Toiletten kennt.
Die Rufnamen von Gewohnheitslügnern stellte ich mir äußerst schäbig, mit abblätterndem Lack und bräunlichen, wie Schimmelpilz wuchernden Rostwolken vor. Hatte man die Glanzschicht, welche die Namen aller Wahrheitsliebenden schützend umhüllt, einmal verloren, musste auch das Innere anfangen zu bröckeln und irgendwann unweigerlich zu Staub zerfallen.
Ich war mir sicher, dass der Zerfall oder Verlust des Wortes, das von Geburt an das eigene Ich benennt, Ende, Auslöschung und Tod bedeuten mussten.
Um meine These auf ihre Wahrheit hin zu überprüfen, unternahm ich, vor dem großen Spiegel im Elternschlafzimmer sitzend, einen Selbstversuch: Zunächst formte ich mithilfe eines Füllfederhalters und einigen sorgfältig geschwungenen Schreibschriftschlaufen meinen Vornamen. Anschließend näherte ich mich mit dem Tintenkiller dem letzten Vokal, den ich für das Buchstaben-Pendant meiner Füße hielt.
Mit Adleraugen beobachtete ich mein Spiegelbild, während der Killer die Linie löschte – und obwohl ich keine Veränderung meines Abbilds und auch beim Abtasten keinerlei Ich-Schwund entdecken konnte, traute ich mich nicht über das A hinaus.
Als die Schlafenszeit heranrückte, entschied ich, dass mein nächtliches Ich unmöglich hinten-ohne ins Traumland entlassen werden durfte, nutzte die Schreibfunktion des Tintenkillers und reanimierte meine weibliche Endung. (Sie war blau, atmete aber.)
6.
Mir waren Worte immer ernst.
Wahrscheinlich konnte ich es deshalb nicht ertragen, wenn JasminCelineJustine mit einem knappen »Ich muss aufs Klo« aus dem Spielzimmer lief, dann unten heimlich die Schuhe anzog und grußlos nach Hause verschwand, während ich auf dem Teppich saß und sehnsüchtig ihre Rückkehr erwartete.
Nachdem sich dies ein- oder zweimal ereignet hatte, machte ich es mir zur Gewohnheit, die Geräusche, die sie beim Gang zum Klo verursachte, aufmerksam zu prüfen. Sobald ich irgendwelche Unregelmäßigkeiten feststellte, schlich ich zur Treppe und spähte durch das Geländer nach unten.
Eines Tages war es so weit: Schon den ganzen Nachmittag hatte eine gewisse Missstimmung zwischen uns geherrscht. Halbherzig und lustlos waren verschiedene Spiele angefangen und abgebrochen worden, und ich glaube, ich habe einige ihrer Alternativvorschläge recht rigoros abgelehnt …
Schließlich der Moment des vorgetäuschten Klogangs!
Meiner Vorahnung folgend näherte ich mich, geduckt wie ein Kater auf der Pirsch, dem Treppengeländer.
Da hockte sie! Die Verräterin! Klaubte ihr Schuhwerk aus dem bunten, ledrigen Haufen vor der Garderobe und begann, sich die Schnürsenkel zuzubinden.
In meinen Schläfen pumpte und pochte es, als hätte sich mein Herz durch die Halsschlagader bis in meinen Kopf gequetscht.
Drei, vier waghalsige Treppensprünge und schon stand ich, die Hände in die Hüften gestemmt, vor JasminCelineJustines zum Gehen verschnürten Füßen.
Wütend, zornig, die Kieferknochen so hart, dass sich die Worte nur zischend durch Zähne und Lippen pressen ließen, fuhr ich sie an: »Willste wieder abhauen?«
Keine Antwort. Stattdessen feindseliges Schweigen.
Mit schlitzigen Augen, die linke Oberlippenhälfte verächtlich Richtung Nase gezogen, spie ich ihr ein letztes »Feige Sau!« ins Gesicht, bevor ich auf dem Absatz kehrtmachte und triumphierend zurück ins Spielzimmer marschierte.
Mich würde keiner bescheißen, mich nicht!
Dinge, die dich nicht berühren.
Mein Klavier.
Strenggenommen ist es gar nichtMEINKlavier.
Ursprünglich war es im Besitz meiner Urgroßmutter, die das gute Stück, nachdem sich ihre Schwerhörigkeit mit zunehmendem Alter in absolute, undurchdringliche Taubheit verwandelt hatte, meiner Mutter vererbte.
Zu dem Zeitpunkt, als ich auf dem hellhölzern-glänzenden Instrument mit den elfenbein- und lakritzfarbenen Tasten die ersten Töne anschlug, hatte meine Mutter jene mir gänzlich unbekannte Großmutter längst beerdigt und ihr eigenes Klavierspiel, bis auf ein holpriges »Für Elise«, fast vollständig verlernt.
Das Klavier hatte seinen festen Platz auf der mit grünem Teppich ausgelegten Galerie, die nicht »Galerie« sondern »Spielzimmer« hieß, als ich zum ersten Mal auf den lederbezogenen Hocker kletterte, den Deckel anhob und den Zeigefinger auf einer zufällig ausgewählten Taste niedergehen ließ. Mit jenem ersten Anschlag erhielt das Spielzimmer einen fünf Buchstaben starken Zuschlag und wurde kurzzeitig als »Musikspielzimmer« bezeichnet, ein Ausdruck, der wegen seiner Spitzfindigkeit nicht sehr lange verwendet wurde und schnell aus dem aktiven Sprachgebrauch der Familie verschwand. Seitdem nennen wir die Galerie (schlicht, einfach und architektonisch korrekt) wieder »Galerie«.
Auf dem über dem Wohnzimmer thronenden Balkon, zu dem sich der direkt unter dem Dach verlaufende Galeriegang verbreitert, stand und steht es also: mein Klavier.
Ich verbringe viele Stunden vor dem breiten, 88 Zähne starken Maul, welches meinem eigenen Mundwerk nicht unähnlich sieht.
Mein Milchzahngebiss unterscheidet sich von den Klavierzähnen darin, dass meine »schwarzen Tasten« Leerstellen, löchrige Unterbrechungen im Weiß sind, während im Klaviergebiss die schwarzglänzenden Streifen ein ganzes Stück über die Ebene der sorgfältig aneinandergereihten weißen Tasten herausragen.
Natürlich weisen das Piano und ich noch eine ganze Reihe weiterer unterschiedlicher Eigenarten auf. Anstelle der vielen kleinen Hämmerchen, von denen ich weiß, dass sie sich im Bauch des Klaviers befinden, und deren Aufgabe es ist, unermüdlich gegen gespannte Saiten zu schlagen, besitze ich nur ein einziges, feucht-rosa Zungending, das meine Töne auf dem Weg nach draußen zu Worten formt.
Was ich nicht verstehe, ist diese Sache mit den sogenannten »Stimmbändern« …
Wenn ich beim Sprechen die Hand an die Kehle lege, spüre ich das leichte, summende Schwingen jener Bänder, die meine Saiten sind. Das Rätsel, wie meine Zunge, dieses rosarote, fleischige Hämmerchen, das doch so weit vom Kehlkopf entfernt hinter zwei Zahnreihen liegt, diese Bänder zum Schwingen bringt, bleibt unlösbar, solange sich mein Korpus nicht wie der meines hellhölzernen Instruments aufklappen und beim Tönen beobachten lässt.
Aber vielleicht muss man gar nicht alles wissen.
Jedenfalls liebe ich das Klavier, habe es vom ersten Ton an geliebt.
Ich halte es für weitaus klüger als die Menschen. Immerhin besteht sein Alphabet aus 52 dicken und 36 schmalen Buchstaben, während das Alphabet, welches wir in der Schule lernen, nur 26 zu bieten hat. Hinzu kommt, dass sich die im Klassenraum der 1a gelernten Zeichen nur sehr mühsam, und manchmal ohne Sinn zu ergeben, zusammenfügen lassen. Auf dem Klavier dagegen kann manALLESaneinanderreihen, ist alles Musik …
Anfangs habe ich mich nicht getraut, die Stimmen weit auseinanderliegender Tasten miteinander zu vergleichen. Ich war mir nicht sicher, ob sich nicht die piepsigen, hohen Stimmchen der rechten Seite vor dem unheimlichen, tiefen Grollen des linken Klaviaturendes fürchten würden.
Allerdings wurde mir schnell klar, dass sie alle, die hellen wie die dunklen, verschwägert, verschwistert und verwandt sind; dass sie einen großen Clan bilden, zu dessen Anführerin ich werde, sobald ich meinen Platz auf dem Hocker einnehme.
In meiner Experimentierphase, bevor mich meine Eltern zu Frau Lichtel in den Unterricht schickten, nutzte ich jede elternfreie Minute, um die verschiedensten Griffe auszutesten: den Einfinger-Griff, den Zwei-, Drei- und Zehnfinger-Griff, den Faust-, flache Hand- und Unterarm-Griff und schließlich sogar den Kinn-, Gesichts-, Zungen- und Nasen-Griff.
Um herauszufinden, welche Laute mein Körper und die Gemeinschaft aller Oktaven miteinander produzieren würden, kletterte ich vom Hocker auf die Tasten und legte mich seitlich auf die Klaviatur, was einen massiven, wunderbar mächtigen Klang erzeugte. Aufgespannt zwischen dem höchsten und tiefsten Ton , hob ich die Hüfte und ließ meine knochige Seite wieder und wieder mit Karacho auf die Tasten niedersausen.
Frau Lichtel war für derartige Vor- und Anschläge leider nicht sehr empfänglich. Sie bestand darauf, dass ausschließlich mit den Fingern gespielt wurde.
Auch die Abfolge der verschiedenen Töne war nicht länger frei von mir wählbar, sondern wurde von einem speziellen Lesebuch vorgegeben, dessen linierte Seiten mit unregelmäßigen Punktemustern bedruckt waren.
Jeder einzelne der schwarzen, langstieligen Punkte, die wie Kirschen zwischen den fünf horizontal und parallel verlaufenden Linien klebten, symbolisierte eine weiße oder schwarze Taste.
Das Übersehen eines einzigen Punktes galt bereits als »Fehler«. Selbiges galt für das Verfehlen einer Taste.
Ob sich die fehlerhafte Variante, die verspielte Note, eleganter, lustiger, schräger, schiefer oder einfach nur interessanter anhörte als die vom Buch befohlene Variante, spielte dabei keine Rolle.
Hohle, gefüllte, mit Balken zu Gruppen zusammengefasste oder mit Fähnchen versehene Notenköpfe zu deuten, langweilte mich, und die herzlose Kategorisierung der Musik durch ein vollkommen fantasieloses Notensystem missfiel mir enorm.
Um den fade schmeckenden, mit den Augen zu erntenden schwarzen Kirschen zu entgehen, nahm ich die Stücke auf, indem ich Frau Lichtels vorspielende Finger beobachtete und anschließend deren Bewegungsabläufe imitierte.
Während der Klavierstunden boten sich mir zwei Perspektiven: die Vogelperspektive, von der aus ich die über schwarz-weiße Felder rasenden Lichtelschen Hände begleitete, sowie die des kleinen Froschs, schräg am Notenbuch vorbei, Richtung Regal, wo sich mein Blick zwischen den emporgereckten Rüsseln Hunderter Porzellanelefanten verfing.
Bald kannte ich sowohl Frau Lichtels altersgefleckte Handrücken, die verästelten Wege ihrer von den Handgelenken zu den Knöcheln führenden Adern, das Schimmern ihrer langen, perlmuttfarbenen Fingernägel und den Schliff des kleinen, in der Mitte ihres weißgoldenen Eherings versenkten Brillanten, als auch jedes einzelne Tier der nach Größe und Farbe sortierten Dickhäutersammlung bis ins letzte Detail.
Eine weitere negative Begleiterscheinung des freitagnachmittäglichen Unterrichts war der lange, steil ansteigende Weg zu Frau Lichtels Haus …
Notensystem, Altweiberhände, Porzellankitsch, anstrengender Fußweg – die Klavierstunde entpuppte sich als lästige Pflicht und ärgerliche Zeitverschwendung.
Wie gerne hätte ich jene Stunde, um die mich der Unterricht beraubte, für meine große Leidenschaft genutzt, die Geschichten und Märchen meiner Hörspielkassetten am Klavier zu begleiten, was die Erzählungen – meiner Meinung nach – vervollkommnete.
7.
»Es waren einmal drei kleine Schweinchen …«
VOMCAUSEIN,ZWEIOKTAVENNACHRECHTS.DREIDREIKLÄNGE.QUIETSCHIG.
»die wohnten mit ihren Eltern in einem kleinen Haus«
WOHNENISTMITTE.VATERSCHWEINSYMPATHISCHTIEF,MUTTERSCHWEINETWASHELLER.
»aber je größer die Schweinchen wurden …«
LAUTERWERDENDEDREIKLÄNGE.
»desto kleiner schien das Haus zu werden«
VARIATIONDESWOHNTHEMAS:ZAGHAFTE,HOHE,KURZANGESCHLAGENEPLING-PLINGS.
»Es wird Zeit, dass ihr euer Leben selbst in die Hand nehmt!«
AUFBRUCHSTIMMUNG.FINGERRASENDURCHMEHREREOKTAVENRICHTUNGFERNEUNDFREIHEIT.
»Das erste Schweinchen baute sich ein Haus aus Stroh …«
PIANISSIMO.ZARTE,PIKSENDEHALBEALSHALME.RAUSCHENINRITZEN.LUFTIGEPAUSEN.
»Das zweite Schweinchen baute sich ein Haus aus Ästen und Zweigen …«
VARIATIONDESWOHNTHEMAS.MEZZOFORTE.BEGLEITENDESKLOPFENAUFSHELLHÖLZERNEGEHÄUSE.
»Das Haus des dritten aber war aus Stein.«
STABILERFÜNFKLANG.TONAUFTONWIESTEINAUFSTEIN.
Einsatz Wolfsstimme.
DUNKLES,KNURRENDESGROLLEN.LINKEHAND.
Sein Husten und Pusten.
DRAMATISCHEHALLEFFEKTE.RECHTESPEDAL.
»Nein, oh nein! Bei den Borsten auf meinem Rücken, ich lass dich nicht ein, ich kenn deine Tücken!«
SCHRILLEPANIK.STACCATO-GEQUIETSCHE.DAS»NEIN!«EINFAUSTSCHLAG INDIETASTEN.
ZWEIMALDASGLEICHESPIEL:EINSTÜRZENDEHÄUSERUNDFLIEHENDESCHWEINCHEN.LINKEHANDWOLF-,RECHTEHANDSCHWEINCHENBEINE.RASENDSCHNELLEFINGER.BEIDHÄNDIGESNÄGELGEKLAPPER(WOLFSKRALLEN,SCHWEINEHUFE).
DERWOLFAUFDEMDACHDESSTEINHAUSES,DENSCHWEINCHEN SONAHWIENIE…
»Was sollen wir bloß tun?«
GESPANNTESTRILLERN.
Der Wolf gleitet durch den Schornstein.
EINERUTSCHFAHRTÜBERALLETASTENBISZUM»PLATSCH!«,EINHÄNDEKLATSCHENALSLANDUNGIMSUPPENTOPF.
»Er heulte einmal laut auf –«
VIELFIS.FORTISSIMO.
»dann hörte man nichts mehr von ihm.«
FINGERWEGVONDENTASTEN.
BESTÜRZTESUNDERLEICHTERTESSCHWEIGEN.
Finaler Freudentanz der Schweinchen.
TRILLERNDEDREIKLÄNGEUNDAUSGELASSENEQUIETSCHER.
Ende.
BEFRIEDIGTESGRUNZGESCHRÄUSCHAUSTIEFSTERKEHLE(OPTIONAL).
Das war gut.
Ich drücke die Stopptaste und nicke lobend Richtung Klavier. Wir verstehen uns auch ohne Noten, das Piano und ich. Ja, unsere Kommunikation verläuft in der Tat absolut reibungslos, stimmig und störungsfrei und mein Bedürfnis nach dieser bislang ungekannten Klarheit wächst von Woche zu Woche.
Inzwischen freue ich mich schon morgens auf den Nachmittag, wenn wir gemeinsam leise, laute, schöne, schrille oder schräge Tongehäuse für jedes erdenkliche Gefühl errichten …
Der einzige Makel, den ich an der Musik entdecke, ist der, dass sie an das viel zu große, viel zu schwere Instrument gefesselt ist und ich sie nur in Gedanken mitnehmen kann.
Ich wünschte, es gäbe ein Klavier für die Hosentasche.
Mit den winzigen, fühlerfeinen Fingern, die mir im Moment des Erscheinens meines Hosentaschenpianos wachsen würden, wäre das Treffen der einzelnen Miniaturtasten nicht weiter schwer.
Fortan könnte ich jeden meiner Schritte mit den herrlichsten Melodien unterlegen, und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis sich die Kinder wie beim Rattenfänger an meine Fersen heften würden.
Jene bunte Schar, die meine Kompositionen einmal jubelnd und mit Rosenblättern werfend empfangen wird, vielleicht versteckt sie sich bereits heute, ängstlich und andächtig lauschend, in meinem Schatten und ich bräuchte mich nur umzuwenden, um –
Die Schreie aus dem unteren Stockwerk klingen eher bedrohlich als fröhlich.
Es ist die Stimme meiner Mutter.
Ich soll mit dem Lärm aufhören und anständig üben.
8.
Sechs Kätzchen.
Ein ganzer Wurf, Fellknäul um Fellknäul an der Scheunenwand zerschmettert.
Nur das siebte nicht.
Der Bauer macht das nicht zum ersten Mal. Er hat Übung, das sieht man genau.
Mein Blick folgt seiner schwieligen Pranke in den Katzenkorb. Dicke Finger zwicken ein Nackenfell, ziehen und zerren dran.
In der Luft strampelt was.
Jetzt holt er aus. Nicht weit, nur weit genug.
Der vom Misten, Ernten, Hieven und Halten gestählte Arm schleudert das maunzende Wurfgeschoss auf einer pfeilschnellen Geraden gegen die ziegel- und katzenblutrote Wand.
Im Korb kneifen die Todgeweihten ihre klebrigen Äuglein zusammen, als könnten sie’s nicht mit ansehen.
Die Angst ist blind und getigert, flauschig und kurzschwänzig, schwarz und weiß.
Das erste vierbeinige Geschoss, vielleicht ein Brüder-, vielleicht ein Schwesterchen, prallt von der Wandfläche zurück in den Raum, hüpft über den Betonboden wie flache Kiesel über den Dorfweiher.
Dann liegt es still.
Manchmal, wenn sich die Bauernstiefel aus schwarzem, abwaschbaren Gummi nicht sicher sind, wenn’s unterm Pelz verdächtig zuckt, dann fackelt der Absatz nicht lange. Ein einzelnes, wütendes Aufstampfen genügt. Schon ist’s geschehen.
Aus dem geknackten Schädelchen tritt Hirn wie Brät aus einer geplatzten Wurst. In die Rillen des Profils quillt eine blutige, mit Knochensplittern versetzte Masse.
Der komplexe Vorgang aus Greifen, Werfen und Treten erfordert volle Konzentration.
Mein Einschleichen bleibt unbemerkt.
Ich warte auf den nächsten Wurf und während er hingeht, nachsieht, nachtritt, greife ich zu und rette dich, wie einst die Pharaonentochter den Moses, aus dem Körbchen.
Natürlich kann ich dich, die du anderthalb Jahre älter, größer und schwerer bist als ich, nicht den ganzen Weg von Sulpach bis nach Hause tragen. Wir könnten Rollen tauschen … Aber das willst du nicht.