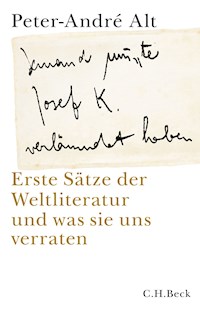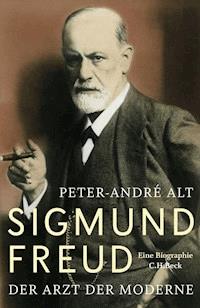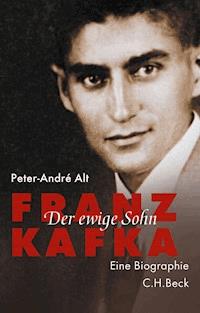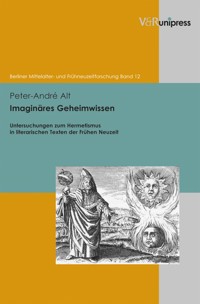19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die Universität ist eine schwierige Institution, zugleich anarchisch und von oben gesteuert und seit 60 Jahren permanent reformiert. Warum aber erweist sie sich trotzdem immer wieder als so vital? Peter-André Alt reflektiert jenseits der Rituale von Festreden und Streitschriften, was die Universität heute leisten soll und was nur sie leisten kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Peter-André Alt
Exzellent!?
ZUR LAGE DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄT
C.H.Beck
Zum Buch
Die Universität ist eine schwierige Institution, zugleich anarchisch und von oben gesteuert und seit 60 Jahren permanent reformiert. Warum aber erweist sie sich dennoch als so vital? Peter-André Alt reflektiert jenseits der Rituale von Festreden und Streitschriften, was die Universität heute leisten soll und was nur sie leisten kann.
Dafür blickt er zunächst zurück auf den Umbau der deutschen Universitäten seit 1960 – ihre Politisierung, ihre Ausweitung zum Massenbetrieb, den Einzug des Neoliberalismus, die Ausrichtung auf Exzellenz und Wettbewerb. Daraus und aus seiner profunden Kenntnis der deutschen Hochschullandschaft entwickelt er seine Gegenwartsdiagnose. Vor allem geht es ihm um die Risiken, denen die Universitäten ausgesetzt sind, aber auch um ihre versteckten Chancen. Können sie wirklich alle Exzellentes leisten? Wie weit können sie wachsen? Die Universität vereint in sich eine Vielfalt, durch die sie konkurrenzlos ist: die Vielfalt der Fächer und Denkhaltungen, das Nebeneinander von Grundlagenforschung, Anwendung und Lehre und nicht zuletzt die soziale Vielfalt derer, die hier zusammenwirken.
Über den Autor
Peter-André Alt ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin, die er von 2010 bis 2018 als Präsident leitete. Seit 2018 ist er Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Bei C.H.Beck sind von ihm u.a. erschienen: Franz Kafka. Der ewige Sohn (22008), Ästhetik des Bösen (22011), Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne (2016) und «Jemand musste Josef K. verleumdet haben». Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten (22020).
Inhalt
Einleitung
I. Die permanente Reform. Umbau der Universität seit 1960
1. Am Rande einer Bildungskatastrophe
2. Studium, neu gedacht
3. Politisierung und Massenbetrieb
4. Nach der Wende
5. Neoliberale Revisionen
6. Drittmittel, Wettbewerbe, Evaluationen
II. Zwischen Anarchie und Steuerung. Die Universität als schwierige Institution
1. Was von Humboldt bleibt
2. Das Prinzip der Fächer
3. Führungsparadoxien
4. Über den Streit
5. Gute Lehre
6. Verwaltete Wissenschaft
III. Vielfalt gestalten. Risiken und Chancen für die Universität
1. Wachstum als Problem?
2. Zur Mission der Fachhochschulen
3. Promotionskultur
4. Akademische Laufbahnen oder Sackgassen
5. Harvard, Oxbridge und wir
6. Die ‹Multiversität› – ein gesellschaftliches Modell
7. Gelehrte Freiheit und gelingende Organisation
Fazit
Anmerkungen
Einleitung
In welcher Verfassung sind unsere Universitäten? Diese Frage wurde und wird in regelmäßigen Abständen gestellt, bevorzugt im Rahmen von Festreden und Streitschriften. Dass sie zuletzt zu sonderlich tragfähigen Erkenntnissen führte, kann man nicht behaupten. Zumeist beschränken sich die Antworten auf Klagen, die unzureichender Finanzierung, steigender Überfüllung und zunehmender Überlastung gelten. In eingeübten Ritualen der Kritik bemängelt man die schlechte Ausstattung der Universitäten, die wachsende Beanspruchung im Lehrbetrieb und die Zwänge der projektförmigen, vorwiegend drittmittelgestützten Forschung. Solche Diagnosen sind so richtig wie die Forderungen, die sich aus ihnen ableiten, aber sie ersetzen nicht die Suche nach den prinzipiellen Aufgaben und Zielen der Institution. Über die Mission der Universität im 21. Jahrhundert ist gründlicher als bisher nachzudenken.
Wer die Leistungen von Hochschulen charakterisieren möchte, verwendet häufig Metaphern. Die Universität ist vor langer Zeit als ‹gütige Mutter› (‹Alma Mater›), später als ‹im Kern gesund›, in krisenhaften Phasen als ‹im Kern verrottet› beschrieben worden. Während der letzten Jahre standen organische Bildfelder hoch im Kurs: Die Rede war von Herzkammer, Rückgrat, Jungbrunnen und Kristallisationspunkt des Wissenschaftssystems. Gemeinsam ist der Mehrzahl dieser Metaphern, dass sie für Universitäten eine maßgebliche, unverzichtbare, ja existentielle Rolle innerhalb eines größeren Gesamtgefüges anzeigen. Universitäten, so lässt sich erkennen, bringen unterschiedlichste Gebiete des Wissenschaftsbetriebs zum Laufen, stützen oder bündeln sie. Gespiegelt findet sich diese Zuschreibung in einem vor einigen Jahren bereits vorgeschlagenen Begriff, dem des ‹Organisationszentrums›.[1] Er erfasst die ordnende und ermöglichende Funktion, die Universitäten hierzulande wahrnehmen sollen. Zu unterscheiden sind dabei drei wesentliche Felder: Aufgabenspektrum (1), Arbeitsprozesse (2) und privilegierte Handlungsbereiche (3).
Zum Portfolio der Aufgaben von Universitäten gehören Forschung, Lehre, Transfer, Sicherung einer technischen Infrastruktur, wissenschaftliche Weiterbildung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Pflege des kulturellen Erbes, regionale und internationale Zusammenarbeit, Förderung nachfolgender Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aller Karrierestufen. Das ist nur ein Auszug, aber er zeigt schon Vielfalt und Spannweite hochschulischer Funktionen. Daneben erbringen Universitäten – zweitens – auch eine Organisationsleistung, indem sie in effizienter Weise Arbeitsprozesse steuern. Im Einzelnen können sie Wissenschaft gemäß ihrer jeweiligen Ausprägung in Lehre und Forschung gestalten; Wissenschaft in ihrer Diversität produktiv machen durch die Kooperation von Disziplinen; Wissenschaft etablieren in Breite und Exzellenz; Wissenschaft erklären für fachkundige und nicht-fachkundige Öffentlichkeiten; Innovationen vorantreiben durch optimale Ausschöpfung und Kombination ihrer intellektuellen wie infrastrukturellen Ressourcen.
Was können – dritter Punkt – einzig und allein die Universitäten? Sie können Forschung und Lehre produktiv aufeinander beziehen; interdisziplinäres Zusammenwirken der Fachkulturen in unterschiedlichsten Denkhaltungen, Methoden und Perspektiven fördern; Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung gleichzeitig ermöglichen; Karrieren von der Studienphase bis zur Berufung unterstützen; regionale, nationale und globale Vernetzungen stärken; junge Menschen qualifizieren für heterogene Berufsmärkte; akademisches Rollenmodell sein für soziale Vielfalt und Gemeinschaft. Allein die Universität vermag diese Zwecke parallel zu erfüllen, weil sie inhaltlich und funktional durch Pluralität gekennzeichnet ist: durch eine Pluralität der Fächer, der Wissenschaftsdisziplinen und damit verbundenen Methoden; und durch eine Pluralität der Kompetenzen in Lehre, Forschung, Transfer und Kommunikation. So gesehen ist die Universität das Organisationszentrum der Wissenschaft und daher als Institution konkurrenzlos.
Zu prüfen gilt, was ein derart weiträumiger Handlungshorizont für unsere Universitäten im Guten wie im Schlechten bedeutet. Können sie alle Exzellentes leisten, oder gelingt das doch nur wenigen? Was erbringen sie für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat? Was ermöglichen sie und wem helfen sie? Es ist notwendig, Überforderungsrisiken zu benennen, Fehlentwicklungen anzusprechen, Potentiale zu erkennen und versteckte Chancen aufzudecken. Das vorliegende Buch möchte die universitären Aufgaben und Optionen, wie sie sich gegenwärtig und künftig eröffnen, genauer beschreiben, als das sonst üblich ist. Es bietet im ersten Kapitel einen historischen Rückblick auf die Reform der deutschen Universität seit den sechziger Jahren, um, daraus abgeleitet, eine klare Sicht auf die aktuelle Lage im zweiten und eine Analyse der in ihr schlummernden Gestaltungschancen im dritten Kapitel anzubieten.[2] Die Grundhaltung des Buchs ist, bei aller Kritik an früheren Versäumnissen und heutigen Fehlern, die des Optimismus. Sie speist sich aus der Einsicht in die Kraft einer Institution, die schwierig und faszinierend zugleich ist; die in Sonntagsreden oft als Objekt falscher Erwartungen und enttäuschter Hoffnungen erscheint, häufig als schwerkrank beschrieben wurde, aber stets vital auferstanden ist. Will man diesen Widerspruch begreifen und produktiv machen, so bedarf es einer genauen Untersuchung der Mission, um die es hier geht. Die deutsche Universität mit der Vielfalt ihrer Formtypen verdient, dass man ihren Auftrag und ihre Möglichkeiten gründlich durchleuchtet.
Das Buch operiert auf drei verschiedenen methodischen Feldern, die sich komplementär ergänzen. Es verfährt zunächst historisch, indem es, ausgehend von den sechziger Jahren, die Entwicklung des deutschen Universitätssystems bis zur Gegenwart Revue passieren lässt. Es arbeitet in einem zweiten Schritt analytisch, insofern es die heterogenen Bereiche der ideellen Konzeption und administrativen Organisation, die Konfliktstrukturen und vorrangigen Handlungsfelder durchleuchtet, die für die Universität charakteristisch sind; zu diesem Zweck nutzt es auch quantitative Befunde, statistische Daten, empirische Fakten. Schließlich projektiert das Buch in einem dritten Anlauf künftige Entwicklungsgebiete und Perspektiven für die deutsche Universität im nationalen wie internationalen Maßstab, wobei es die Potentiale, die der aktuelle Zustand birgt, programmatisch aufzuzeigen sucht.
Die Diagnosen und Prognosen des Buchs stützen sich auf die Erfahrungen, die der Autor in einem Vierteljahrhundert verantwortlicher Mitgestaltung des Universitätssystems und seiner Einrichtungen erworben hat: als Institutsdirektor und Dekan an unterschiedlichen Orten, als Präsident der Freien Universität Berlin und, aktuell, als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Begleitet wurden diese Tätigkeiten seit 2005 durch publizistische Beiträge für die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Rundschau, Die Zeit, den Tagesspiegel und durch Kolumnen für die Berliner Morgenpost und die Berliner Zeitung, die sich mit vielfältigen Themen des Bildungs- und Wissenschaftsbetriebs beschäftigten.[3] Sie ermöglichten dem Verfasser jene kritische Selbstvergewisserung, ohne die man ein Führungsamt – nicht nur im Hochschulsystem – schwerlich überzeugend wahrnehmen kann. Dem gleichen Impuls entsprang die Idee zu diesem Buch, das nicht in Bezug auf bereits abgeschlossene Erfahrungen, sondern aus der Frage nach aktuellen und künftigen Aufgaben, also mit Blick auf noch Unerledigtes entstand.
Für die sachkundige Unterstützung bei der Vorbereitung des Daten- und Faktenmaterials danke ich den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschulrektorenkonferenz, namentlich ihrem Generalsekretär Jens-Peter Gaul und seinem Stellvertreter Christian Tauch, der den Text ebenso wie Matthias Dannenberg kritisch durchgesehen hat.
I. Die permanente Reform. Umbau der Universität seit 1960
1. Am Rande einer Bildungskatastrophe
In den frühen sechziger Jahren befand sich die Bundesrepublik auf einem geraden Entwicklungsweg. Wirtschaftliches Wachstum, gesellschaftlicher Interessenausgleich, zunehmende internationale Anerkennung, gefestigte Demokratie, klare Verortung im westlichen Bündnis – politisch und ökonomisch schien nach NS-Diktatur und Krieg alles auf Stabilität zu deuten. Wer genauer hinsah, erkannte jedoch Versäumnisse, vor allem im Bereich der Zukunftsplanung. Den Aufbau des jungen Staates hatten politisch, ökonomisch und wissenschaftlich die Vertreter einer Generation geleistet, deren Studium in die Zeit des Kaiserreichs oder der Weimarer Republik fiel. Die Dynamik der technisch-industriellen Fertigung, der Forschungsinnovationen und der wirtschaftlichen Verwertung ihrer Ergebnisse stand auf dem Spiel, da diese Generation nicht genügend Vorsorge für ihre Nachfolge getroffen hatte. Die Zahl der Abiturienten und Studierenden stagnierte; das Bildungsniveau der Volksschüler war niedrig; es gab veraltete Curricula und einen dramatischen Lehrermangel, was insbesondere in ländlichen Regionen zu Klassen mit bisweilen 70 Schülern führte. Kaum besser sah es an den Universitäten aus, wo der Anteil der Professuren seit den fünfziger Jahren nur geringfügig gewachsen war.[1] Deutschlands Entwicklungsfähigkeit wurde durch diese von der Politik weitgehend ignorierte Unterversorgung massiv bedroht.
Im Zeitraum von drei Jahren, zwischen 1963 und 1965, erschienen drei wegweisende Studien zur Lage der Schulen und Hochschulen: Helmut Schelskys Einsamkeit und Freiheit (1963), Georg Pichts Die deutsche Bildungskatastrophe (1964) und Ralf Dahrendorfs Bildung ist Bürgerrecht (1965). Sie näherten sich der aktuellen Situation aus unterschiedlichen Perspektiven, aber mit vergleichbaren Zielsetzungen. Die drei Autoren vereinte das Bewusstsein, dass Deutschlands Zukunft ohne eine unverzügliche Bildungsoffensive auf dem Spiel stand. Sie erkannten sehr genau, wie mangelhaft die Hochschulen für eine breite Qualifizierung der nachrückenden Führungsgeneration gerüstet waren. Und sie suchten die Forderung nach einem Ausbau der Universitäten mit programmatischen Gedanken über deren organisatorische Reform zu verknüpfen.
Schelskys Abhandlung Einsamkeit und Freiheit war vorwiegend historisch angelegt und vertrat noch die traditionelle Idee der Universität. Im Mittelpunkt stand die Geschichte der deutschen Hochschule aus dem Blickwinkel der Humboldtschen Reform. Für den Soziologen Schelsky war neben der funktionalen auch die intellektuelle Dimension der Universität bedeutsam, die sich mit dem Programm ihrer preußischen Neubegründung in den Jahren nach 1810 verknüpfte. Dazu gehörten der Anspruch auf Sicherung eines autonomen Lehr- und Forschungsbetriebs durch staatliche Alimentierung bei gleichzeitigem Verzicht auf inhaltliche Einflussnahme, die Unabhängigkeit der Lehrenden von äußeren Eingriffen und Steuerungen, die Förderung guter Forschung durch die Ermöglichung eines Klimas der Selbstbestimmung und Konzentration, die Schaffung einer auf Austausch beruhenden professoralen Gemeinschaft und die Zweckfreiheit von Lehre und Forschung jenseits reiner Berufsqualifizierung bzw. praktischer Anwendung. Schelsky betrachtete das Humboldtsche Modell als wegweisend, weil es von einer hohen geistigen Ambition getragen wurde. Lernen könne man aus der Gründungsgeschichte der Berliner Universität, dass eine Hochschule ein unfestes Gefüge sei, das man permanent zu verändern und umzubauen habe: «Die Erneuerung der Universität muss über sie hinausgreifen.»[2] Auch für die Gegenwart gelte der Primat der Idee, das Bemühen, die Grenzen des reinen Funktionalismus zu überwinden. Nur wer den instititutionellen Status quo überbiete, könne bildungspolitisch Bedeutsames leisten.[3] Im Kern war das eine idealistische Denkhaltung, die jede Realität einzig als Material für die Vervollkommnung einer künftigen Welt begriff.
Erst im Schlusskapitel, überschrieben «Der Weg in die Zukunft», befasste sich Schelsky mit der Frage einer neuen Universitätsreform. Hier ist seine Studie in ihrer analytischen Prägnanz außerordentlich klar und verblüffend aktuell. Er nannte fünf Arbeitsfelder der Universität: Forschung, Lehre, korporative Funktion (Selbstverwaltung und Repräsentation), gesellschaftliche Praxis und indirekte Aufgaben (z.B. Heranziehung sozialer Führungsschichten, Bildung mündiger Individuen). Es ist aufschlussreich, dass Schelsky bereits Anfang der sechziger Jahre von einer Überlastung der Universität im Hinblick auf ihre Zwecke und Ziele sprach. Übereinstimmend mit seinem subjektorientierten Herangehen beschrieb er diese Überlastung am konkreten Einzelfall, dem Ordinarius der Medizin, der akademische Lehre, Forschung, Qualifizierung, Krankenversorgung und Klinikadministration gleichermaßen leisten soll. Es verstehe sich, so Schelsky, dass eine derartige Dichte an Aufgaben dauerhaft nicht zu bewältigen sei. Die Krise der Universität resultiere aus dem Zuviel an Erwartungen, denen sie ausgesetzt werde.[4]
Auf ähnliche Weise hatte das Karl Jaspers 1961 in einer Denkschrift diagnostiziert, die einen der letzten Versuche darstellte, eine Idee der Institution zu entwickeln. Die traditionelle Universität, hieß es dort, verfalle zusehends, weil sie sich in ein «Aggregat von Fachschulen» verwandle.[5] Ursächlich machte Jaspers für diese Tendenz die Expansion der Studierendenquote verantwortlich: «Der Massenzustrom bringt den Unterrichtsbetrieb durch Raummangel, Mangel an der genügenden Zahl von Dozenten, Mangel an genügenden Unterrichtsmitteln vielerorts in Schwierigkeiten; die Studenten kommen nicht zu ihrem Recht, die Dozenten sind überlastet bis zur Lähmung ihrer Forschung.»[6] Die rein quantitative Lösung des Problems der ‹Vermassung› bestehe, so erklärte Jaspers, in einer «Vermehrung» der Professuren.[7] Aber letzten Endes gehe es nicht um eine materielle Verbesserung, sondern um intellektuelle Ansätze zur Wiederherstellung des ursprünglichen Universitätswesens. Dass Wachstum und Tradition nicht recht zusammenpassten, wurde bei Jaspers nur am Rande reflektiert. Die Frage, ob die größere Universität mit mehr Studierenden zwangsläufig einer anderen Idee folgt, spielte in seiner Schrift kaum eine Rolle. Sie versteckte sich ansatzweise in der Klage darüber, dass die durch die Schule «unzureichend» und «nicht einheitlich» vorbereiteten Studierenden aufgrund ihres unterschiedlichen kognitiven Rüstzeugs keine «gemeinschaftliche geistige Atmosphäre zu schaffen» vermöchten.[8] Hier klang ein Topos an, der auch aktuelle Bildungsdebatten und die Diskussion über die ‹Heterogenität› unserer Abiturientinnen und Abiturienten prägt.
Während der Philosoph Jaspers vor allem an eine geistige Erneuerung der Universität dachte, wenn er von Reform sprach, legte Schelsky als Soziologe die Perspektive der Organisationsentwicklung zugrunde. Der Blick richtete sich dabei auf die Veränderungen, die das universitäre System gegenüber seinen modernen Ursprüngen im frühen 19. Jahrhundert durchlief. Allein in den Kernbereichen Lehre und Forschung habe sich, so Schelsky, eine innere Differenzierung zugetragen. Zur Forschung gehöre zunehmend das Management, die öffentliche Kommunikation, der gesellschaftliche Anwendungsauftrag; zur Lehre wiederum die Diversifizierung der Unterrichtstypen mit wachsender Spezialisierung zwischen Tutorium, Einführungsübung, Vorlesung und Forschungskolloquium.[9] Die an aktuellen Tendenzen ausgerichtete Diagnose Schelskys stand im Gegensatz zu den konservativen Lösungsmustern, die er verfolgte. Angesichts überbordender sozialer Verpflichtungen müsse das Gebot der «Einsamkeit» als Ermöglichungsbedingung guter Wissenschaft mit Nachdruck verteidigt werden.[10] Schelsky versuchte die alte Idee der Universität vor allzu pragmatischen Fortschreibungen zu schützen, weil er sie für das Kernelement des akademischen Systems hielt. Seine Institutionsanalyse trug auf diese Weise widersprüchliche Züge, insofern sie den Blick auf moderne Bildungserfordernisse mit einer sehr traditionellen Konzeption verband.
Am Ende kam Schelsky zu der Einsicht, dass eine Universitätsreform in Deutschland unvermeidlich sei, aber schwerlich den Charakter eines einheitlichen Akts haben könne. Der bevorstehende Wandel werde, so die Prognose, anders als bei Humboldt 150 Jahre zuvor keiner geschlossenen Idee folgen, sondern der Pluralität der Institution selbst, der Heterogenität ihrer Aufgaben und der Vielschichtigkeit ihrer Strukturen entsprechen. An diesem Punkt entwickelte Schelsky geradezu prophetische Fähigkeiten: «Was als Hochschulreform möglich ist, wird sich nur als ein lange währender Vorgang von Dauerreformen an einzelnen entscheidenden Stellen innerhalb des Hochschulwesens vollziehen lassen; das Ziel kann kein planmäßiges Einheitsgebilde einer ‹neuen Universität› sein, sondern es wird auf ein differenziertes Hochschulgefüge herauskommen, das in seiner Unterschiedlichkeit besser geeignet sein wird, die verschiedenen Funktionen der Hochschule in unserer Gesellschaft zu erfüllen, als jede planmäßig ersonnene Einheits-Universität.»[11] Schelskys Prognose sollte sich sehr bald bewahrheiten und bildungspolitische Wirklichkeit werden. Zu den wesentlichen Effekten des Ausbauprozesses gehörte es, dass die Universität als relativ homogene Einrichtung verschwand. Permanente Reform, Ausdifferenzierung der Institutionentypen, Diversifizierung von Mission und Aufgaben – das war in der Tat das Programm, vor dem man am Beginn der sechziger Jahre auf dem Feld der Hochschulpolitik stand.
Mit Feinzielen für eine direkte Umsetzung seiner Reformagenda befasste sich Schelskys Studie kaum. Weitaus pragmatischer argumentierte dagegen Georg Pichts Warnschrift Die deutsche Bildungskatastrophe, die Anfang 1964 zunächst als Artikelserie in der Zeitung Christ und Welt erschien. Sie ging vom Status quo aus und suchte direkten Einfluss auf die Bildungspolitik der Bundesrepublik zu nehmen. Viele der von Picht vorgetragenen Befunde sind überraschend aktuell. Dazu zählt die Klage über den zu geringen Anteil öffentlicher Bildungsausgaben, über die defizitäre Ausstattung der Schulen, den drohenden Fachkräftemangel, die fehlende Wettbewerbsfähigkeit zukünftiger Forschung, die Reibungsverluste durch länderspezifische Partikularinteressen. In die Kritik gerieten zwei Entwicklungen, die auch heute Themen unserer Debatten sind. Erstens bemängelte Picht die geringen Chancen für Bildungsaufsteiger: «Unser sozialpolitisches Bewußtsein ist womöglich noch rückständiger als unser Bildungswesen.»[12] Und zweitens tadelte er die Neigung zu übertriebenem Föderalismus, die schnelle und wirkungsvolle Lösungen verhindere. Man müsse bei allen künftigen Reformen eine weitaus stärkere Steuerung durch den Bund vorsehen, sonst komme man nicht vorwärts. «Bildungsplanung», so erklärte Picht entschieden, sei nur «im Rahmen des Gesamtstaates möglich».[13] Dabei ging es nicht um eine Grundsatzfrage, sondern um Pragmatismus: «Wenn man das föderative System aber erhalten will – und wir haben nicht die Zeit, uns auf das politische Abenteuer einer großen Verfassungsreform einzulassen –, so muß man es zu handhaben wissen.»[14] Das ließe sich auch heute ähnlich ausdrücken.
Dem Pädagogen Picht lag vor allem die Lehrerbildung am Herzen, denn sie betraf jenen Aspekt seiner Krisendiagnose, von dem die ganze Studie ihren Ausgang nahm. Die mangelhafte Personalsituation an den Schulen erforderte zügiges Handeln; 1962 waren im Bundesdurchschnitt 18 Prozent der Lehramtsstellen an Gymnasien nicht besetzt, in Bundesländern mit hohen ländlichen Anteilen wie Baden-Württemberg und Niedersachsen gingen diese Zahlen bis zu 30 Prozent.[15] Picht betonte, dass es für die Abiturienten auch persönliche Gründe gebe, ein Lehramtsstudium aufzunehmen. Die wachsende Vielfalt der Schultypen und die expandierende Bedeutung der Erziehungswissenschaft böten große Chancen im Spektrum zwischen praktischer Tätigkeit und Forschung.[16] Wenn man die hier liegenden Möglichkeiten gut nutzen wolle, müsse man aber verstärkt promovierte Lehrer aus dem Schuldienst für den Universitätsunterricht gewinnen – ein Programm, das an etlichen pädagogischen Hochschulen bald umgesetzt wurde.
In einer Rede vor protestierenden Studierenden der Universität Heidelberg erklärte Picht am 1. Juli 1965: «Es fehlen auf allen Stufen die Lehrer; es fehlen die Abiturienten und überhaupt die qualifizierten Nachwuchskräfte, die nötig sind, um die Zukunft von Staat und Wirtschaft zu sichern. Es fehlt an Schulbauten und Universitäten; und durch das Bildungsgefälle sind ganze Bevölkerungsgruppen von jener Chancengleichheit ausgeschlossen, die im Grundgesetz garantiert ist.»[17] Wesentlichen Anteil an der düsteren Lage hatte die soziale Benachteiligung der Kinder aus Arbeiterhaushalten und dem unteren Mittelstand. Weil sie zu wenig gefördert wurden, blieb das Abitur ein Privileg für die Bessergestellten. Die Expansion des Bildungssystems entschieden voranzutreiben bedeutete im Sinne dieser Diagnose auch, faire Zugangsmöglichkeiten für alle zu schaffen. Das bildungspolitische Programm war gemäß Picht zugleich ein gesellschaftspolitischer Auftrag.
Einen anderen Aspekt der ‹Bildungskatastrophe› beleuchtete eine empirische Arbeit, die 1961 erschien. Sie stammte von vier Sozialwissenschaftlern – unter ihnen der junge Jürgen Habermas – und trug den Titel Student und Politik. Insgesamt 171 Studierende der Frankfurter Universität waren hier nach ihren Urteilen über die nationale Parteienlandschaft, ihrem Verständnis der Rolle des Parlaments, ihrem Interesse an tagesaktuellen Themen und ihrer Auffassung über die moralische Qualität von Politik schlechthin befragt worden.[18] So entstand ein Bild, das trotz der schmalen empirischen Basis aussagekräftig im Hinblick auf Stimmungen und Haltungen junger Menschen im Adenauer-Deutschland der späten fünfziger Jahre war. Durchweg vermittelte sich der Eindruck einer am persönlichen Aufstieg arbeitenden Generation, die kein Interesse für Politik zeigte und mangelhaft über gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen unterrichtet war. Berücksichtigte man, dass es sich hier um die künftigen Eliten handelte, so lieferte die Momentaufnahme der Frankfurter Studie einen besorgniserregenden Befund. Wenn diejenigen, die später in Führungspositionen der Wirtschaft und Wissenschaft aufsteigen sollten, weder Informationen noch profunde Meinungen zum politischen System der Gegenwart besaßen, schien es schlecht um Deutschland bestellt. Die von Helmut Schelsky so genannte «skeptische Generation» der zwischen 1910 und 1925 Geborenen, die sich nach Krieg und Nationalsozialismus von Ideologien fernhielt, Heilswahrheiten misstraute und wirtschaftliche Sicherheit in stabilen familiären Lebensmodellen anstrebte, war zugleich eine unpolitische Generation. Mit einer «auf das Praktische, Handfeste, Naheliegende, auf die Interessen der Selbstbehauptung und -durchsetzung gerichteten Denk- und Verhaltensweise» offenbarte sie, so Schelsky, deutliche Grenzen ihrer staatsbürgerlichen Mündigkeit.[19] Zwar legte die überwältigende Mehrheit der Befragten ein Bekenntnis zur Demokratie ab, jedoch blieb dieses faktisch unpolitisch, insofern es nur in «vagen Gefühlen und Meinungen» Ausdruck fand.[20] Im Detail zeigten sich erschreckende Wissenslücken mit Blick auf Parteienlandschaft, politische Programme und Strukturen, auf Parlamentarismus und staatliche Organe.[21] Diese fehlende Fundierung dokumentierte einen Mangel im schulischen und hochschulischen Gefüge, der nicht allein durch einen Ausbau entsprechender Lehrkapazitäten behoben werden konnte. Zur institutionellen Expansion musste eine Reform des Bildungssystems selbst treten, das neben der Qualifizierung einer Vermittlung gesellschaftlicher und politischer Werte dienen sollte. Ludwig von Friedeburg, einer der Autoren von Student und Politik, verband das mit der Forderung, «demokratische Verhaltensweisen nicht nur einzuüben, sondern auch praktisch anzuwenden», was wiederum eine «Demokratisierung» von Schule und Hochschule verlangte.[22]
1965, ein Jahr nach Picht, veröffentlichte Ralf Dahrendorf seine Streitschrift Bildung ist Bürgerrecht, von der einzelne Thesen zugleich in der Zeit erschienen. Das gesellschaftspolitische Postulat Pichts und Friedeburgs wurde hier praxisnah, aber auch theoretisch weiterentwickelt. Dahrendorf skizzierte die Idee eines sozialen Grundrechts auf Bildung, dessen Erfüllung eine Expansion «durch Reform» im Sektor der Hochschulen herbeiführen sollte.[23] Als benachteiligte Gruppen, die bisher nur eingeschränkten Zugang zur Universität hatten, wurden junge Frauen, Kinder aus Arbeiterfamilien und ländlich katholischen Haushalten identifiziert. Bei diesem Befund musste das Schulsystem ansetzen, damit eine breitere Bildungsförderung gelingen konnte.[24] Den Ausbau der Gymnasien und Universitäten sollten Steuererhöhungen und Umschichtungen in den Etats ermöglichen. «Der Verteidigungshaushalt, dessen Diskussion leider weitgehend tabu geworden ist, enthält mit Sicherheit Elastizitäten, zumal die Vorstellung, daß man für den Preis von 100 Starfightern eine ganze Universität – und für einen eine schöne Schule – bauen könnte, doch sehr nachdenklich stimmt.»[25] Hier war ein bildungspolitischer Gestaltungswille am Werk, der Liberale und Sozialdemokraten in diesen Jahren gleichermaßen antrieb. Er zielte auf eine umfassende Expansion des Schul- und Hochschulsystems, ohne die Chancenparität in einer modernen Gesellschaft nicht möglich war.
Dahrendorf ging es aber nicht um die reine Erhöhung der Studierendenzahlen, sondern um einen Umbau der Institution selbst. Im Mittelpunkt stand die Öffnung der Universitäten und damit auch die Vorstellung einer hierarchiefreieren Organisation des Studiums. Soziale und institutionelle Reform gingen Hand in Hand, denn das eine bedingte das andere. Mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit war erforderlich, um bessere Teilhabe am Bildungssystem zu erreichen; die Universitäten sollten ihrerseits durch offene Strukturen und den Abbau autoritärer Verhältnisse zu Musterräumen einer freien Diskussionskultur werden. Dahrendorf, von Hause aus Soziologe wie Schelsky, passte den alten Bildungsbegriff an die dynamischer gewordene Gesellschaft der jungen Bundesrepublik an. Sein Programm dokumentierte den politischen Schwung einer Generation, die mit neuen Ideen für eine Öffnung der Schul- und Forschungslandschaft eintrat.
Dahrendorf überführte konsequenterweise Pichts Diagnose einer deutschen Bildungskrise, deren politischer Basisargumentation er folgte, in ein praxisnahes System von Handlungsschritten. Dazu gehörte auch die Einsicht, dass die Universitäten anders als bisher strukturiert werden mussten, damit sie ihre modifizierten Aufgaben erfüllen konnten. Dahrendorf plädierte nachdrücklich für eine Aufhebung der alten Fakultätsordnung zugunsten interdisziplinärer Lehr- und Forschungsverbünde. Dieses Modell griffen die Hochschul-Neugründungen in Bochum, Bielefeld und Konstanz ab Mitte der sechziger Jahre praktisch auf. Dass hier die Postulate der jüngeren Bildungsforschung umgesetzt werden sollten, war keineswegs zufällig, denn Schelsky – in Bielefeld – und Dahrendorf – in Konstanz – trieben den Aufbau der neuen Institutionen ihrerseits tätig voran. Wenn die maßgeblichen Programmatiker selbst in die Rolle aktiver Universitätsreformer wechselten, so war das typisch für die kurze Phase eines kooperativen Neuansatzes, in der Politik und Wissenschaft gemeinschaftlich handelten.[26]
Dahrendorf erkannte genauer als andere, dass die Universität der Zukunft durch eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben gekennzeichnet sein würde. Zur wachsenden Pluralität gehörte auch der deutlicher werdende Anspruch der Studierenden, die mehr Einfluss bei der Entwicklung der Lehrpläne und bei den formalen Regelungen des Studienverlaufs forderten. 1962 hatte Jürgen Habermas in einem entschiedenen Plädoyer für mehr studentische Mitbestimmung bei der Gestaltung der Universität geworben.[27] Die «Mandarinenideologie» der Ordinarien, wie er es 25 Jahre später nannte, sollte überwunden und durch eine Kultur fairer Teilhabe am Wissenschaftsprozess überwunden werden.[28] Dahrendorf berücksichtigte solche Positionen, wenn er von einer funktionalen Umstrukturierung aller Hochschulen im Blick auf die Organisation ihrer Aufgaben und die Einbeziehung der einzelnen Statusgruppen sprach. Mit einem Begriff, den Clark Kerr erstmals im März 1963 während einer Rede in Harvard verwendete, heißt es, die Universität habe sich in eine ‹Multiversität› zu verwandeln.[29] Nur mit einer funktionalen Auffächerung könnten die differenzierter werdenden Qualifizierungserfordernisse im Rahmen von polyvalenten, unterschiedlichen Zwecken dienenden Hochschultypen realisiert werden.[30] Diese Perspektive erwies sich als belastbare Zukunftsvision, denn sie eröffnete die Sicht auf eine akademische Landschaft der Vielfalt, wie sie im Laufe der folgenden Jahrzehnte in Deutschland entstand.
Dahrendorfs Abhandlung blieb unter den drei hier kurz vorgestellten Schriften die optimistischste. Sie ging davon aus, dass eine Universitätsreform nötig, aber auch machbar sei. Die Erweiterung der Hochschulen hielt sie für möglich, sofern deren ursprünglich elitäres Selbstverständnis einem funktionalen Pragmatismus wich. Und sie betonte die Chancen einer beschleunigten Expansion, die in wenigen Jahren zu einer verbesserten Qualifizierungssituation mit greifbaren Breiteneffekten führen sollte. Ein vergleichbares Zukunftsvertrauen existierte damals auch in der deutschen Bildungspolitik: Zwischen 1965 und 1975 erhöhte sich der Anteil der öffentlichen Ausgaben für Schulen und Hochschulen von 3,4 auf 5,5 Prozent. Die Zahl der Universitäten wuchs, aber mit der Erweiterung veränderte sich ihre Organisationsstruktur schneller, als den meisten Akteuren bewusst wurde. Die Tatsache, dass die Institution sich durch ihre Ausdehnung von einer elitären Insel zu einer funktionalen Masseneinrichtung wandelte, fand in den Diskussionen über ihren Auftrag wenig Berücksichtigung, was bis heute so gelieben ist.[31] Die Geschichte der bundesdeutschen Universitätsreformen liefert uns das Beispiel für einen pragmatisch motivierten Umbau der Institution, mit dem ihre programmatische Selbstreflexion schon damals kaum Schritt hielt.
2. Studium, neu gedacht
Aus der bildungspolitischen Krisendiagnose der frühen sechziger Jahre folgte eine enorme Handlungsdynamik, die den Ausbau der Universitäten in Gang setzte. Bund und Länder zeigten sich zu einem kooperativen Föderalismus fähig, den viele Skeptiker kaum für möglich gehalten hatten. Wesentliche Forderungen der Kritiker wurden realisiert, allerdings nicht unbedingt so, dass man von einer auskömmlichen Ausstattung der Hochschulen sprechen konnte. Die Abiturientenquote erhöhte sich zwischen 1960 und 1970 von 7 auf 15 Prozent. Man gründete neue Universitäten, vor allem im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen; ihre Gesamtzahl wuchs in den zehn Jahren zwischen 1960 und 1970 von 33 auf 41, bis 1990 dann auf 70 – eine veritable Verdopplung. Da quantitative Aspekte für diese Bildungsoffensive zunehmend Vorrang hatten, traten programmatische Fragen in den Hintergrund. Die ambitionierte Reformdynamik, mit der Dahrendorf und Schelsky den Aufbau der Universitäten in Konstanz und Bielefeld projektiert hatten, verlor sich bald im Alltag. Primär ging es jetzt um die Entlastung des stetig wachsenden Universitätswesens, weniger um eine Veränderung akademischer Strukturen.[1] Die Gründungsinitiative des Staates reagierte primär, wie Hans-Ulrich Wehler schreibt, «auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes, der im Zeichen der heraufziehenden Wissensgesellschaft eine steigende Nachfrage nach theoretischer Qualifikation freisetzte».[2]
Im Inneren der Universitäten vollzogen sich seit 1967 gleichwohl größere Reformanstrengungen, die jedoch nicht von den Professoren oder den ministeriellen Behörden, sondern von kritischen Studierenden, von Assistentinnen und Assistenten initiiert wurden.[3] Sie galten vorrangig einer Enthierarchisierung des Lehrbetriebs, einer stärkeren Beteiligung aller Statusgruppen an Entscheidungsprozessen und der Neugestaltung der Curricula. Knut Nevermann, einer der klügsten Exponenten der oppositionellen Bewegung, schrieb 1968: «Anlaß studentischer Bemühungen um Reform waren die Erkenntnisse, daß die Universitäten überfüllt und undemokratisch strukturiert waren, daß nur 5 Prozent der Arbeiter- und Bauernkinder an den Universitäten studierten, und daß ein unpolitisches, verinnerlichtes Bildungsideal fröhliche Urständ feierte.»[4] An zahlreichen Hochschulen – zuerst in Berlin, Frankfurt, Marburg und München – begannen parallel zur Erweiterung des institutionellen Spektrums ausgedehnte Diskussionen über sozialkritische Themen in der Lehre, die Politisierung der Wissenschaft und deren aktive Verantwortung für den Umbau einer verkrusteten, zutiefst autoritären Gesellschaft.
Reformen erfolgten, oft kontrovers debattiert, im alltäglichen Lehrbetrieb, aber auch im Hochschulsystem als Ganzem. Hier waren es vor allem die sozialliberalen Landesministerien, die zügig aktiv wurden. Die von Dahrendorf hervorgehobene Notwendigkeit einer bedarfsgerechteren Funktionsdifferenzierung führte im Sektor der höheren Bildung zu einer neuen Arbeitsteilung. 1969 trat das Gesetz zur Etablierung der Fachhochschulen in Kraft, das ein praxisnahes, für beruflich Qualifizierte zugängliches Studium ermöglichte. Es vollzog sich wesentlich durch die Umwandlung vieler ‹Höherer Fachschulen› in akademisch strukturierte Fachhochschulen. Daraus erklärt sich, dass schon ein Jahr nach der Verabschiedung des Gesetzes 98 Fachhochschulen existierten; die Neugründungen waren in Wirklichkeit meist eine Umetikettierung. Ihre eigentliche Mission fanden die Fachhochschulen erst in der kommenden Dekade. Mit ihren praxisorientierten Studienprogrammen fügten sie sich bestens in die Bildungsdynamik der siebziger Jahre ein. Dass sie auch Menschen mit Berufserfahrung offenstanden, sollte die von sozialliberaler Seite eingeklagte, aber bisher kaum erreichte Chancengleichheit befördern und gerade in technischen Berufen für eine dringend notwendige Verbindung von theoretischer mit praktischer Expertise sorgen.
Die siebziger Jahre sahen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ein außerordentliches Wachstum des höheren Bildungssystems.[5] Ähnliche Expansionsprozesse gab es schon früher, zumeist unter den Bedingungen der sozialen Aufbruchsdynamik nach Kriegen und Wirtschaftskrisen. «Die Ausdehnung der Universität ist ein unaufhaltsamer Prozeß», schrieb Karl Jaspers bereits 1946.[6] Durchweg entstanden die deutschen Universitäten in Schub- und Blütephasen, als Antwort auf ökonomische oder politische Erschütterungen. Zwischen dem späten 14. und dem Ende des 16. Jahrhunderts kam es zu regelrechten Etablierungswellen, denen wir die Geburt unserer ältesten Hochschulen verdanken: Heidelberg, Köln, Tübingen, Leipzig, Erfurt, Greifswald, Rostock, Würzburg, Mainz, Freiburg, Marburg und Jena. Im 18. Jahrhundert löste die Aufklärung ein neues Gründungsfieber aus, mit dem Aufbau der Universitäten Halle, Braunschweig, Göttingen, Münster, Erlangen-Nürnberg und der Bergakademie Freiberg. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte dann die Entwicklung technischer Wissenschaften zur Entstehung der Hochschulen Aachen, Darmstadt, Dresden und München, deren Kernauftrag die Qualifizierung künftiger Ingenieure bildete.
Das Gründungsgeschehen der Zeit zwischen 1965 und 1975 war also keineswegs ein singulärer Vorgang, was die Zahlen betraf. Bemerkenswert ist dagegen die Tatsache, dass es sich noch einmal um einen öffentlichen, vom Staat initiierten Ausbau des Hochschulsystems handelte. In allen späteren Phasen, verstärkt ab der Jahrtausendwende, wuchs in Deutschland vor allem die Quote privater Hochschulen, während der Anteil staatlicher Einrichtungen annähernd gleichblieb. Die 2018 erfolgte Gründung der Technischen Universität Nürnberg durch das Land Bayern bildet hier eine Ausnahme. Die privaten Hochschulen sind überwiegend von hohen Graden der Spezialisierung im Lehrangebot gekennzeichnet. Sie spiegeln die wachsende Fragmentierung der Studiengänge wider, deren Gesamtzahl im Jahr 2019 bereits über 20.000 lag. Die nach 1980 einsetzende Abkehr von der Universität als Institution mit flächendeckendem Fächerspektrum ist auch vor dem Hintergrund der disziplinären Differenzierung zu betrachten.
Die erheblichen Anstrengungen bei der Neugründung von Hochschulen konnten in den siebziger Jahren allerdings nicht verhindern, dass überfüllte Hörsäle und Seminarräume zum Alltag gehörten. Weil sich die Abiturientenquote in schnellem Tempo steigerte – sie verdreifachte sich zwischen 1960 und 1980 –, vermochten die Hochschulen kaum ausreichende Lehrkapazitäten aufzubauen. Gerade Fächer wie Jura, Germanistik und Medizin hatten schon in dieser Zeit mit hohen Studierendenquoten zu kämpfen. Die Zahl der Berufungen hielt zunächst nicht Schritt mit der Vermehrung der Studienplätze, weil qualifiziertes wissenschaftliches Personal fehlte. Zwischen 1965 und 1970 erfolgte immerhin eine erste Berufungswelle; die Zahl der Professuren stieg von 4575 im Jahr 1960 auf 20.771 im Wintersemester 1971/72. Der Ausbau kam dann am Beginn der achtziger Jahre auf dem Niveau von 30.000 Professuren zu einem weitgehenden Stillstand. Zwischen 1980 und 2000 stagnierte die Professurenquote, trotz leichter Zuwächse aufgrund der Wiedervereinigung unmittelbar nach 1990 (mit einem Anstieg auf 37.672 bis 1995). Während in den sechziger Jahren 70 Prozent der Assistenten eine Aussicht auf eine spätere Professur hatten, galt das 1975 nur noch für 9 Prozent.[7] Diese Entwicklung hatte fatale Folgen für die nachkommende Wissenschaftlergeneration, denn es gab nun einen Generationsblock der um 1935 Geborenen, die unverändert bis zur Pensionierung auf ihren Professuren verblieben. Dieses Lehrstück mangelnder Planung wiederholte sich in anderen Phasen der deutschen Universitätsgeschichte mehrfach, wobei bloß in einem Fall – nach der Wende – eine Bedarfssituation entstand, die tatsächlich niemand so hatte erwarten können.
An zahlreichen Universitäten schuf man neue Professuren über den direkten Beförderungsweg. Akademische Räte, Assistentinnen und Assistenten wurden auf diese Weise, häufig ohne Habilitation, auf Lehrstühle berufen, für die sie durch ihre Forschungsleistungen nur bedingt qualifiziert waren. Gerade in gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen Fächern wie Politologie, Soziologie, Psychologie, Pädagogik und Germanistik, die damals massenhafte Nachfrage erfuhren, erhöhte sich in den Jahren zwischen 1970 und 1975 die Zahl der Professuren rasant. Diese rasche Aufstockung sollte dazu beitragen, die Abschlussquoten langfristig zu verbessern. Sie nämlich waren nicht proportional gestiegen, sondern stagnierten vielfach. Das galt für das Lehramt, aber auch für Diplomexamina. Die Studiendauer nahm seit 1968 dramatisch zu; der Anteil derjenigen, die zehn Jahre und länger immatrikuliert waren, vermehrte sich stetig. Nur wenige brachen ihr Studium sofort ab, etliche blieben eingeschrieben, obwohl sie keinen Abschluss mehr anstrebten. Die Politik brachte mögliche Zwangsexmatrikulationen ins Gespräch, die Langzeitstudierende aus dem Hochschulsystem ausschließen sollten. Schon 1966 unterbreitete der Wissenschaftsrat Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums an den wissenschaftlichen Hochschulen, die eine Regeldauer von vier Jahren vorsahen. Diese Norm wich von der herrschenden Situation erheblich ab, doch das Instrument der Zwangsexmatrikulation setzte sich nicht durch, weil es politisch keine Mehrheit fand.
Im Zuge der heutigen Kritik an den aktuellen Universitätsverhältnissen, die von wachsendem Effizienzdenken, gesteigertem Wettbewerb und zunehmender Formalisierung bestimmt werden, begegnet man bisweilen einer Verklärung der in den siebziger Jahren herrschenden Studienbedingungen. Richtig ist, dass es damals hohe Freiheitsgrade mit vielfältigen Optionen ohne strenge Regeln und Zwänge gab. Die relativ geringe Verbindlichkeit des Lehrprogramms mit einer niedrigen Zahl an Prüfungsverpflichtungen ermöglichte den Studierenden weitaus stärker als heute, andere Fächer kennenzulernen, über den engeren Rahmen der eigenen Disziplin hinauszuschauen und intellektuelle Erfahrungen in anderen Wissenschaftskulturen zu sammeln. Es ging weniger um das Erlernen von Prüfungsstoff als um die Erkundung unterschiedlicher Arbeitsgebiete, Methoden und Denkstile. Selbst traditionelle Paukfächer wie die Rechtswissenschaft und die Medizin boten den Studierenden mehr Gelegenheit zu geistigen Experimenten in anderen Disziplinen, als das heute der Fall ist. Sofern man es ernst nahm, konnte dieses Konzept jenseits des Fachwissens Allgemeinbildung, kritisches Denken und Urteilsvermögen vermitteln.
Die Kehrseite der akademischen Selbstbestimmung, die im universitären Betrieb der siebziger Jahre gewährt wurde, war allerdings deutlich zu erkennen. Es mangelte an klaren Strukturen im Unterrichtssystem, an verbindlichen Prioritäten und nachvollziehbaren Empfehlungen. Das Freiheitsversprechen verbarg in nicht wenigen Einzelfällen eine Tendenz zur Gleichgültigkeit, mit der Lehrende den ständig wachsenden Seminar- und Übungsgruppen entgegentraten. In den großen Fächern scheiterten etliche Studierende, weil sie die Unabhängigkeit, die man ihnen zugestand, nicht wirklich nutzen konnten. Orientierungslosigkeit, Vereinsamung und Überforderung waren häufig die Folgen. Zahlreiche Lehrende betrachteten ihre eigenen Unterrichtsverpflichtungen als lästiges Übel, das nicht mehr Zeit als unbedingt nötig binden sollte. Seminararbeiten wurden nur flüchtig gelesen, Bewertungen und Rückmeldungen blieben aus, eine tatsächliche Vorbereitung auf das Examen fand nicht statt.
In vielen Fächern – vor allem der Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch in Disziplinen wie Mathematik und Informatik – gab es kaum studienbegleitende Prüfungen. Wer ins Examen einstieg, hatte seine letzte Klausur zumeist im Abitur geschrieben. Aus Angst wurde die Anmeldung zur finalen Prüfung regelmäßig verschoben, was die ohnehin langen Studienzeiten nochmals prolongierte. Die Zahl der Abbrecher wuchs stetig an, so dass trotz eines massiven Ausbaus des Lehrkörpers die Abschlussquoten konstant blieben.[8] Mitte der siebziger Jahre zogen große Hochschulen wie die Freie Universität Berlin erste Konsequenzen aus den sich häufenden Konfliktfällen bei Studierenden und bauten psychologische Beratungsstellen auf. Examenskolloquien wurden Ende der siebziger Jahre in den Massenfächern zum Standardprogramm, konnten aber die Ängste vor Prüfungsformen, mit denen die meisten seit der Schule nicht mehr in Berührung gekommen waren, kaum mildern. Das Bild, das die Universitäten dieser Zeit boten, war zwiespältig; Grund zur nachträglichen Verklärung gibt es keinesfalls.
Trotz der Vergrößerung des Lehrkörpers blieben die Betreuungsverhältnisse angesichts stetig steigender Abiturquoten schlecht. Die Neuberufungen fingen den parallelen Aufwuchs der Studierendenzahl nur bis zur Mitte der siebziger Jahre auf. Danach vollzog sich, politisch gewollt, die sogenannte «Untertunnelung des Studentenbergs», wie es damals mit einer verräterischen Metapher hieß. Ziel war es, die gewachsenen Immatrikulationszahlen ohne eine Aufstockung des Personalsockels zu bewältigen. Ein auf Initiative der Kultusministerkonferenz im November 1977 verabschiedeter Bund-Länder-Beschluss forderte, dass man die bestehenden Lehrpotentiale an den Universitäten maximal ausschöpfen müsse, um zusätzliche Einstellungen zu vermeiden.[9] Helfen sollte dabei die 1974 eingeführte Kapazitätsverordnung, die den Hochschulen auferlegte, mit jeder neu besetzten akademischen Position weitere Studienplätze zu schaffen. Ihr Geburtsfehler bestand darin, dass in einer Situation schlechter Betreuungsrelationen und massiver Überlastung der Status quo juristisch auf Dauer festgeschrieben wurde. Die Legislative ging gewissermaßen von der Illusion aus, dass an deutschen Hochschulen Betreuungsverhältnisse und Stellenschlüssel ideal seien. Da bis heute das Gegenteil der Fall ist und konstitutiver Mangel herrscht, zementiert das Kapazitätsrecht auch weiterhin die bestehende Lage, indem es die Hochschulen daran hindert, durch Personalaufbau für bessere Betreuungsrelationen zu sorgen. Es hat einen Teufelskreis geschaffen, aus dem es allein dann ein Entrinnen gibt, wenn die juristischen Rahmenbedingungen grundlegend verändert werden.
Ralf Dahrendorfs ehrgeiziger Plan einer offenen Bürger-Universität, der nicht nur die Erweiterung, sondern auch die qualitative Veränderung des Hochschulsystems anstrebte, wurde zunächst in Ansätzen realisiert. Die Gründungsprogrammatik der Universitäten Bochum, Bielefeld, Bremen und Konstanz trug die Spuren eines weitreichenden Reformkonzepts. Man wollte auf die alte Fakultätsstruktur verzichten, interdisziplinäre Arbeit durch übergreifende Fachgruppen jenseits der hergebrachten Institutsordnung fördern, Lehr- und Forschungssemester für die Professorinnen und Professoren kontinuierlich einander abwechseln lassen, die akademischen Curricula offener gestalten und nicht zuletzt partizipative Modelle für Entscheidungsprozesse unter Einbeziehung von Mittelbau und Studierenden etablieren.[10] Dahinter steckte der Versuch, die Neugründungen auch im Bereich von Selbstverwaltung und Organisationswesen mit frischen Impulsen zu versehen. Hier flossen die liberalen Ideen Dahrendorfs ebenso ein wie die seit Ende der sechziger Jahre aufkommenden studentischen Forderungen nach mehr Beteiligung an der Weiterentwicklung der Unterrichtsformen und -inhalte. Als Vorbild galten insbesondere für Bielefeld und Konstanz die flacheren Hierarchien amerikanischer Universitäten. Der Verzicht auf das hergebrachte Lehrstuhlprinzip war die wichtigste Konsequenz dieser Ausrichtung, die an manchen Reformuniversitäten früher als andernorts vollzogen wurde, ohne dass sich die Welt damit grundstürzend änderte. Nach 1975, als die differenzierende Besoldung gemäß den Gruppen C3 oder C4 eingeführt wurde, gab es den klassischen Ordinarius nicht mehr, was aber keineswegs bedeutete, dass das System der Hierarchien verschwand. Jetzt unterschieden sich die Professuren durch die Besoldung und die Ausstattung, und zwar an Traditions- wie an Reformuniversitäten. Gerade die Zahl der zugewiesenen Assistentenstellen, die Sekretariatskapazitäten und die Größe des Dienstzimmers, der Laborflächen sowie des Sachbudgets bildeten maßgebliche Indikatoren der Macht. Der Ordinarius mit seinem autoritären Anspruch, seinem gleichsam aristokratischen Rollenverständnis und dem habituellen Fachegoismus war zwar Vergangenheit, doch die akademische Welt blieb ein gestuftes System mit nicht nur symbolischen Unterschieden.[11]
Eine der größten Reformbaustellen wurde die Lehrerbildung. Vor allem unter Hinweis auf den erwartbaren Lehrermangel hatte man gemäß den Forderungen Georg Pichts und anderer Ende der sechziger Jahre die hochschulischen Kapazitäten erweitert. Nun ging es zusätzlich um eine Umstrukturierung der Curricula; neben den Fachwissenschaften spielten Didaktik und Erziehungswissenschaften eine wachsende Rolle. Das war auch dem Umstand geschuldet, dass die Lehrerbildung in Deutschland eine nur unzureichende pädagogische Fundierung besaß, was den Ausbau der Schulen erschwerte. Allerdings fehlte es in den meisten didaktischen und erziehungswissenschaftlichen Feldern an akademischem Nachwuchs. Die theoretischen Debatten über die Desiderate einer modernen, pädagogisch informierten Lehrerbildung schritten zügiger voran als die Berufungsprozesse an den Universitäten. In anderen Fachkulturen sah man den neuen Auftrag als rein quantitatives Projekt. Man wollte ‹mehr› Mediziner, Juristen, Ingenieure, ohne dass die Lehrpläne deshalb tiefgreifend umgestellt wurden. Die konservative Haltung der meisten Professoren provozierte einige Jahre später erhitzte Debatten über die politische Funktionalisierung dieser Fächer, die den engeren Wirkungskreis akademischer Diskurse weit hinter sich ließen.[12]
Die Desillusionierung erfolgte schneller, als mancher vermutet hätte. Von den Reformansprüchen war nach einigen Jahren kaum etwas übrig. Das sozialpolitische Ziel, jungen Menschen aus nicht-privilegierten Milieus den Zugang zur Hochschule zu verschaffen, blieb ein leeres Versprechen. Seit der Mitte der sechziger Jahre stieg die Quote der Arbeiterkinder, die ein Studium aufnahmen, zwar langsam an und erreichte 1973 immerhin zwölf Prozent. Danach aber stagnierte die Entwicklung, und eine Dekade später war die betreffende Zahl lediglich auf 16 Prozent gewachsen.[13] Gerade junge Frauen aus sozial schwächeren Familien hatten in diesen Jahren kaum eine Chance auf ein Studium. So steigerte sich zwar der Anteil der Studentinnen von 13,1 Prozent im Jahr 1947 bis 1970 kontinuierlich auf 30,9 Prozent, jedoch blieb er unter den Studierenden aus Arbeiterhaushalten auffallend niedrig.[14] Die bei liberalen und sozialdemokratischen Bildungspolitikern verbreitete Annahme, dass eine Öffnung der Hochschulen automatisch zu größerer Chancenvielfalt, tendenziell sogar zu Chancengleichheit führen werde, erwies sich als Täuschung. Die Gründe dafür lagen vor allem im Bereich der frühkindlichen Erziehung und der mangelnden grundschulischen Förderung, deren Einfluss auf die berufsbiographische Entwicklung junger Menschen in Deutschland nur langsam erkannt wurde.[15]
Auch andere Ambitionen ließen sich nicht durchsetzen. Die Reformuniversitäten ähnelten sich schneller als erwartet den traditionellen Hochschulen alten Typs an. Fast überall wurden die vertrauten Fakultätsstrukturen wiedereingeführt, die üblichen Deputate fixiert und zentralistische Organisationsmodelle verwirklicht. Lediglich die Universität Konstanz hält bis heute an einer Binnenordnung fest, die dem ursprünglichen Ansatz verpflichtet ist.[16] Sie verzichtet auf die gängige Fakultätsgliederung zugunsten disziplinärer Sektionen, was das Gespräch zwischen den Fächern fördert, weil die üblichen Grenzen zwischen den Instituten aufgelöst sind. Die Universität Bochum dagegen etablierte relativ schnell die traditionelle Fachbereichsordnung, und Ähnliches vollzog sich in Bielefeld. Hier erinnert die Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft weiterhin an die Gründungsambition, weniger in klassischen Fächern als in übergreifenden Zuschnitten zu denken. Die Einsicht jedoch, dass sich, was als ‹übergreifend› galt, stetig veränderte und für institutionelle Strukturen nicht immer maßgeblich sein konnte, führte an den meisten Reformorten zu einer gewissen Sympathie für die gängigen Instituts- und Disziplinenordnungen.
Allgemein war die Tendenz auffallend, neue Ordnungen nach einiger Zeit durch konventionelle Organisationsprinzipien zu ersetzen.[17] Sie galt auch für das vorwiegend in Nordrhein-Westfalen praktizierte Reformmodell der Gesamthochschule, das dauerhaft keinen Bestand hatte.[18] Die in den siebziger Jahren neu gegründeten Einrichtungen in Duisburg, Essen, Paderborn, Siegen, Wuppertal und Kassel sowie die Fernuniversität Hagen verbanden Elemente einer Universität mit denen einer Fachhochschule. Sie boten Studiengänge an, in die man sich auch auf der Grundlage eines Fachabiturs einschreiben konnte. Die Integration von Universität und Fachhochschule unter einem gemeinsamen Dach sollte die traditionellen Gräben zwischen den beiden Modelltypen überwinden und wechselseitige Durchlässigkeit ermöglichen. In der Praxis bewährte sich dieser Ansatz kaum, weil beide Welten nicht wirklich zueinander fanden. Bereits in den achtziger Jahren erhielten die Gesamthochschulen den Ergänzungstitel ‹Universität›, der anzeigen sollte, welcher institutionelle Typus hier eigentlich dominierte. Zum 1. Januar 2003 wurden die Gesamthochschulen komplett in Universitäten umbenannt und die fachhochschulischen Studiengänge ausgegliedert. Damit verschwand eines der letzten Reformmodelle der Bildungsoffensive nach längeren Debatten in der Versenkung.
3. Politisierung und Massenbetrieb
Seit Ende der sechziger Jahre setzten die Wissenschaftsministerien der Länder durchweg auf eine rasche Erweiterung der Universitäten. Die Zahl der Professuren wuchs bis 1975 in stetigem Tempo an, wobei oft Kompromisse bei der akademischen Eignung gemacht wurden. Klaus Heinrich, der Berliner Religionsphilosoph und Gründungsstudent der Freien Universität, sprach 1987 im Rückblick von einer «wundersamen Stellenvermehrung».[1] Der Historiker Götz Aly schreibt über diese Entwicklung, die um 1972 ihren Höhepunkt erreichte: «Planstellen gab es plötzlich im Überfluss. An vielen neu gegründeten Universitäten erlangte man Assistenzprofessuren ohne Promotion, Professoren wurden zu Lehrstuhlinhabern, die noch nie ein Buch oder einen bedeutenden Aufsatz verfasst hatten.»[2] Die Ausweitung der Hochschulen schien mit einer Absenkung der Qualitätsschwellen teuer erkauft. Die Vergrößerung der Stellenkapazitäten, die schnelle Zugänge zu Professuren verschaffte, löste im Übrigen keinen Optimismus aus, sondern war begleitet von Desillusionierung und Anspannung. Zur deprimierten Stimmung an deutschen Hochschulen trug vor allem die Verhärtung der politischen Verhältnisse bei.
Jürgen Habermas hatte noch im Mai 1969 vor der Westdeutschen Rektorenkonferenz die Konsequenz der von Georg Picht gelieferten Diagnose erläutert, derzufolge Bildungs- und Sozialpolitik zusammengehören: «Der Verwissenschaftlichung der Berufs- und Alltagspraxis entspricht eine Vergesellschaftung der in Hochschulen organisierten Lehre und Forschung.»[3] Dieser Anspruch reflektierte eine Überzeugung, von der sich die politischen Debatten an vielen deutschen Universitäten seit 1967 leiten ließen. Er verlangte der universitären Lehre und Forschung eine inhaltlich und formal manifeste sozialpolitische Ausrichtung ab. Im Kern betraf er die Umwandlung der Universität in einen hierarchiefreien Raum, der allen Statusgruppen Gelegenheiten zur gleichberechtigten Teilnahme an Entscheidungsprozessen verschaffte. Denn die Analogie zwischen demokratischer Gesellschaft und Hochschule implizierte zuallererst die Möglichkeit der Partizipation und die Aufhebung der autoritären Ordnungsstrukturen, die das akademische Leben traditionell prägten. Sie betraf aber auch eine Neukonzeption des Wissenschaftssystems im Blick auf seine öffentliche Relevanz, seinen Beitrag zur Lösung künftiger Probleme und zu größerer sozialer Gerechtigkeit. Beide Ansätze scheiterten gleichermaßen; weder das Partizipationsversprechen noch die Vergesellschaftung des Wissenschaftsbegriffs führten zu gedeihlichen Lösungen, weil der Streit der akademischen Statusgruppen über das, was sie genau leisten sollten, unvermeidlich war.[4] Nicht allein die Verschiedenheit von sozialen und universitären Modernisierungsmodellen verhinderte, wie Jürgen Mittelstraß annahm, eine überzeugende Umsetzung der neuen Ansprüche.[5] Vor allem unterband der weitreichende Dissens darüber, welche Ziele die Demokratisierung der Universität eigentlich befördern sollte, eine produktive Zusammenarbeit ihrer Einzelgruppen. Letztlich lenkte er sogar von der notwendigen Diskussion über inhaltliche Fragen ab; Aspekte der Bildungsgerechtigkeit, der pädagogischen Gestaltung des akademischen Unterrichts, der Entwicklung verlässlicher Karrierepfade und der Forschungsmission wurden in den Jahren der erregten Universitätsdebatten nur selten konkret erörtert.
In den Vordergrund traten stattdessen Überlegungen zum öffentlichen Auftrag der Institution. Sie verbanden sich mit langen Debatten über die Analogien zwischen Politik und Universität, den Grad des gesellschaftlichen Engagements, das Recht zum Eingriff in die soziale Ordnung und den kritischen Impetus der Wissenschaft. Der Weg in eine neue Hochschule wurde bereits vor dem Symboldatum 1968 diskutiert. An vielen Universitäten – in Berlin, wenig später auch in Frankfurt, München, Köln und Göttingen – suchte man seit Mitte der sechziger Jahre neue Strukturen für eine stärker partizipative Gremienordnung zu schaffen. Im Zuge der Studentenproteste gegen die Notstandsgesetze und einer damit verbundenen neuen Form der Politisierung kamen Forderungen auf, die dem galten, was Habermas die ‹Vergesellschaftung› von Lehre und Forschung nannte. Dazu gehörte das Postulat, dass Studierende und Assistentenschaft – der sogenannte Mittelbau – neben den Professoren in Institutsräten und Akademischen Senaten jeweils ein Drittel der Stimmen führen sollten (die vierte Statusgruppe – die wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiter – hatte damals noch keine starke Lobby). Studieninhalte und Prüfungsordnungen müssten, hieß es, von den Studierenden mit Blick auf soziale Relevanz und politisches Interesse aktiv mitgestaltet werden. Ebenso erwartete man, dass bei Berufungen auf Lehrstühle die Voten der Studierenden und des Mittelbaus denen der Professoren die Waage hielten.
Habermas forderte bereits am 20. Januar 1967 im Rahmen eines Vortrags an der Freien Universität ausdrücklich, dass Hochschulen ihre internen Entscheidungsprozesse «rationalisieren» müssten, indem sie einen Konsens «in herrschaftsfreier Diskussion» zu erzielen suchten.[6] Genau diese Gleichsetzung von ‹Rationalisierung› und ‹herrschaftsfreiem Diskurs› – ein Leitmotiv der Kommunikationstheorie, die Habermas Jahre später entwickelte – erwies sich als Wunschphantasie. Die spezifische demokratische Verfasstheit der Universität, in der sich die vernünftige Debattenstruktur der Wissenschaft selbst spiegeln sollte, wurde im Elend der Gremienuniversität zu Grabe getragen. Diese sorgte in den frühen siebziger Jahren für Petrifizierungen schlimmster Art, die das politische Diskursgeschehen erstarren ließen in den Kaderbildungen der Aktivisten und Ideologen. Nicht die Konsensorientierung, sondern eine interessengeleitete Abschottung der einzelnen Statusgruppen prägte Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre die meisten Gremiendebatten.
Rudi Dutschke, der Protagonist der Studentenbewegung, gab in einem Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger, das im August 1968 im Kursbuch erschien, als Zielsetzung aus, dass «die Gesellschaft eine große Universität» werden müsse.[7] Das bedeutete nicht nur, ein Bildungsprivileg zu sozialisieren und den Massen zugänglich zu machen. Dutschkes Programm beruhte vor allem darauf, die radikaldemokratischen Grundlagen eines neu zu schaffenden Universitätssystems modellhaft auf die Gesellschaft zu übertragen. Das Aktionsziel bezog sich also nicht allein auf die Expansion der Hochschulen, wie sie die Reformpolitik von SPD und FDP betrieb, sondern auf die Enthierarchisierung der Universitäten und die breitenwirksame Übersetzung ihrer Diskurskultur in die Gesellschaft. Auch Kurt Sontheimer forderte 1968, dass die Universität durch den Abbau von autoritären Strukturen ein Vorbild für die demokratische Sozialordnung werden müsse. Zugleich schloss er die Umkehrung dieses Satzes aus; die bundesdeutsche Demokratie war, so ließ sich folgern, kein Modell für die Universität, weil sie ihren in der Verfassung fixierten Freiheitsanspruch noch nicht vollauf verwirklicht hatte.[8] Das Ziel, die Hochschule zum Musterfall neuer Politikformen zu erheben, blieb freilich eine utopisch anmutende Programmatik, denn die universitäre Realität entwickelte sich in eine ganz andere Richtung. Aus dem von Habermas geforderten Vergesellschaftungsimpetus ergab sich ein ubiquitäres Politikkonzept, das die Hochschulen auf eine soziale Dauermission zu verpflichten suchte. Die lange Zeit zementierten Grenzen zwischen politischen und akademischen Diskursen wurden nach 1968 absichtsvoll aufgelöst, mit dem Effekt, dass man eine universitäre Allzuständigkeit für nahezu jedes Thema reklamierte.[9] In dem Maße, in dem sich die neue Hochschule als Ort der allgemeinen Politisierung definierte, verlor sie die Fähigkeit, ihre spezifische Rolle im sozialen System zu reflektieren. Omnipotenz und Hybris erwiesen sich als verfehlte Haltungen für die Überwindung der autoritären Ordinarienuniversität.
Die Neigung zur Selbstüberschätzung war nicht nur bei den zunehmend zersplitterten marxistischen Studierendengruppen – von Maoisten über Trotzkisten bis zu prosowjetischen Lagern –, sondern ähnlich bei Mittelbau und linken Professoren zu beobachten. Tagesordnungen quollen über, die Themengebiete expandierten stetig, Fragen der zentralen Universitätsorganisation spielten automatisch ins gesellschaftliche Feld, und es existierte nichts, das nicht auch politisch in einem eminenten Sinne gewesen wäre. Akademische Senate befassten sich mit Dritter Welt und Kolonialismus, dem Krieg in Vietnam, der chinesischen Kulturrevolution, dem Weg Kubas und der sowjetischen Afrikastrategie; sie konnten keine ihrer genuinen Sachgebiete und Aufgaben mehr erörtern, ohne dass die globale Lage in den Blick genommen wurde.[10] Darin offenbarte sich eine Haltung, die den universitären Diskurs nur als Vehikel für die Durchsetzung eigener Weltanschauungen begriff. Die Gremienpolitik galt gerade nicht dem Ringen um die bestmögliche Hochschule, sondern der Manifestation ideologischer Positionen. Dafür sorgte die Generalformel vom universitären Gesellschaftsmodell, in deren Namen ein intellektueller Hegemonialanspruch mit Allzuständigkeit bei nahezu jedem politischen Thema erhoben wurde.[11]
Hinzu kamen aggressive Formen des Streits, die auch nach Gremiensitzungen noch lange nicht endeten.[12] Bemerkenswert war dabei die Schärfe der Konflikte innerhalb der sich als progressiv definierenden Fraktionen, wie sie exemplarisch an der Freien Universität Berlin zutage trat. Rolf Kreibich, der von linken Listen gewählte Präsident, hatte anlässlich seiner Amtsübernahme im November 1969 angekündigt, er werde in Krisenfällen, anders als seine Vorgänger, keine Polizei auf den Campus rufen. Anfang Juni 1972 musste er dieses Versprechen brechen, nachdem es bei der Besetzung des Germanistischen Instituts zu schweren Sachbeschädigungen gekommen war.[13] Die Strategie der radikalmarxistischen Gruppen zielte darauf, sich gegen ihnen prinzipiell nahestehende Fraktionen scharf abzugrenzen. Obwohl der Präsident den systemkritischen Akteuren mit offenen Gesprächsangeboten begegnete, galt er ihnen als Klassenfeind und Vertreter des Establishments, dessen wahre Gesinnung durch gezielte Provokationen entlarvt werden sollte. Die linken Fraktionen bekämpften sich untereinander zuweilen erbitterter, als sie es in der Konfrontation mit konservativen Hochschullehrern taten. Es war die Zeit der Sektenbildung und der Mikrostrategien, von denen in merkwürdiger Weise der große weltpolitische Anspruch abstach, der alle Debatten befeuerte. Sogar die professorale Statusgruppe war von solchen Tendenzen gekennzeichnet. Man kandidierte auf konkurrierenden Listen, organisierte Kampagnen für einen Sitz im Fachbereichsrat und führte Stichwahlen um Selbstverwaltungsämter durch.