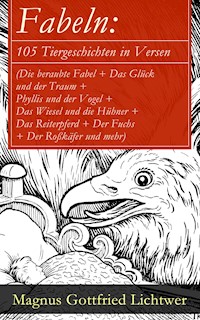
Fabeln: 105 Tiergeschichten in Versen (Die beraubte Fabel + Das Glück und der Traum + Phyllis und der Vogel + Das Wiesel und die Hühner + Das Reiterpferd + Der Fuchs + Der Roßkäfer und mehr) E-Book
Magnus Gottfried Lichtwer
0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Fabeln: 105 Tiergeschichten in Versen (Die beraubte Fabel + Das Glück und der Traum + Phyllis und der Vogel + Das Wiesel und die Hühner + Das Reiterpferd + Der Fuchs + Der Roßkäfer und mehr)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Magnus Gottfried Lichtwer der Jüngere (1719 - 1783) war ein deutscher Jurist und Fabeldichter in der Zeit der Aufklärung. Inhalt: Die beraubte Fabel Das Glück und der Traum Phyllis und der Vogel Das Wiesel und die Hühner Das Reiterpferd Der Fuchs Die Laster und die Strafe Boreas und die Erde Der Affe und der Bär Der Roßkäfer Der Strauß und die Vögel Das schlechte Tuch Der Löwe und der Wolf Das aus der Erde wachsende Lamm Der Mohr und der Weiße Phöbus und sein Sohn Der Riese und der Zwerg Der Wandersmann und der Kolibri Der Diamant und der Bergkrystall Die Schlange Die Katzen und der Hausherr Die Tulipane Der Hirte und die Heerde Der Vater und die drei Söhne Der Uhu und die Lerche Die Gartenlust Der Adler und der Schmetterling Die zwei alten Weiber Die zwei Weisen in Peru Der Bäcker und die Maus Der Hänfling Der Hühnerhund Die zwei Jupiter Der Vogel Platea und die Reiger Die wilden Schweine Der junge Kater Der Kapaun und das Huhn Der Esel und die Dohle Der Wandersmann und die Sonnenuhr Der Rhein Der Weise und der Alchymist Ein Collektivum zu Frankfurt a. M. Der Maler Die Fische Der Priester und der Kranke Jupiter und die Winde Der Maulwurf Der Satyrenschreiber Des Vulkan's drei Ehen Sokrates und der Wittwer und viel mehr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Fabeln: 105 Tiergeschichten in Versen (Die beraubte Fabel + Das Glück und der Traum + Phyllis und der Vogel + Das Wiesel und die Hühner + Das Reiterpferd + Der Fuchs + Der Roßkäfer und mehr)
Inhaltsverzeichnis
Biographie des Dichters.
Inhaltsverzeichnis
Magnus Gottfried Lichtwer.
Geboren 30. Januar 1719. Gestorben 7. Juli 1783.
Lichtwer, der berühmte Fabeldichter, ward am 30. Januar 1719 zu Wurzen geboren. Sein Vater, kursächsischer Beamter, ein vermögender, angesehener Mann, gab dem Knaben die sorgfältigste Erziehung; aber der Tod ereilte ihn zu frühe, sie zu vollenden. Lichtwer studirte in Leipzig die Rechte. Daneben trieb er fleißig neuere Sprachen und widmete einen bedeutenden Theil seiner Zeit der Lektüre der römischen und griechischen Dichter. Sorgfältig bewarb er sich schon damals um den Ruf eines gebildeten Weltmanns. Er versäumte nicht, Alles zu lernen, was dazu dienen konnte, sich bemerklich und bei der feinen Welt beliebt zu machen. Sein Umgang beschränkte sich fast ganz auf den mit vornehmen Familien; er war ein trefflicher Tänzer, Reiter und Fechter, und erschien nie anders, als im gewähltesten Kleide. Schon damals prägten sich die Hauptzüge seines Charakters vollkommen aus. – 1741 verließ Lichtwer die Universität und bewarb sich in Dresden um eine Anstellung. – Der Versuch mißglückte. Er wandte sich nach Wittenberg und setzte seine juristischen Studien eifrig fort. Er erwarb hier der Rechte und Philosophie Doktorwürde. Von Wittenberg riefen ihn Erbschaftsangelegenheiten nach Quedlinburg; er wurde bei dem Ordnen derselben in Prozesse verflochten, welche seine Anwesenheit an diesem Orte und in Halberstadt für mehre Jahre nothwendig machten. In diese Periode fällt die Dichtung seiner Fabeln. Sie wurden zuerst 1748 in Leipzig gedruckt; anfänglich ohne Lichtwer’s Namen. Lichtwer bewarb sich von Neuem um einen Staatsdienst; aber eben so vergeblich in Berlin wie in Dresden. Nach vielen mißlungenen Versuchen kaufte er sich ein Kanonikat im Halberstädter Capitel, verheirathete sich (1749) bald darauf, und verlebte einige Jahre glücklichen Schlaraffenlebens. Doch ward er dessen bald genug müde. Er begann seine Bewerbungen wegen einer Anstellung von Neuem, und endlich gelang es ihm, durch die Verwendung einiger Freunde, als Referent der preußischen Regierung zu Halberstadt, anfangs ohne Gehalt, beigegeben zu werden. Später ward er zum Rath befördert. –
1757 gab Lichtwer seine Fabeln, die, auf Gottsched’s Empfehlung, nachdem sie anfänglich ganz unbeachtet geblieben, sehr viele Leser fanden, in verbesserter Form in Berlin heraus. Jetzt erst nannte er sich als den Verfasser. Mendelssohn’s scharfe Kritik derselben half nur, sie im großen Publikum, das sie mit dem größten Beifall aufnahm, noch mehr zu verbreiten, und Ramler’s ungeschickte und unberufene Wiederherausgabe dieser Fabeln, in einer sie entstellenden Bearbeitung, wies das deutsche Volk mit Indignation zurück, und fachte Lichtwer’s höchsten Zorn an, der sich in den derbsten Ausfällen gegen Ramler äußerte. Lessing suchte den Letztern, seinen Freund, zu entschuldigen – und daraus entspann sich eine Fehde, welche zur Celebrität Lichtwer’s und seiner poetischen Produkte ungemein viel beitrug. 1760 machte Lichtwer mit seiner Familie (seine Gattin gebar ihm mehre Kinder) eine Reise nach Braunschweig und Wolfenbüttel; vermied aber geflissentlich eine Bekanntschaft mit Zachariä, Ebert, Gärtner, Schmidt und andern damaligen Stimmführern im Felde der Dichtkunst, wozu jene Reise so schöne Gelegenheit bot. – Ueberhaupt blieb er dem Umgang und Verkehr mit Geistesverwandten immer fremd. Sogar den trefflichen Gleim mied er in Halberstadt auf eine höchst sonderbare Weise. Von Charakter argwöhnisch, eifersüchtig und dünkelhaft, fand er sich am wohlsten in Umgebungen, die ihn als ein Wesen höherer Art betrachteten, und seiner bis zum Lächerlichen gehenden Eitelkeit, die Herkunft, Reichthum, Titel und äußere Ehre zu überschätzen stets bereit war, gefällig oder gutmüthig fröhnten. Zudem war Lichtwer gar ein trefflicher Hauswirth – und die Mehrung seines Vermögens war stets ein Hauptgegenstand seiner Sorgen und Mühen. Auch in dieser Beziehung sagte ihm Geselligkeit, die so manches Opfer von der Geldliebe fordert, nicht zu; – seine Berufsgeschäfte als Beamter wurden der gewöhnliche Vorwand, Besuche, die er scheute, von sich abzuweisen.
Die Dichterlaufbahn verließ Lichtwer mehr und mehr – und endlich für immer. Er gab sich ganz dem Geschäftsleben hin, in dem sein ohnehin förmlicher Geist sich am meisten behagte. – Seinen Beruf als Richter erfüllte er mit der ängstlichsten Gewissenhaftigkeit, und gerieth darüber nur zu oft in unerträgliche Breite. Er saß ganze Nächte hindurch eingedämmt in Akten und arbeitete bis zur Erschöpfung. – Seine Gesundheit erlag diesen Anstrengungen, und ein unglücklicher Zufall – ein Verweis von einem Obern, dem Großkanzler Carmer, in Gegenwart des ganzen Kollegiums und der Subalternen Lichtwer’s – den er sich durch eine auch die größte Geduld ermüdende Breite und Weitschweifigkeit zuzog, wurde ihm, dem Tiefgekränkten, der Nagel zum Sarge. Lichtwer starb in seinem Hause zu Halberstadt in der Nacht vom 6. zum 7. Juli 1783. Die Gruft unter der Moritzkirche ist seine Grabstätte. Eine Marmortafel bezeichnet die Stelle.
Lichtwer’s Charakter war, bei allen Schwächen, immer der eines Ehrenmannes, eines rechtschaffenen Christen, eines trefflichen Vaters und Gatten. Er war von mittler Statur, klein, von gutem Aussehen, immer sehr zierlich gekleidet. Sehr viel hielt er auf äußern Anstand und auf Bewahrung äußerer Würde. Darum erschien er Andern steif, stolz, kalt und abgeschlossen. – In spätern Jahren galt ihm der Geschäftsmann, der Beamte über Alles; und er wies jede nicht mit demselben in Beziehung tretende Annäherung gemeiniglich unsanft und schroff zurück. Sein einmal gegebenes Wort war ihm heilig; aber um so vorsichtiger war er auch mit seinen Versprechungen. Gegen seine Subalternen war er, ohne seiner Würde etwas zu vergeben, leutselig; kurz: unter der steifen Hülle verbarg er einen recht achtungswerthen, einen vortrefflichen Menschen.
Lichtwer’s Fabeln.
Erstes Buch.
Inhaltsverzeichnis
Muse! die du weißt, was Thier’ und Bäume sagen, Wovon der Vogel singt, was Fisch und Wurm beklagen, Ich bitte, sage mir, wie reden Löw’ und Maus? Wie drückt sich eine Gans, und wie ein Adler aus? Wovon schwatzt Schneck’ und Frosch? wie sprechen muntre Pferde? Was denkt der volle Mond? worüber seufzt die Erde? Wie redet die Natur? Es läßt ja ungereimt, Wenn roher Sänger Witz von Wuth der Lämmer träumt, Die Löwen weinen läßt, die Hasen drohen lehret, Gewächsen Flügel dreht, und die Natur verkehret. Aesopus dichtete natürlich, ohne Zwang; Aesop, der von der Maus bis an den Löwen sang, Und ohne der Natur was Falsches aufzubürden, Die Thiere reden ließ, wie Thiere reden würden. Die Wölfe dürsteten nach feiger Lämmer Blut, Der Hirsch pries sein Geweih, der Uhu seine Brut, Der Panther drohete, der Stier sprach von dem Stalle, Der Sperling plauderte, der Fuchs belog sie Alle. So sang der Phrygier; Nichts so sich widersprach, Floß jemals in sein Lied, ihm sang ein Phädrus nach, Und Alle, die ihm nach das Fabelreich durchstrichen, Erhoben ihren Ruhm, so weit sie Jenen glichen. Mein Mund versucht ihr Lied. Wie, wenn es nicht gelingt? Wer zweifelt, hat gewählt. Es sey gewagt, er singt.
Die beraubte Fabel.
Inhaltsverzeichnis
Es zog die Göttin aller Dichter, Die Fabel, in ein fremdes Land, Wo eine Rotte Bösewichter Sie einsam auf der Straße fand. Ihr Beutel, den sie liefern müssen, Befand sich leer; sie soll die Schuld Mit dem Verlust der Kleider büßen, Die Göttin litt es mit Geduld. Mehr, als man hoffte, ward gefunden, Man nahm ihr Alles; was geschah? Die Fabel selber war verschwunden, Es stand die bloße Wahrheit da. Beschämt fiel hier die Rotte nieder, Vergib uns, Göttin, das Vergehn, Hier hast du deine Kleider wieder, Wer kann die Wahrheit nackend sehn?
Das Glück und der Traum.
Inhaltsverzeichnis
Es lag und schlummerte in eines Hirten Laube Das Glück, das müde Glück, den meisten Theil der Nacht. Wenn es ein Held gewußt, er hätt’ es, wie ich glaube, Mit hunderttausend Mann bewacht. Hier flog ein Traum vorbei und störte seinen Schlummer, Ihm rief das halberwachte Glück: Du kömmst mir recht erwünscht bei meinem großen Kummer, Doch sage mir, woher kömmst Du so spät zurück?
Ich komme mit dem Morgenwinde, Versetzt der Schatten, aus der Stadt, Von einem wohlgestalten Kinde, Dem meine Gegenwart die Nacht verkürzet hat. Das Glück hob freundlich an zu lachen, Und sprach: wenn es Dir so gefällt, So sage mir, was Du für Sachen Ihm diese Nacht durch vorgestellt. Er sprach: ich kam mit Kutsch’ und Pferden, Die Thüren sprangen, als ich sprach, Mir trat mit sittsamen Geberden Ein Heer vergold’te Diener nach. Ich war Baron, und zwar kein neuer, Ich hatte Geld, ich wollte frein; Begütert, Herr Baron, und Freier, Die Wörter gehn durch Mark und Bein. Geschenke folgten jedem Blicke, Du weißt, was ein Geschenke thut, Und dieser Sprache, liebes Glücke, Sind doch die Mädchen gar zu gut. Zuletzt fiel ich ihr selbst zu Füßen, Ich bat sie, und erhielt ihr Wort, Sie gab mir ihre Hand zu küssen, Da kam der Tag, und trieb mich fort.
Indessen wird mein Kind gewiß vergnügt erwachen, Und sagt sie Niemand was von mir, So wird sie heimlich doch den ganzen Morgen lachen. Mir geht es nicht so gut, wie Dir, Antwortete das Glück mit traurigen Geberden, Ich kam vor kurzer Zeit in eines Kaufmanns Haus, Den ließ ich reich und edel werden, Es ward ein halber Graf daraus. Doch gestern wandt’ ich ihm den Rücken, Da hing er sich an einen Baum; Warum muß es Dir besser glücken, Bin ich nicht so wie Du ein Traum?
Phyllis und der Vogel.
Inhaltsverzeichnis
Es trug Damöt vor wenig Wochen Zu Phyllis, seiner Schäferin, Ein Thier, das er ihr längst versprochen, Ein abgerichtet Vöglein hin. Ach, sagte Phyllis, mein Damöt, Es ist recht schön, kann es auch singen? Ja, Kind, es singt, wie ein Poet; Ich werde dir nichts Schlechtes bringen. Wie freundlich dankte sie Damöten! Wer wünschte nicht, Damöt zu seyn? Sie schloß den fliegenden Poeten In ein vergittert Häuschen ein. Sie knackt’ ihm Hanf, sie gab ihm Brod, Das sie zuvor in Milch erweichte; Es hieß: der Vogel leidet Noth, So oft sie ihm das Futter reichte. Der Vogel, dem dergleichen Fülle Nie vor Gesicht gekommen war, Genoß sein Futter in der Stille, Und unterließ das Singen gar. Ei, sagte Phyllis, sing’ auch nun, Sieh’, was ich Gutes dir erzeiget. Der Vogel hatte mehr zu thun; Sie häuft sein Futter: nichts; er schweiget. Damöt, das will ich nicht vergessen, Rief Phyllis, daß ich dir geglaubt, Der Vogel hat so viel zu fressen, Und singt doch nicht, ist das erlaubt? Es blieb dabei. Hört, was geschah? Die Schäferin ging einst zum Schmause, Und blieb bis an den Abend da; Der Vogel hungerte zu Hause. Ergötzt er gleich nicht Phyllis Ohren, So war ihr doch der Vogel lieb, Sie schätzt ihn dies Mal für verloren, Ach! sagte sie, du armer Dieb, Indem ich hier getanzt, wirst du Vielleicht schon mit dem Tode ringen; Sie eilt nach ihrer Wohnung zu, Da höret sie den Vogel singen.





























