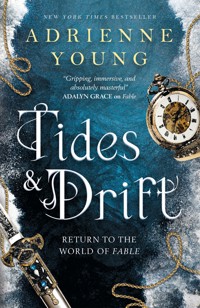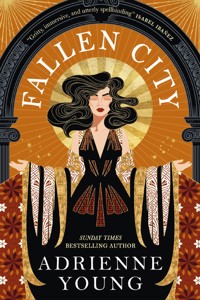17,48 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: arsEdition GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine mutige Frau, ein geheimnisvoller Mann und die Gefahren des Meeres ...
Fable ist eine Kämpferin. Seit sie als Kind von ihrem Vater ausgesetzt wurde, schlägt sie sich als Schürferin von wertvollen Steinen durch. Als sie eines Tages auf dem Handelsschiff von West anheuert, sieht sie eine Möglichkeit, ihren Vater zu finden und ihren rechtmäßigen Platz als seine Erbin einzunehmen. Doch das Meer und die, die es befahren, sind gefährlich. Und auch West ist nicht der, der er zu sein scheint. Fable muss um das kämpfen, was ihr gehört und was ihr Herz möchte ...
Der Auftakt einer magischen Romantasy-Dilogie, voller Abenteuer, Drama und einer Slow-Burn-Romance zum Mitfiebern!
Band 1: Fable - Der Gesang des Wassers
Band 2: Fable - Das Geheimnis der Mitternacht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ADRIENNE YOUNG
Fable
Der Gesang des Wassers
Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Schmalen
Du möchtest noch mehr von uns kennenlernen?
Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe München 2024
Text copyright © Adrienne Young, 2020
Cover copyright © Macmillan, 2020
Cover art copyright © Svetlana Belyaeva, 2020
Titel der Originalausgabe: Fable
Die Originalausgabe ist 2020 bei Wednesday Books (Macmillan),
New York, erschienen.
© 2024 arsEdition GmbH, Friedrichstraße 9, D-80801 München
Alle Rechte vorbehalten
© Text: Adrienne Young
Übersetzung: Elisabeth Schmalen
Covergestaltung: Grafisches Atelier arsEdition, unter Verwendung der Illustration von Svetlana Belyaeva Bildmaterial von puhhha/Shutterstock, korkeng/Shutterstock, irabel8/Shutterstock und Eva Bidiuk/Shutterstock
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text
und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN eBook 978-3-8458-5644-5
ISBN Printausgabe 978-3-8458-5643-8
www.arsedition.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Für Dad – es war ein ganzes Buch nötig,um Abschied zu nehmen.
40 . 25 . 3
144 . 24 . 4
228 . 21 . 2
3 . 16 . 5
86 . 21 . 11
112 . 29 . 3
56 . 16 . 7
Kapitel 1
Der Mistkerl ließ mich schon wieder sitzen.
Durch die Bäume sah ich den Sand unter den Füßen aufspritzen, als Koy und die anderen das Boot ins Meer schoben. Es glitt ins Wasser, und ich legte einen Zahn zu und jagte barfuß über die verschlungenen Wurzeln und Steine, die aus dem Weg herausragten. Kaum war ich aus dem Dickicht gebrochen, grinste Koy mir höhnisch zu und setzte das Segel.
»Koy!«, rief ich, aber falls er mich über die Brandung hinweg hörte, ignorierte er mich.
Ich rannte die Anhöhe hinab bis zum Rand der auslaufenden Wellen und drückte mich mit aller Kraft aus dem feuchten Sand ab, um das Boot mit einem großen Satz über die Wellen hinweg doch zu erreichen. Ich erwischte das Heck mit einer Hand, schlug gegen die Außenseite und hing noch mit den Beinen im Wasser, während das Boot Fahrt aufnahm. Niemand streckte mir die Hand entgegen, als ich mich leise fluchend über die Seitenwand zog.
»Gar nicht schlecht, Fable.« Koy griff nach der Pinne, den Blick auf den Horizont gerichtet, und steuerte auf das südliche Riff zu. »Wusste nicht, dass du auch mitkommen wolltest.«
Ich band mir das Haar zu einem Knoten oben auf dem Kopf zusammen und starrte Koy wütend an. Es war bereits das dritte Mal diese Woche, dass er versucht hatte, mich an Land zurückzulassen, wenn er die Schürfer zum Tauchen hinausbrachte. Wäre Speck nicht ständig betrunken, hätte ich lieber ihn dafür bezahlt, mich zum Riff zu fahren. Aber ich brauchte ein zuverlässiges Transportmittel.
Das Segeltuch über mir knallte, als der Wind hineinblies und dem Boot einen kräftigen Schub versetzte. Ich suchte mir einen Sitzplatz zwischen zwei lederhäutigen Schürfern.
Koy streckte die Hand aus. »Kupfer.«
Ich warf einen Blick über seinen Kopf hinweg zu den vorgelagerten Inseln, wo die Masten der Handelsschiffe in der steifen Brise schwankten. Bisher war die Marigold noch nicht unter ihnen, doch bis zum Sonnenaufgang dürfte sie da sein. Ich fischte eine Münze aus dem Beutel an meinem Gürtel und ließ sie zähneknirschend in Koys Hand fallen. Mittlerweile hatte er so viel Geld von mir bekommen, dass ich praktisch das halbe Boot bezahlt hatte.
Wir glitten jetzt immer schneller durch das Wasser, dessen Farbe vom blassen Türkis des Küstenbereichs in das dunkle Blau des offenen Meeres überging. Das Boot neigte sich im Wind, und ich lehnte mich zurück, um eine Hand in die Wellen zu halten. Die Sonne stand hoch am Himmel, uns blieben mehrere Stunden Zeit bis zum Gezeitenwechsel. Das sollte locker ausreichen, um meine Tasche mit Pyrum zu füllen, das ich dann verkaufen konnte.
Ich zog meinen Gürtel fest und überprüfte jedes einzelne daran befestigte Werkzeug.
Hammer, Meißel, Pickhacken, Kelle, Schürferlupe.
Die meisten Schürfer hatten sich schon vor Monaten vom östlichen Riff abgewandt, aber mein Bauchgefühl hatte mir damals gesagt, dass sich dort in der Tiefe noch weiteres Pyrum verbarg. Und ich hatte recht. Nach wochenlanger Suche war ich unterhalb eines abgegrasten Felssimses auf ein unentdecktes Vorkommen gestoßen, das mir seitdem eine Menge Kupfer eingebracht hatte.
Der Wind pfiff mir um die Ohren, als ich mich hinstellte, und wehte mir Strähnen meines dunkelroten Haares ins Gesicht. Mit einer Hand am Mast beugte ich mich über die Seitenwand des Bootes und warf einen prüfenden Blick in das Wasser unter uns.
Noch nicht.
»Wann erzählst du uns endlich, was du dort unten gefunden hast, Fable?« Koys Hand schloss sich fester um die Pinne, als er mich lauernd ansah. Seine Augen waren so dunkel wie die schwärzesten Nächte auf der Insel, wenn Sturmwolken den Mond und die Sterne verdeckten.
Die anderen schauten schweigend zu mir herüber und warteten auf meine Antwort. Ich hatte bemerkt, wie sie mich neuerdings beobachteten, wenn ich im Hafen war, und ihr Flüstern am Strand gehört. Da ihre Ausbeute in den letzten Wochen ziemlich kläglich ausgefallen war, wurden sie langsam unruhig, und das verhieß nichts Gutes. Ich hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet Koy mich direkt fragen würde.
Ich zuckte mit den Schultern. »Irismuscheln.«
Er lachte und schüttelte den Kopf. »Irismuscheln«, wiederholte er. Koy war jünger als die meisten Schürfer von Jeval, seine gebräunte Haut war noch nicht runzlig und fleckig durch die langen Tage in der Sonne. Aber er hatte sich seinen Platz unter ihnen zehnfach verdient, indem er genug Münzen ergaunert hatte, um ein Boot zu kaufen und die Schürfer damit zu den Riffen zu fahren.
»Ja, genau«, sagte ich.
Als er mich erneut ansah, war die Belustigung aus seinem Blick verschwunden, und ich biss die Zähne zusammen, um das Zucken meines Kiefermuskels zu verbergen. Es war jetzt vier Jahre her, dass ich auf dem sengend heißen Strand ausgesetzt worden war. Vier Jahre, in denen ich auf mich allein gestellt gewesen war. Ich hatte ausgehungert Schiffsrümpfe freigekratzt, um im Gegenzug ein bisschen halb verrotteten Fisch zu erhalten, und vielfach Prügel bezogen, wenn ich mal wieder an einer Stelle getaucht war, die ein anderer Schürfer für sich beanspruchte. Doch obwohl ich auf Jeval schon viel Gewalt erlebt hatte, war es mir bisher gelungen, Koy nicht zu reizen. Wer ihn gegen sich aufbrachte, lebte gefährlich.
Ich ging zum Heck des Bootes und verzog meine Lippen dabei zu einem ähnlich höhnischen Lächeln wie er zuvor am Strand. Er war ein Bastard – aber ich stand ihm in nichts nach. Und mir meine Angst anmerken zu lassen, machte es nur schlimmer. Ich musste es irgendwie schaffen, am Leben zu bleiben, und ich würde mir lieber eine Hand abhacken, als die Chance zu verspielen, von Jeval zu entkommen. Gerade jetzt, wo ich so nah dran war.
Ich löste meine Hand vom Mast und ließ mich ins Wasser fallen. Das Boot fuhr davon, als ich in einem Meer von Bläschen in die Tiefe sank. Auf dem Weg zurück zur Oberfläche strampelte ich mit den Beinen, um mich aufzuwärmen. Der Rand des östlichen Riffs lag in der Strömung, die auf dieser Seite der Insel für kälteres Wasser sorgte. Auch deshalb hatte ich vermutet, dass es hier unten mehr Pyrum geben musste als das, was bisher geschürft worden war.
Koys Boot entfernte sich rasch, sein geblähtes Segel ragte vor dem wolkenlosen Himmel auf. Als es hinter den vorgelagerten Inseln verschwunden war, drehte ich mich um und schwamm zurück Richtung Ufer. Dabei hielt ich das Gesicht unter Wasser, um das Riff unter mir absuchen zu können. Die Rosa-, Orange- und Grüntöne der Korallen fingen das Sonnenlicht ein, wie die Seekarten, die oft ausgerollt auf dem Schreibtisch meines Vaters gelegen hatten. Ich hielt Ausschau nach dem gelben Seefächer, der an einer Stelle eingerissen war und mir als Markierung diente.
Dort angekommen, hob ich den Kopf und atmete tief ein, während ich noch einmal den Sitz meines Gürtels überprüfte. Als die Luft meinen Brustkorb füllte, ließ ich sie langsam wieder entweichen, wie meine Mutter es mir beigebracht hatte. Meine Lungenflügel dehnten sich aus und zogen sich zusammen, bis ich den vertrauten Druck zwischen den Rippen verspürte. Nun beschleunigte ich den Rhythmus und atmete stoßweise ein und aus, um schließlich tief Luft zu holen und unterzutauchen.
In meinen Ohren knackte es, als ich mit den Armen voran auf die leuchtenden Farben am Grund zuschwamm. Der zunehmende Wasserdruck fühlte sich an wie eine Umarmung, und ich ließ mich immer tiefer sinken, ohne dem lockenden Ruf der Oberfläche Beachtung zu schenken. Auf dem Weg hinab kam mir ein Schwarm rot gestreifter Doktorfische entgegen und hüllte mich ein. Das unendliche Blau erstreckte sich in alle Richtungen. Schließlich berührten meine Füße eine Fläche mit grünen Korallen, die sich wie krumme Finger emporreckten. Ich hielt mich an dem Felsvorsprung darüber fest und arbeitete mich vor, bis ich die Bruchkante erreicht hatte.
Entdeckt hatte ich das Pyrum, als ich das Riff nach Krabben abgesucht hatte, mit denen ich den alten Mann im Hafen für die Reparatur meiner Schürferlupe bezahlen wollte. In der stillen Umgebung hatte ich das leise Summen des Edelsteins sofort in den Knochen gespürt und drei Tage lang gesucht, bis ich schließlich durch Zufall fündig wurde. Ich hatte mich von einem Felsvorsprung abgestoßen, um an die Oberfläche zurückzukehren, doch dabei war ein Stück Stein abgebrochen und hatte den Blick auf eine gezackte Basaltschicht mit den typischen, mir mehr als vertrauten weißen Einsprengseln freigelegt. Das konnte nur eines bedeuten: Pyrum.
Dieses Vorkommen hatte mir in den letzten drei Monaten mehr Kupferstücke von den Händlern auf der Marigold eingebracht als in den zwei Jahren zuvor. Noch ein paar Wochen, und ich würde nie wieder zu den Riffen hinabtauchen müssen.
Ich platzierte meine Füße so auf dem Felsen, dass ich stabil stand, und presste die Hand gegen das gewölbte Gestein. Der Edelstein vibrierte unter meinen Fingerspitzen, das Gefühl glich dem Nachhall, wenn Metall auf Metall schlägt. Auch das hatte mich meine Mutter gelehrt – die Steine zu hören. Tief im Rumpf der Lark hatte sie mir ein Edelmineral nach dem anderen in die Hand gegeben und mir flüsternd ihre Sprache beigebracht, während die Besatzung in ihren Hängematten schlief.
Hörst du das? Fühlst du das?
Ich zog das Werkzeug aus meinem Gürtel und setzte den Meißel in die tiefste Kerbe, bevor ich mit dem Hammer draufschlug und die oberste Steinschicht Stück für Stück entfernte. Die Form der Auswölbung verhieß einen großen Brocken Pyrum, der mir vier Kupfermünzen einbringen könnte.
Über mir glitzerten silberne Schuppen im Sonnenlicht, als immer mehr Fische zum Fressen in die Tiefe herabkamen, und ich musste beim Blick hinauf geblendet die Augen zusammenkneifen. Ein gutes Stück entfernt trieb ein Körper im trüben Wasser – die Überreste eines Schürfers, der sich mit jemandem angelegt oder seine Schulden nicht beglichen hatte. Man hatte ihn mit den Füßen an einen riesigen, von Seepocken bedeckten Felsen gekettet und ihn den Meereslebewesen überlassen. Es war nicht das erste Mal, dass ich diese Form der Bestrafung sah, und wenn ich nicht vorsichtig war, würde ich genauso enden.
Der letzte Rest Luft brannte in meiner Lunge und meine Gliedmaßen wurden langsam kalt. Ich schlug ein letztes Mal auf den Meißel. Die harte, weiße Kruste sprang auf und gab ein scharfkantiges Stück Gestein frei. Aus meinem Mund entwichen ein paar Luftbläschen, als ich die Lippen zu einem Lächeln verzog und die Hand nach dem glasartigen, roten Pyrum ausstreckte, das mir jetzt wie ein blutunterlaufenes Auge entgegenschaute.
Da sich mein Sichtfeld langsam verengte, stieß ich mich vom Fels ab und schwamm nach oben. Meine Lunge schrie nach Sauerstoff. Die Fische schossen davon wie ein zerspringender Regenbogen, und im nächsten Augenblick brach ich keuchend durch die Wasseroberfläche. Über meinem Kopf hatten sich dünne Wolkenstreifen gebildet, doch mein Blick fiel auf das dunklere Band am Horizont. Mir war schon am Morgen aufgefallen, dass der Wind nach Sturm roch. Wenn das Unwetter die Marigold davon abhielt, bis Sonnenaufgang die vorgelagerten Inseln zu erreichen, würde ich das Pyrum gefährlich lange bei mir behalten müssen. Die Anzahl meiner Verstecke war begrenzt, und die Blicke, die mir gierig folgten, wurden jeden Tag zahlreicher.
Ich ließ mich auf dem Rücken treiben, damit meine Haut möglichst viel wärmende Sonne abbekam. Sie bewegte sich bereits auf den lang gezogenen Bergkamm zu, der quer über Jeval verlief, doch ich würde noch mindestens sechs oder sieben Tauchgänge benötigen, um das Pyrum freizubekommen. Außerdem musste ich wieder am anderen Ende des Riffs sein, wenn Koy kam, um mich abzuholen.
Falls er kam.
Noch drei oder vier Wochen, dann hätte ich genug Kupfer zusammen, um für die Überfahrt über das Enge Meer zu bezahlen und Saint aufzuspüren, damit er sein Versprechen einlöste. Ich war erst vierzehn Jahre alt gewesen, als er mich auf der berüchtigten Diebesinsel aussetzte, und hatte seitdem jeden Tag damit verbracht, das nötige Geld zusammenzukratzen, um ihm hinterherfahren zu können. Manchmal fragte ich mich, ob er mich jetzt, nach vier Jahren, überhaupt noch erkennen würde, wenn ich endlich an seine Tür klopfte. Ob er sich wohl daran erinnern würde, was er zu mir gesagt hatte, als er mir mit der Spitze seines Fischbeinmessers den Arm aufritzte.
Aber mein Vater war niemand, der Dinge vergaß.
Und ich auch nicht.
Kapitel 2
Es gab fünf Regeln. Nur fünf.
Mein Vater hatte sie mich immer wieder aufsagen lassen, seit ich groß genug war, um mit meiner Mutter den Mast hochzuklettern. Er saß im schummrigen Kerzenlicht seiner Kajüte auf der Lark und beobachtete mich, in einer Hand eine Schreibfeder, die andere um das grüne Roggenwhiskeyglas gelegt, das auf seinem Schreibtisch stand.
Trag dein Messer so, dass du es jederzeit griffbereit hast.
Stehe niemals in jemandes Schuld.
Nichts ist umsonst.
Halte dich beim Lügen möglichst nah an die Wahrheit.
Lass dir niemals und unter keinen Umständen anmerken, wer oder was dir wichtig ist.
An diese Regeln hatte ich mich gehalten, seit Saint mich an jenem Tag auf Jeval ausgesetzt hatte, und ohne sie hätte ich nicht überlebt. Zumindest das hatte er mir hinterlassen, als er, ohne sich umzuschauen, davongefahren war.
Als wir uns dem Strand näherten, ertönte ein Donnergrollen. Der Himmel hatte sich verdunkelt und in der Luft erwachten die ersten Vorboten des Sturms. Ich studierte den Horizont und die Form der Wellen. Die Marigold war irgendwo dort draußen unterwegs, doch wenn der Sturm zu heftig werden sollte, würde sie es nicht bis zum Morgen zu den vorgelagerten Inseln schaffen. Dann könnte ich mein Pyrum nicht verkaufen.
Koy blickte aus schwarzen Augen auf das Netz voller Irismuscheln auf meinem Schoß. Der Beutel mit dem Pyrum, das ich am Riff abgeschlagen hatte, war in einer der Muscheln versteckt. Ich war längst nicht mehr so dumm wie am Anfang. Wenn ich mir den Beutel an den Gürtel band, wie es die anderen Schürfer taten, scheuten diese nicht davor zurück, ihn einfach abzuschneiden, das hatte ich schnell gelernt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, sie waren mir körperlich überlegen. Deshalb war ich dazu übergegangen, Edelsteine und Münzen in ausgenommenen Fischen und Irismuscheln zu verstecken.
Ich fuhr mit der Fingerspitze über die Narbe, die sich wie eine Baumwurzel von meinem Handgelenk über die Innenseite meines Unterarms bis zum Ellbogen zog. In der ersten Zeit auf der Insel hatte ich mein Überleben nur ihr zu verdanken. Die Jevalis waren ein abergläubisches Volk, und niemand wollte etwas mit dem Mädchen zu tun haben, das ein solches Zeichen auf der Haut trug. Nur wenige Tage, nachdem Saint mich hier zurückgelassen hatte, setzte ein alter Mann namens Fret im Hafen das Gerücht in die Welt, ich sei von Meeresdämonen verflucht.
Als das Boot langsamer wurde, schlang ich mir das Netz über die Schulter und sprang hinaus. Ich spürte Koys Blick in meinem Rücken und hörte das Getuschel, als ich durch das flache Wasser watete. Auf Jeval gab es nur Einzelkämpfer, es sei denn, jemand spann eine Intrige. Und genau darauf war Koy aus – eine Intrige.
Ich lief am Wasser entlang zu den Klippen und behielt dabei die Felswand im Blick, um die Schatten möglicher Verfolger auszumachen. Die Dämmerung färbte das Meer violett, und die Sonne ließ noch ein paar letzte Strahlen über die Wellen tanzen, bevor sie unterging.
Meine schwieligen Finger fanden die vertrauten Ritzen im schwarzen Felsen sofort, und ich begann zu klettern, immer weiter hinauf, bis mir das Salzwasser aus der Bucht auf der anderen Seite ins Gesicht spritzte. Das Seil, das ich oben auf dem Grat festgebunden hatte, hing bis ins Meer hinab.
Ich fischte die aufgeknackte Irismuschel aus dem Netz und schob sie mir unter das Hemd, bevor ich mich aufrichtete und tief Luft holte. Sobald die nächste Welle heranrollte und gegen den Fels brandete, sprang ich vom Kamm aus ins Wasser. Es wurde immer dunkler, aber ich griff nach dem Seil und hangelte mich daran bis in den Tangwald hinab, wo lange, wabernde Bändern vom Meeresgrund emporwuchsen. Von unten betrachtet bildeten sie ein Blätterdach, das das Wasser darunter grün färbte.
Auf dem Weg nach unten entdeckte ich immer wieder Fische zwischen den Algen, die von Riffhaien auf der Suche nach einer Mahlzeit verfolgt wurden. Anfangs war diese kleine Bucht einer der wenigen Orte gewesen, an denen ich Fische fangen durfte, weil die hohen Wellen die Fallen aus Schilf, die die anderen Schürfer verwendeten, schnell beschädigten. Meine geflochtene Korbfalle, die ich so gebaut hatte, wie ich es vom Steuermann meines Vaters gelernt hatte, hielt den Wogen jedoch stand. Ich schlang mir das Seil um die Faust und zog, doch die Falle hing fest. Die Strömung musste sie zwischen zwei Felsen getrieben haben.
Ich tauchte ab, bis ich mit den Füßen auf dem Korb stand, und stützte mich mit den Händen am Fels ab. Dann versuchte ich, den halb im Schlick versunkenen Korb durch Tritte zu befreien. Als das nicht half, beugte ich mich nach unten, schob die Finger durch den geflochtenen Deckel und zerrte daran, bis er sich abrupt löste und ich mit dem Rücken gegen den rauen Stein prallte.
Ein Barsch glitt aus der Öffnung, bevor ich die Falle wieder schließen konnte, und ich fluchte, als ich ihn davonschwimmen sah, auch wenn meine Stimme unter Wasser nicht zu hören war. Bevor auch der zweite entkommen konnte, drückte ich den kaputten Deckel an die Brust und hielt die Falle mit einem Arm fest zu.
Das Seil leitete mich zurück nach oben, und ich schwamm bis zu einem zerklüfteten Vorsprung, der im Schatten lag. Mithilfe des Meißels löste ich den Stein, den ich mit Tang fest versiegelt hatte, und legte ein Loch frei, das ich selbst gegraben hatte. Darin funkelte – wie ein Häufchen Glasscherben – das Pyrum, das ich in den vergangenen zwei Wochen zusammengetragen hatte. Dieses Versteck zählte zu den wenigen auf der Insel, die noch nicht entdeckt worden waren. Ich legte meine Fallen schon seit Jahren in der kleinen Bucht aus, und alle, die mich hier tauchen sahen, konnten beobachten, wie ich mit meinem Fang aus dem Wasser kam. Falls bisher irgendjemand auf die Idee gekommen war, dass ich hier auch Edelsteine bunkerte, hatte er sie noch nicht aufgespürt.
Sobald ich das Pyrum in dem Beutel an meinem Gürtel verstaut hatte, verschloss ich das Loch wieder mit dem Stein. Die Muskeln in meinen Beinen schmerzten, erschöpft vom stundenlangen Tauchen, und ich musste meine ganze verbliebene Kraft aufwenden, um zur Oberfläche zurückzukehren. Gierig sog ich die Nachtluft ein, doch als eine große Welle angerollt kam, schwamm ich schnell zur Felszunge, bevor das zurückströmende Wasser mich mit sich reißen konnte.
Ich zog mich mit einem Arm hinauf und ließ mich keuchend auf den Sand fallen. Über mir funkelten die Sterne, aber der Sturm kam schnell näher, und der Geruch des Windes verriet, dass mir eine lange Nacht bevorstand. Die Böen könnten meiner kleinen Hütte auf den Klippen gefährlich werden, doch ich blieb ohnehin wach, wenn ich Pyrum oder Münzen bei mir trug. Es war schon vorgekommen, dass mein Lager geplündert wurde, während ich schlief, und das Risiko konnte ich nicht eingehen.
Ich schob mir den Fisch unter das Hemd und schlang die kaputte Falle über die Schulter. Unter den Bäumen war es bereits dunkel, doch das Mondlicht wies mir den Weg. Der Pfad führte die Klippe hinauf und wurde am Ende so steil, dass ich mich beim Gehen nach vorn lehnen musste. Als er abrupt vor einer glatten Felswand endete, setzte ich die Hände und Füße in die Vertiefungen, die ich geschlagen hatte, und zog mich hinauf. Oben angekommen, richtete ich mich auf und warf einen Blick zurück auf den Pfad.
Er war leer. Die Bäume schwankten leicht in der Brise und der Sand schimmerte im letzten Licht der Dämmerung. Ich legte den Rest des Weges im Laufschritt zurück, bis zu der Stelle, wo der Fels plötzlich steil zum Strand abfiel. Tagsüber konnte man von hier oben die vorgelagerten Inseln sehen, doch im Dunkeln war nur das Leuchten einiger Laternen an den Masten der Schiffe auszumachen, die dort für die Nacht vor Anker lagen. Hier hatte ich jeden Morgen gesessen und auf das Schiff meines Vaters gewartet, obwohl er mir gesagt hatte, dass er nicht zurückkommen würde.
Es dauerte zwei Jahre, bis ich ihm das glaubte.
Ich stellte die Falle neben der Feuerstelle ab und löste meinen schweren Gürtel. Der Wind frischte auf, als ich die Arme um den dicken Stamm des Baumes schlang, der schräg über die Klippe hinauswuchs, und mich so weit hinaufzog, dass ich über dem Abgrund schwebte und auf den dreißig Meter unter mir liegenden Strand hinabschauen konnte. Die Abendwellen rollten weiß schäumend auf den Sand. Die meisten Schürfer waren zu schwer, um bis in die dürre Baumkrone zu klettern, ohne dass die Äste brachen und sie in den sicheren Tod stürzen ließen. Selbst bei mir war es ein- oder zweimal fast schiefgegangen.
Oben angekommen, griff ich in den Hohlraum zwischen zwei Astansätzen. Ich zog den Beutel hervor, der dort lag, und schleuderte ihn auf den festen Boden hinter mir, bevor ich wieder hinabkletterte.
Dann machte ich Feuer, hängte den aufgespießten Fisch darüber und ließ mich in eine bequeme Vertiefung im Felsen sinken, von der aus ich den Pfad im Auge behalten konnte. Falls sich dort jemand näherte, würde ich es bemerken, bevor die Person mich sah. Ich musste nur bis zum Morgen durchhalten.
Die Münzen klimperten, als ich den Inhalt des Beutels auf den weichen Sand kippte. Sie schimmerten im Mondlicht, während ich sie zählte und zu Türmchen aufstapelte.
Zweiundvierzig Kupferstücke. Wenn ich abzog, was mich die Bootsfahrten aufs Meer hinaus kosteten, fehlten mir noch achtzehn, um mit West über eine Überfahrt zu verhandeln. Ich hatte sogar eine kleine Summe beiseitegelegt, um mir auf der Suche nach Saint Essen und eine Unterkunft leisten zu können. Ich ließ mich auf den Rücken sinken und die Beine über der Klippe baumeln, während der Fisch über dem Feuer brutzelte. Über mir stand ein makelloser, strahlend weißer Halbmond am Himmel, und ich sog den Duft nach Salzwasser und Zypressen ein, der so typisch war für Jeval.
In meiner ersten Nacht auf der Insel hatte ich am Strand geschlafen, weil ich mich nicht traute, mich zu den Zelten und den Lagerfeuern unter den Bäumen zu begeben. Ich wachte davon auf, dass ein Mann meine Jacke aufriss, um in meinen Taschen nach Münzen zu suchen. Als er nichts fand, stieß er mich zurück in den kalten Sand und ging weg. Es dauerte mehrere Tage, bis ich einsah, dass mir jeder Fisch, den ich im Flachwasser fing, bei meiner Rückkehr zum Strand direkt wieder abgenommen wurde. Ich ernährte mich fast einen Monat lang von Algen, bis ich sichere Stellen zum Angeln gefunden hatte. Nachdem ich knapp ein Jahr lang den Fang anderer Fischer ausgenommen und Seile aus Palmfasern verkauft hatte, reichte mein angespartes Geld schließlich aus, um Fret, der aufgrund seines Alters nicht mehr tauchen konnte, sein Schürfwerkzeug abzukaufen.
Unter mir donnerten die Wellen, aufgepeitscht von den Sturmböen, immer wütender auf den Strand, und mir kam kurz der Gedanke, ob ich Jeval wohl vermissen würde. Ob vielleicht doch irgendetwas hier zu einem Teil von mir geworden war. Ich setzte mich auf und ließ den Blick über die in Dunkelheit gehüllte Insel wandern. Die Baumwipfel wogten im Wind und sahen aus wie aufgewühltes Wasser. Wäre Jeval nicht mein Gefängnis gewesen, wäre mir die Insel womöglich sogar schön erschienen. Aber ich gehörte einfach nicht hierher.
Dabei hätte ich das ändern können. Ich hätte hier heimisch werden und mir auf einer der vorgelagerten Inseln einen eigenen kleinen Edelsteinhandel aufbauen können, wie so viele hier. Doch als Schürferin von Jeval wäre ich nicht länger Saints Tochter gewesen. Aber war ich das überhaupt noch?
Ich erinnerte mich bis heute an das Stimmengewirr unter Deck und das Quietschen der Hängematten. An den Geruch der Pfeife meines Vaters und die schweren Tritte seiner Stiefel auf den Planken. Ich gehörte nicht an Land oder in den Hafen oder in die Städte rund um das Enge Meer. Mein Zuhause gab es nicht mehr.
Viele Kilometer entfernt, wo das Mondlicht auf den schwarzen Saum des Horizonts stieß, bargen die Tiefen der Sturmfalle die Lark. Und egal, wohin ich ging – ich würde keine Heimat finden. Denn meine Heimat war ein Schiff, das auf dem Meeresgrund lag, gemeinsam mit den Knochen meiner Mutter.
Kapitel 3
Als die Sonne aufging, stand ich auf der Klippe und beobachtete die Marigold unten auf dem Wasser. Sie war in der Nacht eingetroffen, trotz des tosenden Sturms, der von der Namenlosen See aus über uns hinweggezogen war. Ich war die ganze Zeit über wach geblieben und hatte ins Feuer gestarrt, bis der Regen die Flammen gelöscht hatte, und nach drei Tauchtagen schrie mein gesamter Körper nach Schlaf.
Aber West mochte es nicht, wenn man ihn warten ließ.
Am Strand tummelten sich bereits die Schürfer, als ich dort ankam. Ich war klug genug gewesen, Speck schon einen Monat im Voraus für einen Platz in seinem Boot zu bezahlen. Jetzt lag er mit hinter dem Kopf verschränkten Armen im Sand und hatte sich den Hut über das Gesicht gezogen. Wer auf Jeval ein Boot besaß, hatte es nicht nötig, zu tauchen oder Handel zu treiben, weil die Schürfer darauf angewiesen waren, dass sie jemand zu den Riffen hinausfuhr. Ein Boot war wie ein Topf voller Kupferstücke, der nie leer war, und keiner hatte dieses Glück weniger verdient als Speck.
Als er mich kommen sah, sprang er auf und verzog den Mund zu einem breiten Grinsen, das seine halb verfaulten Zähne entblößte. »Morgen, Fay!«
Ich nickte ihm zu, warf meinen Schultersack ins Boot und kletterte hinterher. Niemand rutschte auf, um Platz für mich zu machen, also stellte ich mich in den Bug, einen Arm um den Mast geschlungen, die andere Hand auf dem Beutel mit Pyrum, den ich unter meinem Hemd trug. Koys Boot war bereits auf dem Weg um die vorgelagerten Inseln herum, mit so vielen Menschen an Bord, dass auf beiden Seiten Beine und Füße ins Wasser hingen.
»Fable.« Speck lächelte mich auffordernd an, und ich warf ihm einen bösen Blick zu, als mir klar wurde, was er wollte.
Dann löste ich das Segel, sodass es frei im Wind hing, während Speck uns vom Ufer abstieß. Die Schürfer erwarteten Dinge von mir, die sie einander niemals abverlangt hätten. Ihrer Ansicht nach musste ich wohl dankbar sein, dass sie mich nicht einfach als dürres Kind im Flachwasser ertränkt hatten, aber in Wahrheit hatten sie mir nie auch nur den geringsten Gefallen getan. Sie hatten mir nichts gegeben, als ich sie hungrig um Essensreste anflehte, und mir nie während eines Sturms Unterschlupf gewährt. Ich hatte hart für jedes bisschen Nahrung und jedes Stück Pyrum gearbeitet, auch wenn es mich manchmal fast das Leben gekostet hatte. Trotzdem glaubten sie, dass ich in ihrer Schuld stand, nur weil ich noch atmete.
Der Wind frischte auf und wir glitten durch das reglose Meer wie ein heißes Messer durch Talg. Mir kam die Ruhe irgendwie trügerisch vor. Es war irritierend, das Meer im Tiefschlaf zu sehen, wie frisch geblasenes Glas, obwohl ich wusste, wie blutrünstig es sein konnte.
»Hab gehört, dass du ein neues Pyrum-Vorkommen aufgetan hast, Fay«, krächzte Speck, übergab die Ruderpinne an einen der anderen und kam zu mir an den Mast.
Sein Atem stank nach selbst gebranntem Roggenwhiskey. Ich drehte das Gesicht in Richtung Wind und ignorierte ihn. Da ich die Blicke der anderen spürte, schloss ich die Faust noch fester um den Beutel mit den Steinen.
Speck hob abwehrend die Hand. »Ich will dir nix Böses.«
»Na klar«, murmelte ich.
Er beugte sich zu mir vor und sagte mit gesenkter Stimme: »Aber es gibt Gerede, weißt du?«
Ich sah auf und suchte seinen Blick, um abzuwägen, was er mir damit sagen wollte. »Was für Gerede?«
Er schaute sich kurz um. Dabei rutschte ihm der graue Zopf aus dem Hemdkragen, unter den er ihn gesteckt hatte. »Die Leute fragen sich, wo du wohl das viele Kupfer herhast.«
Der Schürfer rechts von mir drehte sich zur Seite, um unser Gespräch besser mithören zu können.
»Wenn ich du wäre, würde ich mich aus dem Gerede raushalten, Speck.« Ich straffte die Schultern und lehnte mich an den Mast. Man durfte den Schürfern gegenüber niemals Schwäche zeigen, selbst wenn man sich vor lauter Angst fast übergeben musste. Speck war harmlos, aber damit war er einer von wenigen auf der Insel.
Er nickte rasch. »Klar halt ich mich da raus. Dachte nur, es könnte dich interessieren.«
»Du dachtest wohl, du könntest mir noch ein Kupferstück aus den Rippen leiern«, gab ich scharf zurück.
Mit einem schiefen Grinsen zog er den Kopf ein und zuckte mit den Schultern.
»Du kassierst ohnehin schon zu viel. Ich zahle nicht auch noch für Klatsch und Tratsch.«
Ich drehte ihm den Rücken zu, als Zeichen, dass das Gespräch beendet war. Es würde noch mindestens drei Wochen dauern, bis ich genug Geld für die Überfahrt zusammen hätte, doch wenn mich die Schürfer wirklich schon ins Visier genommen hatten, könnte die Zeit knapp werden.
Speck schwieg, sodass nur noch das Geräusch des Bootsrumpfes im Wasser und das Pfeifen des Windes zu hören waren. Als wir um die vorgelagerten Inseln herumfuhren, kamen die durchgelatteten weißen Segel der Marigold in Sicht. Das Schiff lag hinter dem letzten Felsausläufer, und Speck nahm behutsam das Tempo raus. Ich sah die breiten Schultern von West, der am anderen Ende des Hafens über das Meer schaute, eine schwarze Silhouette vor der aufgehenden Sonne.
Ich hob meine Hand und spreizte die Finger im Wind, und sobald West das sah, verschwand er in der Menge.
Als wir den Hafen erreicht hatten, holte Speck das Segel ein, und bevor er mich darum bitten konnte, schnappte ich mir die aufgerollte Leine und warf sie an Land. Die Schlaufe legte sich um den Poller an der Ecke des Kais, und ich stemmte die Fersen in den Boden und zog uns näher heran, Stück für Stück. Das nasse Tau knarzte, als es in die Länge gezogen wurde, und der dumpfe Laut, mit dem das Boot gegen den Kai stieß, ließ Fret aufschauen, der wie immer auf seinem Hocker saß.
Zwischen seinen Füßen stand eine Schilfkiste mit seltenen Muscheln, die er im Flachwasser gesammelt hatte. Schürfen konnte er schon lange nicht mehr, aber er kam trotzdem jede Woche auf die vorgelagerten Inseln, um Waren zu verkaufen, die außer ihm niemand aufzuspüren vermochte. Er hatte damals das Gerücht in die Welt gesetzt, dass ich das Zeichen der Meeresdämonen auf dem Arm trüge, und mir seinen Schürfergürtel verkauft, wodurch ich unfreiwillig eine der Regeln meines Vaters gebrochen hatte. Denn für beides würde ich ein Leben lang in Frets Schuld stehen.
»Fable.« Er lächelte mir schief zu, als ich auf den Kai kletterte.
»Hey, Fret.« Ich klopfte ihm im Vorbeigehen auf die knochige Schulter, den Blick auf die ein Stück weit entfernt liegende Marigold gerichtet, vor der West stand und wartete.
Auf dem schmalen Holzsteg wimmelte es von Schürfern, die im blassen Morgenlicht mit Händlern feilschten. Jeval war bekannt für das Pyrum in seinen Riffen, das zwar nicht zu den wertvollsten Edelsteinen zählte, aber fast ausschließlich hier vorkam.
Die Händler legten allerdings nicht nur wegen des Pyrums hier an. Jeval war der einzige Hafen zwischen dem Engen Meer und der Namenlosen See, und viele Schiffe nutzten die Gelegenheit, um ihre Vorräte aufzustocken. Die Jevalis schleppten Körbe voller Hühnereier, auf Schnüre aufgezogene Fische und große Ballen Tau in den Hafen und priesen ihre Waren den Besatzungen an, die vom Deck aus auf den Kai schauten.
Auf dem Weg durch eine eng zusammenstehende Gruppe von Männern ertönte vor mir plötzlich lautes Gebrüll, und ich trat rasch einen Schritt zur Seite, um einer verirrten Faust auszuweichen. Durch das Handgemenge wurde ich an den Rand des Kais gedrängt, und als ein offenes Fass Wollkraut ins Wasser rollte, hätte es mich fast mitgerissen. Zwei Männer sprangen hinterher, und ich wartete, bis die Umstehenden die Streithähne getrennt hatten, bevor ich an ihnen vorbeilief.
Als hätte er mein Herannahen gespürt, drehte sich West genau in dem Augenblick um, in dem ich aus der Menge trat. Er hatte sich die sonnengebleichten Locken hinter die Ohren gestrichen und verschränkte die Arme, als er mich aus hellgrünen Augen musterte.
»Du bist spät dran.« Er schaute zu, wie ich den Saum meines Hemdes aus dem Gürtel zog und nach dem Beutel darunter griff. Mein Blick fiel auf den Horizont hinter ihm, wo sich der Rand der Sonne gerade über die Wasserlinie schob.
»Nur ein paar Minuten«, murmelte ich.
West trat einen Schritt vor, als ich den Beutel ausleerte und sechs knollige, weiß verkrustete Klumpen Pyrum in meine Handfläche fallen ließ.
Er nahm die Schürferlupe aus meinem Gürtel und klemmte sie sich vor das Auge. Dann hielt er die roten Steine nacheinander so hoch, dass das Licht der aufgehenden Sonne durch sie hindurchfiel. Ich hatte sie nicht von den Felsresten befreit, aber es waren gute Stücke. Besser als alles, was die Schürfer hinter mir im Angebot hatten.
»Sieht so aus, als hätte euch der Sturm erwischt.« Ich schaute auf den schmalen Riss, der sich auf der Steuerbordseite über den Rumpf der Marigold zog und mit frischem Teer abgedichtet war.
West antwortete nicht, sondern begutachtete die Edelsteine von allen Seiten.
Der Rumpf war aber nicht der einzige Teil des Schiffes, der gelitten hatte. Hoch oben am Großmast hing eine junge Frau in einem Bootsmannsstuhl und flickte die Lederriemen, mit denen die Segel gerefft wurden.
Als Kind hatte ich oft rücklings auf dem Hauptdeck gelegen und zugesehen, wie meine Mutter oben in der Takelage der Lark herumkletterte. Ihr dunkelroter Zopf hatte wie eine Schlange über ihrem Rücken gehangen, und ihre sonnengebräunte Haut hatte einen starken Kontrast zum strahlenden Weiß der Segel gebildet. Ich blinzelte, um die Erinnerung zu vertreiben, bevor sie zu schmerzhaft wurde.
»Du hast in letzter Zeit ziemlich viel zu verkaufen.« West ließ die Schürferlupe in seine Hand fallen.
»Glückssträhne.« Ich hakte die Daumen in den Gürtel und wartete ab.
Er kratzte sich die blonden Stoppeln am Kinn, wie immer, wenn er nachdachte. »Glück zieht meistens Ärger nach sich.« Als er den Blick hob, hatte er die Augen zu Schlitzen verengt. »Sechs Kupferstücke.« Er griff nach dem Geldbeutel an seiner Hüfte.
»Sechs?« Ich zog die Augenbrauen hoch und zeigte auf den größten Klumpen Pyrum in seiner Hand. »Allein der da ist schon mindestens drei wert.«
Sein Blick wanderte zu den Schürfern und Händlern auf dem Kai hinter mir. »Ich an deiner Stelle würde nicht mehr als sechs Kupferstücke mit zur Insel zurücknehmen.« Er fischte die Münzen aus dem Beutel. »Den Rest kriegst du beim nächsten Mal.«
Ich presste die Lippen zusammen und ballte die Fäuste. Dass er vorgab, mir einen Gefallen zu tun, indem er mir nur einen Teil dessen gab, was mir zustand, brachte mein Blut zum Kochen. So liefen die Dinge in dieser Welt nicht.
»Ich kann allein auf mich aufpassen. Zehn Kupferstücke – oder du musst dir eine neue Quelle suchen.« Ich entriss ihm die Schürferlupe und streckte ihm die flache Hand entgegen. Es war klar, dass ich die Münzen bekommen würde, denn West kaufte sein Pyrum immer nur von mir. In den vergangenen zwei Jahren hatte er kein einziges Geschäft mit einem der anderen Schürfer gemacht.
Seine Kiefer mahlten, als er die Hand so fest um die Steine schloss, dass sich seine Knöchel weiß verfärbten. Er murmelte etwas, das ich nicht verstand, und griff in die Tasche seiner Weste. »Du solltest lieber nicht so viel auf einmal verkaufen«, sagte er mit gedämpfter Stimme, während er die Münzen abzählte.
Er hatte recht. Das wusste ich. Aber noch gefährlicher war es, Pyrum und Kupfer auf der Insel zu horten. Die Münzen waren kleiner, ließen sich leichter verstecken, und mir war es lieber, wenn ich nur eine Sache hatte, nach der die anderen gierten. »Ich weiß, was ich tue«, sagte ich und versuchte so zu klingen, als würde ich meinen eigenen Worten glauben.
»Wenn du beim nächsten Mal nicht auftauchst, weiß ich, warum.« West wartete, bis ich zu ihm aufschaute. Durch die langen Tage an Deck des Schiffes hatte seine Haut einen tiefen Olivton angenommen, was seine Augen so grün leuchten ließ wie das Jadeit, das meine Mutter mich nach ihren Tauchgängen hatte polieren lassen.
Er ließ die Münzen in meine Hand fallen und ich lief los. Unterwegs steckte ich das Geld in meinen Beutel und schob ihn zurück unter mein Hemd. Kurz darauf hatte ich den Pulk am Kai erreicht und drängte mich zwischen den stinkenden Körpern hindurch. In meiner Kehle hatte sich ein Kloß gebildet. Das Gewicht der Kupfermünzen machte mich unruhig und Wests Worte hallten noch nach. Vielleicht hatte er recht. Vielleicht …
Ich drehte mich noch einmal um und stellte mich auf die Zehenspitzen, um über die Schultern der Schürfer hinweg einen Blick auf die Marigold zu werfen. Von West war nichts mehr zu sehen.
Kapitel 4
Koy wartete in seinem Boot, als ich zum Strand kam.
Der Wind blies ihm das dunkle Haar aus dem Gesicht, während er über die Wogen schaute. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, war er mir von der Küste aus hinterhergeschwommen, um mich von der Sandbank zu vertreiben, auf der ich gerade fischte. Seitdem hatte er mich nicht mehr aus den Augen gelassen.
»Wo sind die anderen?«, fragte ich, schnipste ihm ein Kupferstück zu und warf meinen Gürtel ins Boot.
Er fing die Münze auf und steckte sie in den Beutel, der am Mast hing. »Noch mit den Händlern beschäftigt.«
Wir kletterten an Bord. Koy löste die Leinen und wir trieben hinaus.
Kaum war das Segel gesetzt, griff der Wind hinein, sodass das Boot sich erst stark zur Seite legte und sich dann rasch vom Ufer entfernte. Ich schnallte mir gerade den Gürtel um, als ich bemerkte, wie Koy über die Schulter hinweg auf meine Werkzeuge schaute. Er hatte mich schon früher bestohlen, auch wenn ich ihn nie auf frischer Tat ertappt hatte. Ich hatte meine Verstecke mehrmals gewechselt, doch irgendjemand spürte sie immer auf. Die Schürfer waren raue, abgebrühte Kerle, aber sie waren nicht dumm, am allerwenigsten Koy. Und er hatte mehr hungrige Mäuler zu stopfen als alle anderen.
Er musste seine Großmutter und seine beiden Geschwister ernähren, was ihn zu einem der gefährlichsten Bewohner der Insel machte. Für andere verantwortlich zu sein war der schlimmste Fluch überhaupt – hier auf Jeval, draußen auf dem Wasser und selbst in den Städten am Engen Meer. Halbwegs ruhig schlafen konnten nur Einzelgänger. Das zählte zu den ersten Dingen, die Saint mir eingebläut hatte.
Im Hafen der vorgelagerten Inseln lag immer noch die Marigold, und hinter ihr zog dunkel ein weiterer Sturm auf. Er drohte noch schlimmer zu werden als der erste, doch wenn ich den Wind und die Wolken richtig deutete, würde er sich weitgehend ausgetobt haben, bevor er uns erreichte. Dennoch würden die Marigold und die anderen Schiffe vermutlich erst am Morgen auslaufen.
»Was hast du eigentlich vor mit dem vielen Kupfer, Fable?«, fragte Koy, während er die Leine aufschoss.
Ich hielt den Blick fest auf das Tau in seiner schwieligen Hand gerichtet. »Welches Kupfer?«
Er lächelte amüsiert und zwischen den Lippen blitzten seine Zähne auf. »Ich weiß, dass du so viel Pyrum verkaufst, wie du finden kannst. Aber ich verstehe nicht, was du mit dem Geld vorhast. Planst du, ein Boot zu kaufen? Oder ins Geschäft mit den Händlern einzusteigen?«
»So viel Pyrum finde ich gar nicht.« Ich zuckte mit den Schultern und wickelte mir eine Haarsträhne um den Finger. Im Sonnenlicht glich deren Farbe Kupfer. »Nicht mehr als sonst.«
Koy grinste und lehnte sich im Bug zurück. Seine Ellbogen ragten über den Bootsrand hinaus. »Weißt du, warum ich dich nie gemocht habe?«
Ich lächelte zurück. »Warum?«
»Es hat nichts damit zu tun, dass du eine Lügnerin bist. Alle auf der Insel lügen. Das Problem ist, Fable, dass du eine gute Lügnerin bist.«
»Ah. Ich habe dich auf jeden Fall von Anfang an gemocht, Koy.«
Er lachte, während er das Segel reffte und das Boot an Fahrt verlor. »Siehst du? Ich hätte dir fast geglaubt.«
Ich stand auf und sprang ins kalte Wasser. Als ich wieder durch die Oberfläche brach, war Koy bereits davongefahren, auf dem Weg zum südlichen Riff. Da er sich nicht umschaute, wartete ich nicht, sondern schwamm direkt in die entgegengesetzte Richtung, mit bedächtigen Zügen, um Kraft zu sparen. Meine Muskeln und Knochen waren steif und müde, aber es würde noch dauern, bis ich mich erholen konnte. Jetzt, wo die Schürfer misstrauisch geworden waren, musste ich wachsam bleiben. Mir blieb nur eine Wahl: möglichst schnell genügend Kupfer aufzubringen, um die Insel zu verlassen.
Als ich den gelben Seefächer erspähte, zog ich den Gürtel fester und begann, im gewohnten Rhythmus ein- und auszuatmen. Sobald ich den vertrauten Stich zwischen meinen Rippen spürte, tauchte ich ab in Richtung Meeresgrund, durch einen Schwarm Fische hindurch, die wie eine Wolke aus schillernden Schuppen über mir auseinanderstiebten. Ich verschwendete keine Zeit damit, mich bis zur Bruchkante vorzuarbeiten. Das leise Summen des Pyrums tanzte auf meiner Haut, also zog ich das Werkzeug aus dem Gürtel und machte mich an die Arbeit. Mit festen Schlägen trieb ich den Meißel in ein neues Stück Gestein. Es bestand zum Großteil aus Korallen und Basalt, doch nachdem ich mich gut einen halben Meter vorgearbeitet hatte, stieß ich auf die glatte Oberfläche von Pyrum. Es war ein kleines Stück und würde sich daher leicht lösen lassen, aber die Suche nach einem größeren könnte den ganzen Nachmittag in Anspruch nehmen. Also stützte ich mich auf dem Riff ab und hob den Hammer zu einem weiteren Schlag. Ich traf den Meißel genau im richtigen Winkel und konnte selbst unter Wasser hören, wie ein kleines Stück Pyrum abbrach.
Plötzlich rutschte meine Hand ab und schlug gegen eine scharfe Kante. Über mir war ein Schatten aufgetaucht und hüllte mich in Dunkelheit. Ich zuckte zusammen und ließ den Hammer fallen. Mein rasendes Herz ließ die Luft in meiner Lunge knapp werden. Ich drückte mich rückwärts unter den Felsvorsprung, die kalte Hand fest um den Meißel geklammert. Eine Gruppe Walhaie zog über das Riff hinweg und schwamm im Zickzack durch die Sonnenstrahlen, die durch die Meeresoberfläche in die Tiefe drangen. Ich lachte erleichtert auf und stieß dabei einen Schwall Luftblasen aus. Das Engegefühl in meiner Brust ließ nach. Aber ich brauchte Sauerstoff.
Also stieß ich mich vom Fels ab und ließ mich zwischen zweien der Tiere nach oben treiben. Unterwegs strich ich mit der Hand über ihre raue, gefleckte Haut. Sie zuckten mit der Schwanzflosse und ich schwamm lächelnd weiter in Richtung Sonnenlicht.
Doch als ich durch die Oberfläche brach, packte mich etwas am Arm und zog mich wieder hinab, noch bevor ich hatte einatmen können. Ich keuchte unter Wasser auf, sodass auch die letzte Luft aus meiner Lunge entwich, und schlug wild um mich.
Inmitten des Fischschwarms unter mir war Koys Gesicht aufgetaucht und er umklammerte mein Handgelenk. Ich schaffte es, nach ihm zu treten und ihn mit der Ferse an der Schulter zu treffen, sodass er mich losließ. So schnell ich konnte schwamm ich auf das Licht zu, denn ich merkte, wie mir langsam schwarz vor Augen wurde. Als ich endlich oben war, rang ich mit brennender Lungenach Luft. Das Boot schaukelte ganz in der Nähe, hinter ein paar Felsen, sodass ich es von unten nicht hatte sehen können.
Koy war mir gefolgt.
Bei meinem nächsten Atemzug brach er durch die Oberfläche und stürzte sofort wieder auf mich zu. Ich versuchte, außer Reichweite zu gelangen, aber er packte mich am Haar und zerrte mich zurück.
»Wo ist es?«, brüllte er und verstärkte den Griff. »Sag mir, wo es ist!«
Ich wand mich und rammte den Ellbogen nach hinten, mitten in sein Gesicht. Seine Finger lösten sich und ich schwamm hastig zum Boot. Doch Koy folgte mir, und er war schneller als ich. Als ich das Heck erreichte, packte er meinen Fuß. Ich bekam die Kante zu fassen und versuchte, mich trotz seines Griffs an Bord zu ziehen. Koy knurrte auf und zerrte so heftig an meinem Bein, dass ich abrutschte und mit dem Gesicht hart gegen die Außenwand knallte. In meinem Kopf explodierte ein Feuerwerk. Doch meine Finger krallten sich erneut um die Kante, und ich zog mich hoch und tastete hektisch nach dem Ruder. Als ich es gefunden hatte, riss ich den Arm zurück und schlug Koy das flache Ende gegen den Kopf.
Er ließ los und rutschte zurück ins Wasser. Ich hievte mich hustend ins Boot und sah, dass er die Augen verdreht hatte und langsam unterging. Aus seiner Stirn strömte rotes Blut und breitete sich wie eine Tintenwolke im Wasser aus. Ich nestelte mit zitternden Fingern an den Leinen herum, doch als ich das Segel hissen wollte, war ich plötzlich wie blockiert.
Koy war immer noch zu sehen, er trieb direkt unter der Oberfläche.
»Alter Bastard«, stöhnte ich, ließ das Ruder fallen und sprang wieder ins Wasser.
Bei ihm angekommen, griff ich unter seinen Armen hindurch und zog ihn zum Boot. Er war so schwer, dass wir fast gekentert wären, als ich seinen schlaffen Körper über die Bordwand zerrte. Sobald der Oberkörper drinnen hing, wuchtete ich die Beine hinterher und er rollte in den Bootsrumpf.
Die Aktion hatte mich den letzten Rest meiner Kräfte gekostet. Meine Muskeln krampften, und ich würgte das Salzwasser aus, das ich verschluckt hatte. Mit zitternden Händen sah ich zu Koy hinüber. Aus seiner Wunde floss weiter Blut, und ich wünschte mir, dass er nicht mehr atmete. Ich wünschte mir, er wäre tot.
Aber so viel Glück hatte ich nie.
Mit einem Wutschrei trat ich ihm in die Seite, bevor ich mich wieder neben ihm auf das Deck fallen ließ und nach Atem rang. Dann spuckte ich das Blut, das sich durch den Kampf in meinem Mund gesammelt hatte, ins Wasser und schaute zur Insel hinüber. Meine Lippe war aufgeplatzt und meine Wange geschwollen, aber ich lebte noch. Das war immerhin etwas.
Ich hätte ihn einfach untergehen lassen sollen. Ihn in der Dunkelheit und Tiefe des Wassers ertrinken lassen. Warum hatte ich das nicht getan?
Du bist nicht für diese Welt gemacht, Fable.
Ich fluchte und kniff die Augen zusammen, als Saints Worte durch meinen schmerzenden Kopf hallten. Das Gleiche hatte er über meine Mutter gesagt.
Ich griff nach dem Ruder, das immer noch im Wasser trieb, und machte mich mit schwachen Armen daran, das Segel dichtzuholen. Die Leine fühlte sich bleischwer an, als ich daran zog, und als der Wind in das aufgespannte Tuch griff, rollte mir eine heiße Träne über die Wange.
Mir blieben keine drei Wochen mehr. Mir blieben nicht einmal mehr drei Tage.
Auf der Rückseite der vorgelagerten Inseln lag immer noch die Marigold, die Segel zum Schutz vor dem aufkommenden Sturm gerefft.
Sollte ich bis zum Sonnenuntergang noch leben, hätte ich genau eine Chance, von Jeval zu entkommen. Und die würde ich nutzen.
Kapitel 5
Wie es das Schicksal wollte, war der Strand so gut wie leer, als ich das Boot an Land zog. Vielleicht hatte Koy die Wahrheit gesagt, als er behauptete, die Schürfer seien noch mit den Händlern beschäftigt. Oder sie bereiteten sich auf den aufziehenden Sturm vor. So oder so bekam kaum jemand meine Rückkehr mit.
Ich deckte Koys reglosen Körper mit einem Knäuel Netze ab, schnappte mir meinen Gürtel und sprang aus dem Boot ins flache Wasser. Sollte mich jemand sehen, würde er als Erstes fragen, was ich allein in Koys Boot zu suchen hatte. Die zweite Frage würde lauten, wo Koy sei.
Ich warf das Ruder ins Boot und versuchte, ganz normal zu wirken, als ich wie üblich den Weg zu der Bucht einschlug, in der ich meine Fischfallen auslegte. Die Sonne hatte den höchsten Punkt überschritten und der Wind frischte auf. Die Besatzung der Marigold würde sich darauf vorbereiten, direkt nach dem Sturm auszulaufen.