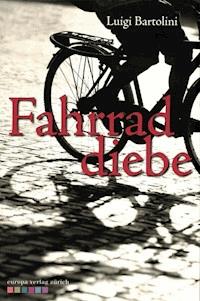
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Luigi Bartolinis Roman ist ein Klassiker der Weltliteratur. Der Lieblingsfilm von Martin Scorsese ist ein Buch. Von den ehrenwerten Dieben, den lieben Verbrechern, den schönen Geldfälschern - und von den verdammten Räubern von Fahrrädern."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luigi Bartolini
Fahrraddiebe
by Europa Verlag AG Zürich 2011
Die italienische Originalausgabe erschien 1948 unter dem Titel „Ladri di biciclette" bei Longanesi & Co., Mailand Umschlaggestaltung: Christine Paxmann text • konzept • grafik Umschlagbild: iStockphoto
E-Book Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN: 978-3-905811-28-5
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Luigi Bartolini
Fahrraddiebe
Aus dem Italienischen von Hellmut Ludwig
I
VON DEN EHRENWERTEN DIEBEN,DEN LIEBEN VERBRECHERN,DEN SCHÖNEN GELDFÄLSCHERN –UND VON DEN VERDAMMTEN RÄUBERNVON FAHRRÄDERN
Roms Diebeshöhle seit unvordenklichen Zeiten ist das Gassengewirr um Campo dei Fiori. Nur dass sich heutzutage dort noch hundertmal mehr Diebe herumtreiben als früher. Via dei Baullari, Via dei Coronari, Vicolo del Cinque: dort haben sie ihre Höhlen, ihre Keller, ihre Weinkneipen, ihre Stehbars, ihre Läden, dort sind die Bordelle, die Verstecke, die Schlupfwinkel unserer römischen Diebe.
Hierher bin ich heute gekommen, auf die Piazza del Monte, um zu versuchen, mein schönes neues Fahrrad wiederzufinden, das mir gestern gestohlen wurde. Es war nicht einfach verschwunden — o nein, der Dieb nahm es mir geradezu aus der Hand, während ich noch fast auf der Türschwelle stand zu einem Schusterladen.
Ich brauchte nämlich Schuhcreme, schwarze Schuhcreme. Vergeblich hatte ich es auf der Via della Scrofa in allen Geschäften versucht; dann, auf der Piazza Navona, kam mir der unselige Gedanke, einen Gemüsekrämer zu fragen, wo in aller Welt, in welchem Geschäft, bei welchem Händler sich wohl eine Dose Schuhcreme auftreiben lies. Der Mann verwies mich in die Via dei Baullari. Eine Vorahnung riet mir, nicht dorthin zu gehen. Doch ich brauchte Schuhcreme, ich hatte Eile — und also ging ich hin. Hinter seinem Ladentisch hervor antwortete der Unglücksmensch von Verkäufer, Schuhcreme habe er wohl, aber gleich von der Tür her nachzufragen, ohne erst richtig einzutreten, das schien ihm wohl nicht das angemessene Benehmen zu sein, in dieser Zeit der Verkäufergnade.
«Warum kommen Sie nicht herein? Soll ich Ihnen das Zeug vielleicht noch nachtragen?»
So lehnte ich mein Rad ans Schaufenster und ging hinein.
Doch hatte ich noch keine zwei Schritte auf den Verkäufer zu gemacht, als draußen auf der Straße hinter der Scheibe ein Gesicht auftauchte und mein Fahrrad prüfend betrachtete. Augenscheinlich um sich zu überzeugen, dass es nicht durch ein Schloss gesichert war. Ich fand kaum Zeit, zu dem Händler zu sagen: «Warten Sie einen Augenblick, die Fratze da draußen gefällt mir nicht», und schon hatte der Dieb, ein schlecht gekleideter junger Mann ohne Krawatte, mit kahl geschorenem Kopf, so wie es im Gefängnis die Anstaltsfriseure mit einer Mulo-Schere zuwege bringen, das Fahrrad ergriffen, war aufgesessen und machte sich aus dem Staube.
«Mein Rad ist gestohlen! Mein Rad ist gestohlen!» So schreiend stürzte ich aus dem Laden, um dem Dieb nachzusetzen.
Doch zwei oder drei Individuen traten mir in den Weg; es waren die Schmieresteher, die «Pfähle», wie man in Rom sagt. Sie beruhigten mich, der Dieb werde schnell eingeholt sein. Der eine rief sogar: «Sie haben ihn schon; sie haben ihn!»
Keineswegs: der Dieb, auf meinem Fahrrad sitzend, von zwei anderen «Pfählen» verfolgt, die taten, als liefen sie ihm nach, fuhr unbehelligt weiter, in Richtung Corso Vittorio Emanuele. Ich schrie noch immer: «Packt ihn! Haftet den Dieb! Al ladro! Acciuffatelo!»
Doch niemand hielt ihn auf. Stattdessen taten zwei oder drei Radfahrer — ebenfalls «Pfähle» —, als wollten sie ihn verfolgen. So dass die Leute, die vielen vorübergehenden Leute, Platz machten, um die Gruppe von Radfahrern vorbeizulassen. Ich schrie, so lange ich konnte. Einer der Diebsgehilfen begann, einem anderen Radler nachzulaufen. Er holte ihn ein. Er liess ihn absteigen und brachte ihn, zu Fuss, zu mir her. «Ist das Ihr Rad?» fragte der Hehler.
Es war mein Rad nicht. Aber ich konnte von dem Kerl nicht Namen und Adresse fordern, da er sich beleidigt stellte und zu protestieren anfing. So dass ich ihn seines Weges ziehen lassen musste. Ich hätte es nicht getan, wenn ich nur auf dem Corso einen «Pizzardone» hätte erblicken können, einen von unseren früheren Städtischen Polizisten. Doch wo ist in diesen schrecklichen anarchischen Tagen ein Polizeibeamter zu sehen? Andere Personen, die sich herzu gesellt hatten, rieten mir, sofort zur Polizeiwache (sie nannten den Namen einer Straße) zu gehen. Es mussten sehr harmlose Leute sein oder gleichfalls Diebe; denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie nutzlos es schon seit längerer Zeit, seit über einem Jahr, ist, zur Polizei zu rennen, und wie es wirklich nur vergeudete Zeit ist, über den Vorfall eine schriftliche Anzeige einzureichen. Es ist nutzlos. Wenn die jugendlichen Wachtmeister nicht noch einen Weg finden, euch zum Narren zu halten und als Dummkopf hinzustellen, könnt ihr eurem Herrgott danken. Und statt euch zu helfen, wie es ihre Pflicht wäre, ihr Beruf, und den Dieb zu suchen, geben sie euch treu und schlicht zur Antwort: «Wir haben schon genug Diebe zu suchen! Regina Coeli», das römische Gefängnis, «ist schon überfüllt. Was sollen wir machen? Schauen Sie, wie Sie zurechtkommen!»
Oder aber, sie sagen ganz im Gegenteil: «Wir werden unser Möglichstes tun, lassen Sie uns inzwischen Ihre Telefonnummer da ...
So sprechen sie, haben aber nichts weiter getan, als Ihre Zeit zu verschwenden. Seid sicher, kein Beamter wird nach Ihrem Rad oder dem Dieb auf die Suche gehen.
Der junge Mann, der mir mein Fahrrad gestohlen hat, mein schönes, leichtes, fünf Kilo wiegendes Fahrrad, mit den neuen Reifen, mit Schläuchen, die kaum geflickt waren — der vordere einmal, der hintere zweimal —, mit Rennlenker, Gepäckträger, Aluminiumpumpe, muss erst vorgestern aus Regina Coeli entlassen worden sein; oder wahrscheinlicher: er ist vorgestern während des Durcheinanders bei dem letzten Brand, ich weiß nicht in welchem Flügel des Gefängnisses, ausgebrochen. Er war wohl, kaum dem Getümmel entronnen, der Meinung, dass es nur die eine Möglichkeit für ihn gebe, aufs Neue anzufangen zu stehlen. Gewiss, er bestahl mich mit einer klassischen Unverfrorenheit. Er hatte keine Angst vor den vielen Leuten. Er hat seine Tat perfekt organisiert. Noch mehr Menschen scharten sich um mich und rieten mir — doch das hätte ich schon von allein getan —, sofort zur Piazza del Monte zu gehen, denn dort sei der Hauptsammelplatz, der Schlupfwinkel für alle Gauner.
Auf dem Platz herrscht von früh bis abends Gedränge, ein solches Gedränge, dass man nur mühsam vorwärts kommt, nichts als Diebe, jeder Kategorie, jeden Kalibers und jeden Typs, und für alle Arten von Gegenständen: Stoffe, Ledergamaschen, Schuhwerk, Kupferdraht, Glühbirnen, ja Zahnbürsten und Parfüms. Da sind die Diebe von Rasierapparaten und -klingen. Diebe von Flicken für Fahrradschläuche. Diebe von Uhren, und, vor allem, Diebe von Fahrrädern. Während in den früher so wohlausgerüsteten Läden und Geschäften der Via delle Colonnette und der Piazza Quadrata, Piazza Fiume — bei der Firma Lazzaretti — und der Piazza Vittorio Emanuele an Fahrrädern buchstäblich nichts mehr zu sehen und zu finden ist, so herrscht auf Piazza del Monte Überfluss an neuen blitzblanken wie an alten und ältesten Rädern. Hier findet man leuchtende «Bianchis» neuesten Modells, mit Bogenlampe. Allein für die Lampe verlangen sie dreitausend Lire. Sie verlangen zweitausendneunhundert für einen Reifen 28 3/4 und dreitausendzweihundert für einen zu 28%. Für einen Schlauch, der zudem noch ein paar Flickstellen hat, wollen sie tausendsechshundert Lire. Man sieht Diebe, die gleich Schultergehängen über Rücken und Brust ganze Bündel von Schläuchen und Dutzende von Reifen daherbringen. Andere Diebe haben an den äußersten Ecken des Platzes eine schmutzige Decke ausgebreitet und darauf die Ersatzteile der gestohlenen und auseinandergenommenen Fahrräder. Denn man muss wissen, das erste, was Diebe mit einem gestohlenen Rad tun, ist es zerlegen oder unkenntlich machen.
Sie zerlegen es, wenn sie glauben, dass seine einzelnen Teile wiederzuerkennen sind; und das sind die Räder mit alten Rahmen und neuen Felgen, ungewöhnlichen Lenkstangen, besonderem Anstrich, Räder, die keine Serienfabrikate sind. In diesen Fällen halten sie es für geraten, das Fahrrad in seine Bestandteile zu zerlegen und diese einzeln an den Mann zu bringen: heute die Lenkstange, morgen die Felgen, übermorgen die Pedale, dann die Lampe. Aber mitunter zerlegen sie auch noch die Lampe und verkaufen den Dynamo und den eigentlichen Scheinwerfer getrennt. Doch wenn es sich um fast neue und unbeschädigte Fahrräder handelt, werden sie getarnt. Dann genügt es, an jener Stelle etwas zu feilen, wo die Fabrikationsnummer eingestanzt ist. Oder es genügt, die Schutzbleche abzunehmen, eine Bremse auszuwechseln oder die Lenkstange, um das Rad unkenntlich zu machen. Ja, es sind Diebe! Manche anständig und manche schlecht gekleidet. Ein schlecht gekleideter fällt dem Laien eher auf, wie er so wartend und beobachtend dasteht, das Gesäß auf die Querstange des Rahmens gestützt: auf sein Fahrrad, welches zehnmal, hundertmal mehr wert ist als die triste Gestalt, wenn man ihren Preis als Galeerenfleisch berechnet.
Ich persönlich beobachte aber lieber die Diebe in Glacéhandschuhen. Menschen, die gar nicht wie Diebe aussehen. Die im Gegenteil aussehen wie mittlere Ministerialbeamte oder allenfalls wie Verkäufer in einem Laden, wie junge Bürogehilfen: das Haar mit Pomade geglättet oder angefeuchtet, gut geschnitten und wohl gekämmt, das Hemd nach der letzten Mode, stets frisch gewaschen und gebügelt, elegante Armbanduhr, amerikanische Schuhe. Die Augen graugesprenkelt, die Nase wie Bockshorn. Ich besitze eine besondere Fähigkeit, nach dem Aussehen einzuschätzen, was ein Mensch ist und auch, was er wahrscheinlich denkt. Trotzdem gibt es Diebe, die so gut zurechtgemacht sind, dass sie wie anständige Leute wirken und sogar mich täuschen können. Und sie täuschen nicht nur mich, sondern täuschen auch andere Diebe: denn es ist nicht gesagt, dass jeder Dieb seine Berufsgenossen kennt und dass alle Gewohnheitsbesucher der Piazza del Monte eine geschlossene Clique bilden. Man kann sogar verschiedene Vereinigungen erkennen, wie zum Beispiel die Bordellgruppe in der Via del Panico.
Sie finden diese letztere, besser gesagt, Sie hätten sie bis gestern gefunden — das heißt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Angloamerikaner, ihren puritanischen Gepflogenheiten folgend, alle Freudenhäuser in Rom schließen ließen — in den beiden Bordellen der Via del Teatro della Pace oder in jenem Hurenhaus mit der steilen Treppe am Ende des Vicolo del Pellegrino oder in einem anderen — ich glaube es befindet sich in der Via della Campanella — in der Gegend des berühmten Panico. Dort hätten Sie sie in den frühen Morgenstunden antreffen können, diese Alfonsos, welche die Nachtstunden mit schmierigen Dirnen verbringen und in den schmutzigen Betten, die schon von all den vielen Stiefelpaaren der Tageskunden und der Kanoniker zerwühlt sind, bis zum Morgengrauen schlafen. Dann, im dämmernden Morgen, wachen sie auf: die Huren schlafen noch oder räkeln sich im Halbschlaf, während ein Speichelfaden aus ihren eklen, nach Tabak, Alkohol und Geschlechtlichkeit stinkenden Mündern tropft; doch der Alfonso verbringt die Morgenstunden mit offenen Augen, zwischen sechs und sieben denkt er über seine Pläne nach, überlegt, wo er heute etwas stehlen wird. Dann verlässt, besser gesagt: verließ er die Lasterhöhle. Wohl gekleidet, wohl gekämmt verließ er die Lasterstätte, um sein verbrecherisches Vorhaben auszuführen oder das Ergebnis einer schon durchgeführten Unternehmung auf der Piazza del Monte zu veräußern. Menschlicher Abschaum, Gesindel, das niemals gearbeitet hat! Sie haben das Alter erreicht, wo sie sich verheiraten, eine Familie gründen, ein Geschäft aufmachen könnten, doch sie denken gar nicht daran. Sie haben nie daran gedacht. Sie sind aufgewachsen in den Straßen und Gassen Roms, wie in den Gassen der Provinznester die Disteln groß werden, wie Löwenzahn auf Friedhöfen, wie Kletter- und Parasitenpflanzen. Und die Diebe haben auch niemals bedacht, dass es weniger mühevoll sein könnte, ehrlich zu arbeiten. Sicherlich, sie betrachten ihre Tätigkeit nicht als mühevoll: dort auf der Piazza del Paradiso herumzustehen, in der Nähe des Campo dei Fiori, auf den Warnruf, auf den Wink des Schmierestehers zu achten, eine Zigarette in den Fingern rollend, das ist für sie keine besondere Mühe. Und es ist auch wirklich keine große Mühe. Es ist die Mühe der Lumpen. Aber immerhin, Mühe ist es.
Für mich wäre es unerträglich beschwerlich, Schmiere zu stehen. Lieber würde ich sechs Stunden hintereinander am Tisch sitzen, ohne die Feder vom Papier abzusetzen, als auch nur eine Viertelstunde herumzustehen und mich mit Schmiere stehen zu langweilen. Doch für sie muss es eine abwechslungsreiche Tätigkeit sein. Sie tragen gelassene Gleichgültigkeit zur Schau, sie spielen die Rolle irgendeiner Beschäftigung; sie tun das, um den Vorübergehenden nicht aufzufallen. Aber das ist es eben, das ist die schwarze, die schwärzeste Seite der Angelegenheit, dass die anständigen Leute, die braven Bürger, die dort in den Straßen der Diebe wohnen oder ihr Geschäft haben oder die dort vorbeigehen, und das sogar mehrmals und wiederholt am Tage, schließlich und ohne es zu wollen, das Diebsgesindel dulden und es ruhig stehlen lassen, dass sie ihre Mitmenschen berauben lassen. Und ob sie das tun! Gehen Sie nur hin und fragen Sie beispielsweise einen Gastwirt. Die Gastwirte kennen die Diebe Mann für Mann. Sie kennen sie; doch teils fürchten sie sie, und das ist erklärlich und leuchtet ein, teils begünstigen sie sie, und das scheint seltsam und unerklärlich. Ich komme zu der paradoxen Folgerung, dass Barbiere, Gastwirte, Ladeninhaber — einige, nicht alle — eine gewisse Sympathie, ein gewisses Verständnis, ich möchte sagen, eine gewisse Zuneigung für die Diebe empfinden. Diebe waren ja auch die frühesten Bewohner Roms: sie raubten die Frauen der Sabiner; Frauendiebe also, aber immerhin Diebe. Doch lassen wir das beiseite, lassen wir die Geschichte Roms; ich werde sie eines Tages einmal schreiben, eine wahrhaftige, humoristische Geschichte Roms. Sicher ist — um auf die unerhörte, unglaubliche Beihilfe zurückzukommen, welche die Diebe in Rom immer genossen haben und noch heute genießen —, sicher ist, wenn Sie Ihr Fahrrad verloren haben, oder besser gesagt: wenn Sie Ihres Stahl- und Gummirosses verlustig in Wut- und Klagegeschrei ausbrechen oder sich mit der flachen Hand an den Kopf oder mit der Faust auf den Magen schlagen, dass der Kutscher, der Chauffeur, der Wirt, der Ladenbesitzer, der Barbier hinter Ihnen drein lachen; und wenn Sie sich nicht schnell aus dem Staube machen, beginnen sie auch noch, Sie zu verspotten und bis zur Beleidigung anmaßend daherzureden. Danken Sie in solchen Fällen Ihrem Herrgott, wenn Sie nur als Dummkopf und Trottel dastehen!
Und wer bei Hohn- und Spottreden ungeschoren bleibt, wer unbescholten aus dem Andenken an diesen Diebstahl hervorgeht, das ist der arme Dieb. Er ist der «liebe Dieb», wie Verlaine sagte.
Man weiß, dass Verlaine die Diebe liebte. Weil er mit ihnen zusammen im Gefängnis saß, deshalb liebte er sie. Und er nannte sie «die lieben Diebe». Und was Mörder angeht, so nannte er sie «die süßen Mörder». Aber das war für ihn lediglich eine Frage des Reims, höchstens eine Frage von Worten, der klingelnden Worte von Dichtern — die nichts bedeuten in der nackten Wirklichkeit der Dinge. Ich für meinen Teil würde, wenn ich mich, um Dichter zu sein, auch selbst der Päderastie oder den Dünsten des Alkohols ergeben müsste, den Dieben gegenüber doch nichts als ein guter Polizist sein. Ein geduldiger und beharrlicher Polizist. Einer aus Überzeugung, der anders als Verlaine die Jagd auf Diebe, die Verachtung der Diebswelt zum Gegenstand seiner Dichtung macht. Man merkt, dass Verlaine, als er im Gefängnis in Mons seine lieben Diebe tröstete, noch nicht Rad fahren konnte. Aber da es eine Karikatur Verlaines gibt, auf welcher der Dichter sich selbst hoch zu Rad dargestellt hat, wage ich anzunehmen, dass entweder zu seiner Zeit in Arles nicht so viele Diebe existierten, wie es heute allein auf der Piazza del Monte in Rom gibt; oder dass damals, vor hundert Jahren, die Diebe etwas mehr Achtung vor Poeten oder Mitleid mit ihnen hatten. Mit Poeten, wie ich einer bin: einer, der sein Fahrrad rechtschaffen benötigt wie das liebe Brot. Wenn das Brot dazu dient, so gut es geht, seinen Hunger zu stillen, so stellt das Fahrrad für ihn eine andere Art von Brot dar: Brot, das seine Seele nährt. Jene Ernährung an Geist und Seele, die meiner Erfahrung nach nur zu erreichen ist, wenn man mindestens ein Dutzend Kilometer von der Stadt, von der äußersten Peripherie der Vororte, entfernt ist. Ich benötige mein Fahrrad, um zu verschwinden, um auszureißen, um mich der Gemeinschaft der Menschen zu entziehen.
Wie könnte ich zum Beispiel die Szene vergessen, die ich heute Morgen auf der Piazza del Monte erlebte? Ganz unversehens erschien zwischen den Dieben, die ihre Fahrradreifen und -schläuche verkauften, ein eleganter junger Mann. Ein junger Mann, groß wie ein Gardegrenadier und prächtig anzuschauen. Ich habe mich nie nach Männern umgesehen, um sie unter dem Gesichtspunkt der Schönheit zu betrachten; und doch hefteten sich meine Augen auf ihn wie auf eine griechische Statue. Eine Statue von Phidias. Eine Reiterfigur vom Parthenonfries. Sein gewelltes Haar war kastanienbraun; nicht rabenschwarz wie bei den Bewohnern von Trastevere oder Parione, sondern kastanienbraun wie bei Filmschauspielern. Seine Augen waren nicht heller als trübes Wasser, mit Reflexen wie bei Wasser, das nach Maultierurin riecht. Trotzdem war er an körperlicher Schönheit ein Abbild des Adonis. Und während ich ihn betrachtete, dachte ich voll Melancholie an meine jungen Jahre — ach, sie liegen hinter mir! —, als auch ich schön war wie dieser hier. Ich betrachtete ihn, auch wegen dieser Erinnerung, mit Sympathie und viel Neugier. Er war gekleidet wie ein Filmstar, er trug eine gewirkte Bluse aus Seide oder feiner Wolle, was es auch sein mochte, von nussbrauner Farbe; das Hemd unter der Weste schloss mit einem Reißverschluss; er trug ein Paar Hosen, tadellos in Schnitt und Bügelfalte, so dass eine junge Stenotypistin den Kopf verlieren musste. Ich schätzte, wie gesagt, dass er Filmschauspieler sein mochte. Ein bekannter Filmstar. Doch das Schlimme ist, dass ich die Herrlichkeiten der Leinwand nicht übermäßig liebe, den Film, wie man weiß, sogar für eine vulgäre Kunst halte, die niemals, aus ihrer Natur heraus, aus ihrem Wesen und infolge ihrer praktischen Erfordernisse sich vom Vulgären wird befreien können, und so bin ich in den Schönheiten der Leinwand wenig bewandert. Ich kenne nicht einmal die Namen, nicht einmal die Heldentaten unserer größten Filmhelden, die doch jedes junge Mädchen in allen Einzelheiten auswendig weiß.
Während ich so mit mir selbst Zwiesprache hielt, erstand der junge Herr zwei Fahrradreifen. Der verkaufende Dieb verlangte den Preis von dreitausend Lire für jeden. Der schöne junge Mann prüfte aufmerksam von rechts und von links die Ware, die er erwarb. Dann holte er mit einer wundervollen und sehr eleganten Geste aus der kleinen Tasche, welche elegante Herren an der rückwärtigen Seite ihrer Beinkleider haben, eine Lederbrieftasche hervor, die wie ein Buch gefaltet war. Es war eine Brieftasche aus Antilopenleder. Ich hatte noch nie ein solches Prachtstück gesehen und werde wohl nie wieder ein solches zu sehen bekommen und nicht nur in unserer hässlichen abscheulichen Zeit des Hungers und der Trübsal, sondern auch in den vielleicht kommenden goldenen Zeiten. Die Brieftasche war trächtig von Fünfhundertlirenoten. Das sind jene rosaroten Geldscheine, die von ferne aussehen wie Scheiben köstlicher Mortadellawurst; doch von solcher Verwandtschaft soll man nicht sprechen. Sie beeinträchtigte auch nicht die Schönheit des jungen Mannes und nicht die äußerste Eleganz seiner Finger, die weder dick und plump waren, noch feminin. Er entnahm dem Pack der Fünfhundertlirenoten mehrere und zählte sieben ab. Dann wurde er etwas verlegen. Da er Scheine zu zehn Lire abzählen musste, war es, als habe er sich bei dem langweiligen und lästigen Abzählen verrechnet. Jedenfalls bemerkte er mit lauter Stimme, während er zählte, dass er die kleinen Geldscheine noch einmal von neuem durchzählen müsse. Die sieben Fünfhunderter, bedeutete er dem Dieb, könne er schon einstecken. Was der Dieb, mit vor Zufriedenheit unmerklich zitternder Hand, eiligst tat. Dem schönen jungen Mann gelang es endlich, die restlichen zweihundert kleinen Scheine zu zählen. Er nahm die beiden Reifen über die Schulter, bestieg sein sehr schönes Aluminium-Fahrrad und fuhr davon.
Ich hingegen blieb und beobachtete den Dieb und Reifenverkäufer. Und ich sah, wie er in weniger als zehn Minuten ein weiteres Paar Reifen an einen braven Mann verkaufte, der aus Ariccia oder Frascati zu sein schien. Ein älterer Mann, mit rotem Gesicht und weißem, strähnigem Haar, sicherlich ein verschlagener Gastwirt. Er bezahlte mit Tausendernoten, mit jenen kaffee- oder schokoladebraunen. Jedenfalls bekam er, nachdem er dem Dieb drei pergamentene Tausendlirescheine in die Hand gedrückt hatte, eine rosige mortadellafarbene Fünfhunderternote als Rest zurück. Dann ging auch der Wirt seines Weges. Ich verfolgte den Verkauf der Fahrradreifen weiter. Es war eine gute Ecke. Mein Beobachtungsstand war so gewählt, dass ich mit einigem Schielen fast die ganze Piazzetta überblicken konnte. Und bemerken, wenn in einem für mich glücklichen Augenblick unter den Dieben der meines Fahrrads auftauchen sollte. Wenigstens der Dieb. Wenn schon nicht der Dieb samt dem Rad, so doch das Gesicht des Diebes!
So stand ich innerlich seufzend da, als, hast du nicht gesehen, der Gastwirt von vorhin zurückkommt, mit den Armen in der Luft fuchtelt und in der zusammengeballten Rechten den Fünfhundertlireschein schwingt, den er kurz zuvor als Rest von dem Dieb und Reifenverkäufer herausbekommen hatte.
«Er ist falsch! Er ist falsch!» schrie er. «Sie haben mir einen falschen Schein gegeben.»
«Falsch?»
«Ja, gefälscht, Sie haben ihn mir gerade vorhin gegeben. Und im Übrigen, als ich ihn genauer anschaute, habe ich es schon selbst gemerkt.»
«Wissen Sie denn noch, wer Ihnen den gegeben hat?» fragt in aller Ruhe seinerseits mein Reifenverkäufer und fügt hinzu:
«Wer weiß, wer Ihnen den gegeben hat! Wo sind Sie gewesen? Ich habe Ihnen nichts herausgegeben. Ich habe Ihnen nichts verkauft!»
«Wieso, nichts verkauft?» fragt der Gastwirt erstaunt und aufgebracht. Und, wie es die Römer tun, Wirt und Dieb beginnen einander mit bösen Worten zu traktieren.
Schließlich schlägt der Wirt einsichtsvoll dem Dieb vor, in seiner Brieftasche gut nachzuschauen, ob sie nicht, zufällig, noch weitere so ungeschickt nachgemachte Fünfhunderter enthalte.
Jetzt mische ich mich in die Debatte und bitte, mich den falschen Geldschein anschauen zu lassen. Die Diebe bestehlen auch mich; doch bin ich ihnen kein Unbekannter. Sie haben mich hundertmal die Piazza Navona zeichnen und mich durch ihre Gassen streifen sehen, auf der Suche nach Modellen. Seeräubermodelle, Zigeunermodelle, verkommene junge Modelle für Bacchanale. Jugendliche Huren: ich weiß selbst nicht, weshalb gerade sie mich anziehen; ich weiß nicht einmal, wie ich es mache, sie in meiner Vorstellung in Nymphen zu verwandeln, sie hinüberzunehmen in meine freie Welt voller unverdorbener Geschöpfe, Geschöpfe, die der Wirklichkeit — einer Wirklichkeit, die es nicht gibt — ebenso sehr ähneln, wie sie, verglichen mit der vulgären Existenz und der mich selbst oft anwidernden wahren Gestalt der Modelle, vergöttlicht erscheinen.
Dieb und Gastwirt waren einverstanden und gaben mir den Geldschein, damit ich ihn untersuchen könnte. Der Schein war nur wenig besser nachgemacht als jene faksimilierten Noten, die nur auf einer Seite bedruckt sind und als Reklame für Banfi-Stärkemehl dienen. Es war sicher eine nach einem echten Schein in sorglosem Lichtdruckverfahren hergestellte Note. Ein so schlecht gedrucktes Papier, dass die Erkennungszeichen und -marken gar nicht aneinander passten; es war also nicht nur gefälscht, sondern erwies sich auch als in großer Eile gedruckt. Wenn man den Schein gegen das Licht hielt, ergab das Wasserzeichen keine Figur, sondern ein halbes Ungeheuer. Ein Halbungeheuer von einer Figur, ohne Licht und Schatten und ungeschickt mit einem Stempel eingepresst, der nur die schwärzlichen Linien wiedergab.
Ich sagte, der Schein sei falsch. Weitere Diebe, die inzwischen herzugekommen waren, bestätigten mit sachkundiger Arroganz — es waren Taschendiebe, Diebe von Brieftaschen —, dass der Schein nur ein ganz ungeschickter Schwindel sei, ein ganz erbärmliches Machwerk. Jetzt lachten alle, Diebe wie Ehrenmänner. Nur ich stand da und lachte nicht, sondern gab acht, wie die Szene ausgehen würde. Sie ging so aus, dass der arme Dieb und Reifenverkäufer mit diesmal sehr viel stärker zitternder Hand aus der Innentasche seine schmierige Brieftasche hervorholte und die sechs Fünfhunderternoten zeigte, die ihm geblieben waren von denen, die er von dem schönen Adonis Jüngling erhalten hatte; von dem Überdieb, dem Dieb der Diebe, von der Statue, die dem Reiterbild des Phidias ähnlich sah, von dem Dieb in gelben Handschuhen.
«Aber das macht nichts!» antwortete der bescheidene und gewöhnliche Dieb auf die Spottworte seiner Diebskollegen. «Jemand hat sie mir gegeben, und jemand wird sie nehmen. Für mich sind sie alle echt!»
Er wollte sagen, dass es für ihn, echt oder nicht, gefälscht oder nicht, alles gleicherweise gestohlenes Geld sei.
«Auch die echten sind falsch und haben keinen Wert!» seufzte er philosophisch. Aber sein Seufzer war nur von kurzer Dauer; und nachdem er den falschen Schein wieder an sich genommen und die fünfhundert Lire in einem echten Schein herausgegeben hatte, fuhr er fort, seine gestohlenen Fahrradreifen weiterzuverkaufen. Doch gab er dabei acht, dass er die falschen Fünfhunderter nur denen als Rest herausgab, die mehr Eile zeigten als der Gastwirt oder augenscheinlich nicht in der Nähe wohnten.
Am nächsten Tag gedachte ich mich zur Porta Portese zu begeben, denn Porta Portese ist der größte unter den Sammelplätzen der Diebe Roms. Es war am frühen Morgen, und als ich aufstand, mag es halb sieben gewesen sein. Es war einer der schönsten Tage gegen Ende September; und der September ist in Rom der schönste Monat, der hellste, der blaueste und der frischeste Monat. Ich verließ das Haus in Verkleidung, da ich bemerkt hatte, dass am Tag zuvor auf der Piazza del Monte allzu viele Diebe die Anwesenheit eines Nichtdiebs, wie ich es war, festgestellt hatten, eine Qualität, die aus meiner bescheidenen Kleidung zu entnehmen war, aus meiner Miene eines Mannes, der zeigt — aber nur wenn man ihn aufmerksam anschaut —, dass er durch irgendetwas ausgezeichnet ist. Ich ging ohne Kragen, band keine Krawatte um, sondern wickelte mir einen schottischen Wollschal um den Hals und knotete ihn nach Art der Diebe. Ich wählte unter meinen Schuhen ein Paar, das einmal sehr schön gewesen, aber durch langen Gebrauch abgetragen und geflickt war. Trotzdem bildete ich mir nicht ein, wie ein echter Dieb auszusehen. Im Gegenteil: dass ich mich so zurechtgemacht hatte, trug mir nur die verwunderten Blicke des indiskreten Portiers meines Hauses in der Via Oslavia ein. Vom Rione Prati musste ich auf dem Rad — denn ich besaß, ehe mir das andere geraubt wurde, zwei Räder; und ein zweites Rad zu besitzen ist unumgänglich notwendig, wenn man versuchen will, ein gestohlenes wiederzubekommen —, ich musste also den Tiber entlang radeln, durch die Via Lungara, über den Ponte Garibaldi, bis zum Viale del Re, der heutigen Via Trastevere, auf der Höhe des Unterrichtsministeriums einbiegen und mich links halten, bis man durch die Via Portuense zur Besserungsanstalt für Minderjährige gelangt, und von dort dann zur Porta Portese. Als ich über den Petersplatz kam, überfiel mich die Schönheit dieser riesigen rosa und himmelblauen Muschel aus dem Meer der Christenheit. Ich hatte halb Rom in seiner Stille durchquert, denn Rom geht abends zeitig zu Bett und erwacht des Morgens nicht vor acht, halb neun. Ich meine das bürgerliche Rom. Das Rom der Diebe hingegen stand bereits um viertel vor sieben längs jenes Schlauchs von Straße aufgereiht, der in früherer Zeit als Zugang zu den Hundezwingern der Porta Portese diente. Eine hässliche Straße, die ich bereits kennengelernt hatte, als ich sie vor einigen Jahren mit ähnlicher Angst wie heute Morgen durchfuhr, um meinen Hund «Liebe» zu suchen, der mir gleichfalls gestohlen worden war. Mir hatten nämlich die Diebe Roms bereits im Dezember des Jahres 1938 ihren Willkommensgruß dargebracht, indem sie mir meinen wunderschönen Setter, der den deutschen Namen «Liebe» führte, stahlen; ich fand ihn damals im Schlund eines Backofens wieder, wo ihn der Bäcker, ein Freund des Jägers, der ihn mir gestohlen, verborgen hielt.
Um viertel vor sieben quirlte es in dem Straßenschlauch an der Porta Portese bereits von Dieben. Auch längs der beiden Geländer der Brücke standen sie in hellen Scharen. Diebe, die dastanden, ein jeder mit einem, mit zwei und sogar drei Fahrrädern neben sich, zwischen Verkäufern von Feigen und Weintrauben, von Nüssen und Haselnüssen. 0 weh!, es waren so viele Menschen, dass ich fürchten musste, die Hauptschwierigkeit werde sein, mich zwischen ihnen hindurchzuzwängen, ehe der Dieb meine Anwesenheit bemerkte. Ich hatte mir gedacht, dass sich an der Porta Portese kaum mehr als hundert Personen befinden könnten; stattdessen waren es mindestens zweitausend. Ich begann, mich zwischen den Dieben auf dem Platz durchzuschlängeln. Sie waren wie in Reihen aufgestellt. In der ersten Reihe, ganz vorne, standen diejenigen, die ein oder zwei Räder in der Hand hatten. Es handelte sich jedoch um alte, abgenutzte Fahrzeuge, um solche, wie man sie sonst bei öffentlichen Versteigerungen finden kann, Fahrräder ohne Reifen und ohne Schläuche, abgeschabte, zusammengeschweißte, verbeulte Räder. Hinter der ersten Reihe standen die Verkäufer von Reifen, Schläuchen und Ersatzteilen. Ich erkannte in der ersten Reihe mehrere von den Dieben, die ich schon auf Piazza del Monte beobachtet hatte. Da war jener, der drei Räder der Marke Wolsit zu veräußern hatte: Räder der ehemaligen Fascistischen Miliz, Diensträder, neue, stattliche, schwarz lackierte Räder. Sie wurden von allen Dieben zu annähernd immer demselben Preis angeboten, rund fünfzehntausend Lire. Die Verkäufer waren Diebe von Profession oder desertierte frühere Soldaten; vielleicht waren sie beides zugleich.
Unter den Dieben bemerkte ich zwei junge Leute, die im Knopfloch irgendein studentisches Abzeichen trugen. Sie gingen mit einem kleinen Koffer in der Hand umher und näherten sich zaghaft und vorsichtig den Käufern. Wenn der Käufer bejahte, öffnete einer der beiden jungen Leute den Koffer und bot schwarze Blusen der ehemaligen Universitätsmiliz zum Verkauf an. Sie verkauften auch Zeitgerät.
Während ich mich durch die ersten Reihen der Diebe drängte, kam ein Jüngling in grünem Pullover auf mich zu; er war ein kräftiger, hemmungslos auftretender, gebieterischer junger Mann, er glich einem alten Römer oder einem jüngst verflossenen Straßenschlachtfascisten. Er fragte mich mit vorbildlicher Unverfrorenheit, ob ich mich an diesen Platz gestellt hätte, um zu verkaufen oder um zu kaufen. Ich antwortete, dass ich hier stünde, um zu verkaufen. Er — der mich bereits auf der Piazza del Monte gesehen haben musste — sah mich noch einmal abfällig von oben bis unten an: wie um mir klarzumachen, dass er wisse, wer ich sei, und auch weshalb ich mich hier zwischen den Dieben befände, nämlich nicht mit der Absicht, etwas zu verkaufen, sondern dem Dieb meines anderen Fahrrads nachzuspüren; und wenn möglich auch das Rad selbst wiederzubekommen. Schließlich fragte er mich, wie viel ich für das Rad, das ich bei mir hatte, haben wolle; und ich, um ihm zu verstehen zu geben, dass er mir lästig falle, gab ihm zur Antwort: «Dreissigtausend.»





























