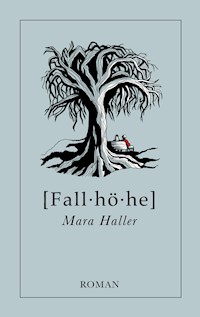
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf den Knien der Frau, die sich genau auf diese Bank, unter diesen Baum, vor diesen Zaun, neben diese Hecke gesetzt hatte, lag ein Buch. Ihre Hände lagen schwer darauf, strichen unbeholfen über den Umschlag, so als ob sie zögerten, das Buch endlich zu öffnen, so als ob es das Schwerste auf der Welt wäre, den Buchdeckel anzuheben und die erste Seite aufzuschlagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In liebevoller Erinnerung an Mama
Inhaltsverzeichnis
Kapitel EINS
Kapitel ZWEI
Kapitel DREI
Kapitel VIER
Kapitel FÜNF
Kapitel SECHS
Kapitel SIEBEN
Kapitel ACHT
Kapitel NEUN
Kapitel ZEHN
Kapitel ELF
Kapitel ZWÖLF
Kapitel DREIZEHN
Kapitel VIERZEHN
Kapitel FÜNFZEHN
Kapitel SECHZEHN
Kapitel SIEBZEHN
Kapitel ACHTZEHN
Kapitel NEUNZEHN
Kapitel ZWANZIG
Kapitel EINUNDZWANZIG
Kapitel ZWEIUNDZWANZIG
Kapitel DREIUNDZWANZIG
Kapitel VIERUNDZWANZIG
Kapitel FÜNFUNDZWANZIG
Kapitel SECHSUNDZWANZIG
Kapitel SIEBENUNDZWANZIG
Kapitel ACHTUNDZWANZIG
Kapitel NEUNUNDZWANZIG
Kapitel DREISSIG
Kapitel EINUNDDREISSIG
Kapitel ZWEIUNDDREISSIG
Kapitel DREIUNDDREISSIG
Kapitel VIERUNDDREISSIG
Kapitel FÜNFUNDDREISSIG
Kapitel SECHSUNDDREISSIG
Kapitel SIEBENUNDDREISSIG
Kapitel ACHTUNDDREISSIG
Kapitel NEUNUNDDREISSIG
Kapitel VIERZIG
Kapitel EINUNDVIERZIG
Kapitel ZWEIUNDVIERZIG
Kapitel DREIUNDVIERZIG
Kapitel VIERUNDVIERTZIG
Kapitel FÜNFUNDVIERZIG
Kapitel SECHSUNDVIERZIG
Kapitel SIEBENUNDVIERZIG
Kapitel ACHTUNDVIERZIG
Kapitel NEUNUNDVIERZIG
Kapitel FÜNZIG
Kapitel EINUNDFÜNFZIG
Kapitel ZWEIUNDFÜNFZIG
Kapitel DREIUNDFÜNFZIG
Kapitel VIERUNDFÜNFZIG
Kapitel FÜNFUNDFÜNFZIG
Kapitel SECHSUNDFÜNFZIG
Kapitel SIEBENUNDFÜNFZIG
Kapitel ACHTUNDFÜNFZIG
Kapitel NEUNUNDFÜNFZIG
Kapitel SECHZIG
Kapitel EINUNDSECHZIG
Kapitel ZWEIUNDSECHZIG
Kapitel DREIUNDSECHZIG
Kapitel VIERUNDSECHZIG
Kapitel FÜNFUNDSECHZIG
Kapitel SECHSUNDSECHZIG
Kapitel SIEBENUNDSECHZIG
Kapitel ACHTUNDSECHZIG
Kapitel NEUNUNDSECHZIG
Kapitel SIEBZIG
Kapitel EINUNDSIEBZIG
EINS
Der Griffel liegt schwer in ihrer Hand. Wie ein störrischer Fremdkörper. Wie etwas, das sich ihr beharrlich widersetzt und nur widerwillig schreibt, was geschrieben werden muss.
Sie beißt sich auf die Lippe.
Was geschrieben werden muss…
Ihr Magen knurrt. Mürrisch versucht sie, den Hunger zu ignorieren und beugt sich etwas tiefer über die Tafel. Vielleicht wird es heute so, wie es sein soll. Mahlend knirscht die weiße Spitze über die schwarze Fläche und hinterlässt eine feine Staubschicht neben unsicher schwankenden Buchstaben.
ZWEI
Eines Tages saß sie da.
Saß einfach da auf der Bank unter der Kastanie, die steil über ihr in die Höhe ragte. Saß da, unter dem schwarzen Riesen, der von oben seine knorrigen Hände nach ihr ausstreckte, groß und schwarz, aus der Erde brechend, umhüllt von spröder Rinde, die aussah wie Kruste auf einer aufgeplatzten Wunde. Die riesige Kastanie beherrschte die kleine Lichtung. Starke, dunkle Äste bildeten eine mächtige Krone. Eigenwillig verbogen, wie aus dem Kopf der Medusa, wanden sie sich aus dem Stamm heraus, verjüngten sich zu ihrem Ende hin, wurden dünner und kürzer und wirrer. Alles duckte sich unter ihm hinweg.
Solide und auf dunklen, eisernen Füßen machte sich eine Bank vor ihm breit. Das blasse Holz der Bank hob sich vom dunklen Stamm der Kastanie deutlich ab. Zuflucht und Geborgenheit versprach sie, wie sie so dort stand, im Schutz des dunklen Riesen, der sich breit über ihr erhob.
Ein Holzzaun schlängelte sich hinter der Kastanie entlang. Er wirkte alt und schwach. Altes, verwittertes Holz, das ohne eigentliche Bestimmung nur noch vor sich hin stand; den Jahreszeiten ausgeliefert und vergessen. Der klapprige Zaun stieß an seinem Ende mit einer blattlosen Hecke zusammen, die seinen Zusammenbruch mühsam aufzuhalten schien. Und wie der alte Zaun sich so bedürftig und wie zum Trost an die struppige Hecke schmiegte, da wurde mir eng ums Herz.
Der Tag war trüb, der Himmel grau und wolkenverhangen. Überhaupt nicht einladend. Die einsame Lichtung wirkte fast unfreundlich unter diesen Wetterbedingungen. Es war kühl und etwas windig.
Und doch saß dort jemand.
Saß da in einer ganz sonderbaren Art und Weise.
Die Frau kam mir irgendwie bekannt vor, auch wenn mir die Erinnerung an den Anlass gerade abhandengekommen war, wo und wann ich sie schon einmal gesehen hatte. Sicher war ich mir aber, dass es irgendwo im Dorf gewesen sein musste.
Auf den Knien der Frau, die sich genau auf diese Bank, unter diesen Baum, vor diesen Zaun, neben diese Hecke gesetzt hatte, lag ein Buch. Ihre Hände lagen schwer darauf, strichen unbeholfen über den Umschlag, so als ob sie zögerten, das Buch endlich zu öffnen, so als ob es das Schwerste auf der Welt wäre, den Buchdeckel anzuheben und die erste Seite aufzuschlagen. Und genau das war es, was mich in diesem Moment in den Bann dieser Szenerie zog, geradezu magisch anzog.
Ich wusste plötzlich mit tiefer Gewissheit, dass ich jetzt gerade, in diesem Augenblick, einen dieser besonderen Momente erlebte, von denen man manchmal in Büchern liest und sich dabei fragt, wie sie sich wohl anfühlen mögen.
Warum zögerte sie?
Was war mit diesem Buch?
Wieso saß sie an so einem Tag hier draußen?
Und dann plötzlich war die Antwort da, ohne dass ich es genau wissen konnte. Mein Blick erfasste die ganze Szenerie: Sie braucht die Bank, die mit eisernen Füßen auf der Erde steht und dem Riesen trotzt, der sich gewaltig über ihr erhebt. Ihrer eigenen Gebrechlichkeit zum Trotz, geben der klapprige Zaun und die struppige Hecke der Lichtung einen Anfang und ein Ende, rahmen sie ein und begrenzen sie wie zu ihrem Schutz. Natürlich hatte sie diesen Ort gewählt.
Unbeirrt blickte die Frau auf ihre Hände, auf das Buch in ihrem Schoß. Ihre Unsicherheit war selbst auf die Entfernung hin so deutlich zu spüren. Dann, unvermittelt machte sich Aufregung in mir breit, bewegten sich ihre Hände und sie hob den Buchdeckel an. Ich freute mich darüber. Aber nicht lange.
Überraschend laut unterbrach das störende Geräusch von brechenden, trockenen Zweigen jäh die Stille des Moments. Wo kam denn plötzlich dieser Lärm her?
Ich blickte mich um. Da war niemand. Niemand außer mir. Verflixt. Der Lärm kam von unten. Von unter meinen Schuhen. Ich versuchte, den krachenden Zweigen auszuweichen. Ein staksender Storch. Einer, der Krach verbreitete, obwohl seine dünnen Stelzen dazu eigentlich gar nicht in der Lage sein dürften. Wie laut konnten Zweige brechen…? Verdammt…
Auch die Frau auf der Bank war durch das laute Knacken aus ihren Überlegungen gerissen worden. Als sie aufblickte, trafen sich unsere Blicke und ich grüßte sie im Vorbeilaufen mit einem freundlichen und entschuldigenden Nicken. Sie erwiderte meinen Gruß mit einer leichten Kopfbewegung und senkte sie den Blick dann langsam wieder auf ihr Buch.
Als Kastanie und Bank hinter mir lagen, zeigte mir mein Atem ziemlich deutlich, dass mein Laufrhythmus völlig durcheinandergekommen war. Ich zwang mich zu immer kürzeren Schritten und schließlich trottete ich ganz langsam nach Hause.
In den nächsten Tagen führte mich meine Laufrunde immer fast automatisch zu der kleinen Lichtung. Die Frau ging mir nicht aus dem Kopf, wie sie so da gesessen hatte… so verlassen.
Da war die Bank… allein und einsam vor der Kastanie.
Und es war fast so, als ob wir alle auf ihre Rückkehr warteten…
DREI
Der schmale, braune Holzrahmen der kleinen Schiefertafel ist schon ziemlich abgegriffen. Als man ihr die Tafel gegeben hat, ist sie schon längst nicht mehr neu gewesen und nach ihr wird sicher auch wieder jemand darauf schreiben müssen.
An manchen Stellen hat das Holz noch etwas von seiner ursprünglichen Politur. Diese spiegelnden Inseln schimmern in dem ansonsten stumpf gewordenen Rahmen und fühlen sich glatt an. Schön, so als ob man Glanz fühlen kann, denkt sie, wenn ihre Finger darüberstreichen. In dieses freundlich und warm anmutende Holz eingebettet, liegt ein dunkler See von schwarzem Schiefer, der stumpf und kalt auf Buchstaben und Zahlen von ihr wartet.
Manchmal stellt sie sich vor, wie sie in die Schwärze, in die schwarze Tiefe, hineingezogen wird. Und sie friert, wenn ihre Hand zum Schreiben auf dem kalten Schiefer aufliegt. Dann fühlt sie, dass die Schwärze in ihren Arm kriecht, sich bis in ihre Fingerspitzen ausbreitet und ihre Hände und Finger werden steif und ungelenk. Die Zahlen und Buchstaben schwanken beim Schreiben ganz seltsam und es entsteht ein richtiges Durcheinander und es ist einfach gar nicht gut. Dann nimmt sie den kleinen, feuchten Schwamm, der an einer geflochtenen Schnur von der Tafelseite hängt und wischt alles wieder weg; und der Schiefer wird noch schwärzer. Sie beginnt von vorne, beißt sich auf die Lippen, wischt weg, wischt eine Träne weg, versucht es erneut. So lange, bis die Zeilen nach einer unendlich langen Zeit auf der einen Seite mit Buchstaben, auf der Rückseite mit Zahlen beschrieben sind.
Ewig hat es heute wieder gedauert, aber nun ist es so gut wie es eben gut sein kann.
Erleichtert schiebt sie die Tafel in die alte abgegriffene Lederhülle; ganz vorsichtig, so dass bloß nichts verwischt.
Und als ob sie sich mit ihr darüber freuen, schlenkern Schwamm und Griffel an ihren Bändern ausgelassen umher. Sie lächelt nachsichtig, fängt beides geschickt mit den Händen ein und stopft dann alles in ihren schmalen Lederranzen.
Wenn man sie in Ruhe lässt und sie genügend Zeit hat, dann geht es am Ende irgendwie, auch wenn sie immer lange braucht; länger als die anderen in ihrer Klasse.
VIER
Meine Laufstrecke endete an der Kastanie.
Jede Laufrunde endete dort, seit ich die Frau auf der Bank gesehen hatte. Es war ein wenig so, als ob die Lichtung nach mir rief und ich folgte. Auf der Bank legte ich dann eine kurze Pause ein und trottete anschließend mit schmerzenden Gliedern nach Hause. Einige Tage lang ging das so, ohne, dass ich die Frau wiedergesehen hatte.
An diesem Nachmittag hatte ich mir mit der Rast auf der Bank ein wenig mehr Zeit gelassen. Irgendwie war mir nach Bleiben gewesen.
Die Augen in die Krone des Riesen gerichtet, beobachtete ich die Wolken über mir, wie sie über den blauen Himmel hinwegzogen, durchbrochen von verwinkelten Ästen und einigen verwaschenen Herbstblättern, die sich mühsam an dünnen Zweigen festzuklammern schienen. Erschöpft hatte ich mich auf die alte Bank fallen lassen; mit ausgestreckten Beinen und hängenden Armen, tief hineingesunken in das geschwungene Holz, wohlig schwer mit zurückgelegtem Kopf. Über mir hörte ich das trockene Rascheln der alten Kastanienblätter; der Wind rüttelte sanft an ihnen.
Wenn mein Atem langsam zur Ruhe kam und sich mein ganzer Körper diesem herrlichen Schwebezustand hingab, wenn das Pochen meines Herzens sich aus den Adern zurückzog und meine Sinne geschärft in innerer Stille alles umher klar und rein wahrnahmen, war das der wunderbarste Moment.
Kleine Meisen hüpften, zwitscherten und raschelten in der nahen Hecke und in der Ferne war das leise Rauschen von Autos auf einer vielbefahrenen Landstraße zu hören. Wie ein ständiges Summen, wie ein Geräusch, das an diesem Ort ganz deutlich wahrzunehmen war, obwohl es nicht hierhergehörte.
Das Holz der Bank roch nach getrockneter Feuchtigkeit, nach dem ständigen Wechsel von nass zu trocken, von lange nass zu lange trocken, von tropfnass zu staubtrocken.
Es fühlte sich wunderbar an… dieses bleiche, spröde Holz, dessen eigentliche Struktur erst durch die ständig wechselnde Witterung fühlbar geworden war. Meine Finger berührten die raue Oberfläche, folgten den sanften Rillen, die sich - für die Augen nahezu unsichtbar - fächerartig wölbten, Naht an Naht einander folgten, kleiner und unbedeutender wurden und sich schließlich im Nichts verloren.
Die Eindrücke der sichtbaren Welt hatte ich nun, fast automatisch, mit geschlossenen Augen völlig ausgeblendet. Der Erkundung von Holz und Struktur meine volle Aufmerksamkeit schenkend, hörte ich plötzlich das Knacken von Zweigen.
Ich zuckte erschrocken zusammen und öffnete die Augen.
Die Helligkeit blendete mich zuerst… dann aber nahm ich Kontur und Figur wahr und vor mir stand nun die Frau, auf deren Anblick ich seit Tagen wartete und mit dem ich gerade jetzt natürlich nicht gerechnet hatte.
Ich blinzelte.
»Ich möchte Sie gar nicht stören.«, sagte sie mit leiser Stimme und war schon im Begriff, wieder zu gehen.
»Nein, nein…«, stotterte ich.
Von der jähen Rückkehr aus meinem Dämmerzustand fühlte ich mich noch ganz benommen und Worte wollten einfach so aus mir heraus purzeln.
»Ich… Sie… ähm… Sie stören nicht…«, stolperten weitere Worte unsortiert aus mir und schafften es noch immer nicht, einen vernünftigen Satz zu bilden. Neuer Versuch.
»Bitte, bitte, setzen Sie sich.«, beeilte ich mich zu sagen. Na bitte, jetzt konnte ich wieder mit Worte Sätze bilden.
Während ich sprach, rückte ich ein wenig näher in Richtung Armlehne und wischte dann über die Sitzfläche neben mir. Es war eine überflüssige Aktion. Es gab dort gar nichts zu Wischen. Sie aber verstand die Geste, lächelte ein scheues Lächeln, zögerte noch einen kurzen Augenblick. Dann setzte sie sich und legte die Hände in den Schoß.
»Wo ist denn Ihr Buch…?«, entfuhr es mir wie von selbst, noch bevor ich mir die Hand vor den Mund schlagen konnte. Super, das war ja richtig gut, unser Gespräch genau damit anzufangen. Gedanklich schlug ich mir mit der flachen Hand an die Stirn.
Wie zu erwarten, zuckte sie merklich zusammen. Ein wenig wie ertappt. Dann erst schien sie mich zu erkennen.
»Ach, Sie sind das…«, sagte sie und wirkte plötzlich ganz erleichtert.
Sie erinnerte sich also an unsere flüchtige Begegnung. Darüber freute ich mich ein wenig und lächelte sie an.
Aufmerksam sah sie mich an.
An meinen Laufschuhen blieb ihr Blick hängen.
»Sie kommen hier wohl öfter lang?«
»Ja, mittlerweile ziemlich regelmäßig…«, erwiderte ich nun behutsamer. So behutsam, als würde ich sie allein durch den Klang meiner Stimme verschrecken können; wie ein scheues Reh, das sich ohne Deckung auf die Lichtung gewagt hatte.
»Es ist so schön hier…«, sagte sie schlicht und ließ ihren Blick schweifen.
»Ich bin gern hier draußen.«
Während sie das sagte, rieb sie sich nachdenklich ihre Finger. Mein Blick fiel auf ihre Hände. Reife Hände. Diese Hände gehörten einem Menschen, dessen Leben von körperlicher Arbeit geprägt war. Ihre Hände waren nicht schön im klassischen Sinn. Sie waren nicht feingliedrig, nicht grazil, nicht die Hände einer Pianistin oder einer Ärztin. Die Hände, die da so unschlüssig und unsicher auf ihren Knien ruhten, wirkten grob und stark und gleichzeitig zart. In diesem Gegensatz drückten sie eine Zerbrechlichkeit und Verwundbarkeit aus, die mir selbst bei Kinderhänden noch nicht aufgefallen war.
Ihre Finger waren dicklich und schmucklos, bis auf den einfachen goldenen Ring am rechten Ringfinger. Dieser Ring sah nicht so aus, als würde er sich ohne weiteres von dort entfernen lassen. Wahrscheinlich hatte sie ihn noch nie abgelegt, war ich mir sicher. Saubere, praktisch kurz geschnittene Fingernägel. Diese Hände waren kraftvoll und ganz bestimmt waren sie harte Arbeit gewohnt. Das waren nicht die alten Hände eines alten Menschen. Sie wirkten zupackend und furchtlos.
»Wissen Sie…«, seufzte sie, als sie meinen Blick bemerkte.
»Meine Hände tun mir oft weh… sie sind in den letzten Jahren ganz unförmig geworden… und dick… und… es sind jetzt eher Pranken.«
Fast entschuldigend hob sie die Hände, senkte sie dann wieder und sah dann irgendwie traurig an sich herunter.
»Aber das ist eben der Lauf der Dinge, nicht wahr?«
Ihr nunmehr völlig zugewandt sah ich sie aufmerksam an. Über ihre Augen hatte sich ein feiner Schleier gelegt. Es schien mir, als ob ihre Gedanken gerade an einem fernen, unzugänglichen Ort festgezurrt waren.
Sie sah mich an, aber ihr Blick verlor sich, ging durch mich hindurch.
»Ich finde Ihre Hände wunderbar!«
Das war nun wieder einfach aus mir herausgeplatzt. Ich musste wirklich damit aufhören, schalt ich mich still. Was war nur mit mir los?
»Nein, wirklich!«, sagte ich hastig und freundlich und sah sie dabei direkt an.
Ihr Blick wurde wieder klar.
»Hände erzählen viel über einen Menschen, finde ich… Also, Ihre Hände sagen mir, dass Sie sicher keine Angst vor Arbeit haben… Ihre Hände sind fleißige Hände… darauf kann man sich bestimmt verlassen.«
»Das Buch…«, sagte sie leise.
Sie sah aus, als ob sie gerade ein innerer Kampf gefangen hielt. Mein Herz krampfte sich zusammen.
»Das Buch ist wieder im Regal… Ich habe es zurückgestellt. Ich glaube… das ist doch nichts für mich… ich...«
Sie verstummte mitten im Satz.
Wir hatten uns gerade erst kennengelernt. Ich wusste gar nichts über sie, sie wusste gar nichts über mich. Fragend sah ich sie an. Ich spürte, dass sie zögerte, spürte die Grenze und den Abgrund dahinter und ich hatte plötzlich Angst, dass sie es nicht tun würde, dass sie sich in den Schutz einer schnellen Erklärung flüchten würde und wir Fremde bleiben würden.
Dann, ein wenig trotzig wie die kleine Bank, auf der wir saßen, blickte sie mir in die Augen und begann, zu erzählen.
FÜNF
Eigentlich ist der Schulweg ganz schön. Von der Haustür drei Stufen hinunter auf den gepflasterten Hof springen. Tief die Morgenluft einatmen, die um diese Zeit immer etwas nach Friedhof riecht. Feuchte Erde vermischt mit dem Geruch der riesigen Lebensbäume, die am Rande des Grundstückes stehen. Diese Kombination ergibt einen ganz besonderen Geruch; würzig und frisch. Unverwechselbar.
Die Morgensonne steht noch tief. Alles ist in das erste, goldrote Licht des neuen Tages getaucht. Ihre Finger streifen an den weichen Zweigen entlang. Der Morgentau benetzt ihre Hände. Sie fühlt sich frisch und frei und stark in diesem Moment. Es gibt immer wieder solche kleinen Augenblicke. Momente, in denen das Leben sich ihr freundlich zuwendet und ihr das Gefühl gibt, dass es schön ist, am Leben zu sein.
Sehr oft aber hat sie das dumpfe Gefühl, dass es zu schwer ist und irgendwie immer schwer sein wird. Besonders, wenn es um die Schule geht. Lesen und Schreiben haben ihr von Anfang an Probleme bereitet. Sie will ja so gerne richtig, und vor allem schön, schreiben, aber ihre Hände wollen einfach nicht gehorchen. Sie wollen nicht zart sein, wollen nicht fein schreiben und schöne geschwungene Linien, Bögen und Kreise wollen sie auch nicht malen.
Wenn sie sich, mit der Zunge zwischen Zähnen und Lippen, über ihre Tafel beugt, dann ist die Anstrengung oft so groß, dass ihre Hände nach kurzer Zeit so schwer werden und so starr und dann ist es noch schwerer, schöne Buchstaben und Wörter zu malen. Und jedes Mal gelingt es nicht gut. Die Buchstaben werden krakelig, die Wörter schwanken von links nach rechts und von rechts nach links.
Und jedes Mal gibt es Ärger deswegen. Obwohl sie sich so angestrengt hat. So ganz genau versteht sie auch nicht, warum das alles denn so wichtig ist. Bei der Arbeit auf dem Feld und im Stall hilft das gar nicht weiter.
Plötzlich spürt sie wie ihr Kopf ruckartig nach hinten gezogen wird. Nicht schon wieder.
Seit dem Beginn der Schulstunde ziehen die drei Jungs in der Reihe hinter ihr an ihren blonden Zöpfen. Immer wieder.
Und sie werfen kleine Papierkügelchen, die in ihren Flechten stecken bleiben, was irgendwie alle so lustig finden, dass der Lehrer schließlich auf sie aufmerksam wird. Strafend starrt er sie an. Nur sie. Drohend richtet er den Zeigestock auf sie. Nur auf sie.
Doch die Jungs hören nicht auf.
Sie hören nie auf.
Sie ziehen und werfen und feixen.
Mehrmals hat sie sich zu ihnen umgedreht. Hat ihnen die Faust entgegengereckt und ihnen mit funkelnden Augen wortlos zu verstehen gegeben, dass sie sie endlich in Ruhe lassen sollen. Aber das hat irgendwie dafür gesorgt, dass jetzt alles noch schlimmer ist und sie gar nicht mehr ruhig sitzen kann, denn das Ziehen an den Zöpfen hört einfach gar nicht mehr auf.
Und da hat sie es nicht mehr aushalten können, ist aufgesprungen, hat die Jungs angeschrien und deren Sachen wütend von der Bank gewischt. Stifte und Bücher liegen nun auf dem Boden verteilt. Und deshalb steht sie nun vorne am Lehrerpult. Vor der ganzen Klasse.
Und deshalb zischt der Zeigestock hinunter auf ihre ausgestreckten Hände.
Klatsch.
Zisch.
Klatsch.
Den scharfen Schmerz kennt sie schon, der geht durch und durch. Und wenn man es wagt, die Hände wegzuziehen, dann dauert es noch länger und es werden noch mehr Hiebe.
Sie beißt die Zähne zusammen und zwingt sich, die Hände nicht zu bewegen.
Zisch.
Ein Mädchen zu sein, ist schlimm, denkt sie.
Klatsch.
Schlimmer, als ein Junge zu sein. Jungs.. die benehmen sich wie sie wollen, sie prügeln sich, wehren sich. Das ist irgendwie normal und niemand wundert sich, wenn die miteinander raufen.
Zisch.
In ihren Augen sammeln sich Tränen. Sie hofft inständig, dass sie sich dort noch halten können; dass sie nicht fallen. Sie konzentriert sich ganz fest darauf.
Klatsch.
Dabei sind es nicht einmal die Schmerzen, die sie zum Weinen bringen. Es ist vielmehr diese ständige Ungerechtigkeit. Das ist das Schlimmste.
Und außerdem will sie nicht vor der Klasse weinen. Das ist Schwäche, findet sie, und diese Schwäche soll niemand sehen.
Der nächste Schlag bleibt aus.
Der Lehrer lässt den Zeigestock endlich sinken, und die Klasse atmet hörbar auf. In den Gesichtern spiegeln sich Anteilnahme und Mitleid und auch so etwas wie Bewunderung.
Und die drei Jungs feixen.
Ihre Augen funkeln wütend unter Tränen.
Die blonden Flechten sind zerzaust. Papierkügelchen haben sich darin verfangen. Sie kann sich vorstellen, wie sie gerade aussieht.
Wortlos streckt der Lehrer seinen Arm aus und zeigt unerbittlich in eine Ecke des Klassenraums. Wortlos ballt sie ihre Hände zu schmerzenden Fäusten, geht langsam in die Ecke neben der Tafel, stellt sich dort mit dem Rücken zur Klasse und starrt die kahle Wand an.
Ihre Tränen kullern lautlos über ihre Wangen. Niemand sieht es. Sie schluchzt nicht beim Weinen, niemand soll mitbekommen, dass sie weint. Sie steht einfach nur dort an der Wand, ihre Tränen fallen still aus ihren Augen und sie wartet.
Als die Schulglocke eine Ewigkeit später läutet, darf sie endlich zurück zu ihrer Bank. Langsam und mit gesenktem Kopf packt sie langsam ihre Sachen in ihren Schulranzen.
Die Tränen auf ihren Wangen sind längst in salzigen Bahnen getrocknet. Ihre Handflächen brennen schmerzhaft. Vom Unterricht hat sie so gut wie nichts mitbekommen. Es war schon schwierig genug, einfach nur nicht zu schluchzen, einfach nur zu versuchen, in der Ecke für alle irgendwie unsichtbar zu werden. Sie hat nicht mitbekommen, was sie für morgen schreiben soll und üben konnte sie während des Unterrichts auch nicht.
Mit hängendem Kopf verlässt sie als Letzte den Klassenraum. So traurig und niedergeschlagen fühlt sie sich; so schwer und verletzt.
Der Lehrer wollte sich nicht einmal ihre Tafel ansehen.
Alles umsonst geschrieben und gerechnet.
Alles umsonst.
Und auf dem Schulhof ist auch schon niemand mehr.
Die Anderen sind längst auf dem Heimweg. Niemand hat auf sie gewartet. So ist es immer, wenn es Schläge gegeben hat. Nur nicht bei den Jungs, die feiern sich, als ob das eine Leistung wäre, sich schlagen zu lassen.
Bei ihr ist es anders.
Bei Mädchen ist es anders.
Es gibt keinen Trost.
Die Anderen wissen einfach nicht, was sie sagen sollen, wie sie damit umgehen sollen. Das Gnädigste ist irgendwie noch, dass danach niemand mehr in der Nähe ist.
Sie wird das allein mit sich ausmachen.
Den braunen Lederranzen über die Schultern geworfen, läuft sie los. Aus dem Laufen wird irgendwann ein Rennen und als sie schließlich an der Lichtung ankommt, lässt sie ihn ins Gras fallen und wirft sich auf die Bank.
Und endlich kann sie richtig weinen.
Aus dem verzweifelten Weinen wird ein bitterliches Schluchzen, von dem nur die Kastanie etwas mitbekommt, die hinter der Bank mitleidig schweigt.
SECHS
Groß gewachsen war sie, nicht dünn, ohne dick zu sein. Insgesamt wirkte sie kompakt und stabil. Dennoch war diese Frau so unscheinbar, dass sie sicher leicht in einer Menschenmenge unterging. Sie war so unauffällig, dass die meisten Menschen sicher schnell wieder vergessen hatten, sie überhaupt gesehen zu haben. Auch ich vermochte mich nicht zu erinnern, woher ich sie kannte.
Ein wunderlicher Mensch, dachte ich, während ich ihr so zuhörte. Alles an ihr war unscheinbar, regelrecht unsichtbar. Silbergraue Strähnen schimmerten durch ihre kurzen, leicht gewellten, dunkelblonden Haare, die sie auf eine eigenwillig unaufgeregt praktische Art zurechtgebürstet hatte. Blassblaue Augen blickten vorsichtig und seltsam trotzig; umrahmt von einer schlichten, goldfarbenen Brille.
Ihre Hände lagen mit ineinander gefalteten und aneinander gepressten Fingern in ihrem Schoß, so als ob sie sich gegenseitig und dadurch den ganzen Menschen halten müssten. Es hatte etwas so Anrührendes. Wirkte fast hilflos. Mir schnürte es plötzlich die Kehle zu und ich musste schwer schlucken. Chance und Scheitern, diese Hände.
Es schien, als ob sie auf ihr Äußeres keinen besonderen Wert legte. Ja, sie wirkte geradezu uneitel. In eigenwilligem Kontrast zu diesem Eindruck stand die rote Fleece-Jacke, die sie trug. Signalrot und geschlossen bis zum hochgestellten Stehkragen schien sie ihr Schutz zu bieten und die ganze Frau irgendwie aufzurichten.
Wie ein wehrloses Tier, dachte ich plötzlich. Wie ein Tier, das sich auf die warnende, leuchtende Signalfarbe verlässt, die es schützend umgibt. Hoffend, dass niemand zu nah an es herankommt.
Zu der schlichten, dunkelblauen Hose mit Bügelfalte trug sie einfache dunkle Halbschuhe. Unsichtbar.
Wie alt mochte sie sein? Das war schwer zu schätzen. Sie konnte genauso gut Anfang Sechzig wie Ende Sechzig sein.
Diesen unzusammenhängenden Gedanken war ich gefolgt, während ich ihrer Geschichte gelauscht hatte.
Dabei war mein Blick mehr und mehr über sie hinweg geglitten und über die hügelige Landschaft gewandert, die wie ein blasser Flickenteppich vor uns lag, und auf den die Sonne im Duell mit den Wolken immer wieder kurze Lichtpunkte warf. Die Wolken waren weiß und dick; zogen langsam und beständig am Himmel entlang.
Die Krone des Kastanienbaumes hatte sich in den vergangenen Tagen verändert. Seine Äste hatten ihre harte Kontur etwas verloren. Ich konnte die ersten grünen Ansätze von Blättern sehen, die winzig und verloren auf die dunklen Äste getupft schienen.
Der Riese sah auf uns herab.
Es wirkte irgendwie aufmunternd.
Und eigenartig; ich fühlte mich plötzlich im Zentrum seines Blickes gefangen und auf seltsame Weise geborgen. Wenn er mir in diesem Moment mit einem seiner Zweige eine Haarsträhne aus der Stirn gestrichen hätte, wäre ich kaum erstaunt gewesen.
Inzwischen war sie langsam aufgestanden und wischte nun mit den Händen umständlich über ihre Hosenbeine. Auch ich erhob mich langsam und wir standen uns für einen kurzen Moment unschlüssig gegenüber.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte sie und lächelte ihr scheues Lächeln.
Sie streckte mir die Hand hin.
»Es war schön, dass Sie mir zugehört haben. Das hat gut getan. Ich hoffe, wir sehen uns wieder!«
SIEBEN
Nachdenklich betrachtet sie ihre Hände.
Rote Streifen ziehen sich schmerzhaft über die Innenflächen der Finger. Wenn sie die Hände schließt, sieht man von außen gar nichts. Es tut einfach nur weh. Sie schließt sie, öffnet sie.
Unsichtbar,
sichtbar,
unsichtbar.
Sichtbar. Sie ist so wütend darüber, dass nur sie bestraft worden ist. Warum nicht die Jungs? Und eigentlich hätten nur die Jungs bestraft werden müssen, wenn überhaupt jemand dafür Schläge verdient hat, denkt sie wütend. Nichts von dem, was passiert ist, wäre passiert, wenn sie sie nicht immer weiter und immer weiter geärgert hätten. Warum haben sie nicht aufgehört. Warum geht kaum jemand einmal einer Sache wirklich auf den Grund? Und warum ist alles so ungerecht?
Für die Jungs ist alles immer nur ein Spaß. Keiner von ihnen hat auch nur versucht, es dem Lehrer zu erklären. Warum wohl auch, denkt sie dann bitter. Am Ende hätten sie alle mit zerschlagenen Händen neben der Tafel in der Ecke stehen müssen. Das wäre dann der Teil gewesen, der für die Jungs auch nicht lustig gewesen wäre. War ja alles nur Spaß…
Plötzlich muss sie an ihren Hund denken. Der liegt friedlich zu Hause im Hof.
Tock…
Ein Stein.
Tock…
Kleine Steine.
Tock…
Jemand wirft mit Steinen nach ihm. Nur so aus Spaß.
Tock…
Nicht einmal große Steine.
Tock…
Immer wieder ein Steinchen.
Tock…
Ein Stein.
Bellen würde er, schnappen und irgendwann bestimmt zubeißen.
Sie ballt die Hände zu schmerzenden Fäusten. Und am Ende bestraft man den Hund, denkt sie dann mit trauriger Gewissheit.
Niemand würde nach dem Grund fragen. Ist ja nur ein Hund. Ich bin ja nur ein Mädchen.
Und vielleicht würde es ihn das Leben kosten.
ACHT
Klein und verhutzelt schmiegte sich mein neues Zuhause an die Hauptstraße des Dorfes. Es wirkte irgendwie schief und krumm und wie aus der Zeit gefallen. Auf sympathische Art und Weise.
Eigentlich jeder, der ins Dorf rein oder aus dem Dorf raus wollte, fuhr auf dieser Straße. Autos, Traktoren, große landwirtschaftliche Maschinen tuckerten, klapperten, rumpelten an meinem Haus vorbei. Überrascht hatte ich festgestellt, dass ich irgendwann, wie von selbst, damit begonnen hatte, die Geräusche den entsprechenden Fahrzeugen zuzuordnen. Akustik-Memory.
So richtig war mir nicht klar gewesen, worauf ich mich mit dem Kauf des Hauses eingelassen hatte. Ich hatte mich einfach einmal ganz auf meine Intuition, auf mein Gefühl verlassen wollen. Und mein Gefühl war, dass es sich in dem kleinen Dörfchen ganz beschaulich leben lassen würde. Dass die Uhren hier irgendwie langsamer tickten und die Menschen friedlicher und freundlicher sein würden.
Im Großen und Ganzen stimmte das auch.
Das Dorf mit seinen Bewohnern hatte mich schnell als ein neues Mitglied der Dorfgemeinschaft wahrgenommen und sich um mich bemüht. In den ersten Tagen klingelte es hin und wieder an meiner Tür und ich lernte meine Nachbarn und ihre Back- und Kochkünste kennen. Ich öffnete mein noch chaotisches neues Zuhause mir im Grunde wildfremden Menschen, zu denen ich, allein durch die Tatsache, dass ich nun mit ihnen in diesem Dorf wohnte, plötzlich gehörte.
Das Haus, das ich seit kurzem mein Eigen nannte, hatte mich vom ersten Augenblick an in seinen Bann gezogen. Vielleicht, weil es so verlassen ausgesehen hatte. Es war alt und man sah es ihm an. Irgendwie wirkte es auf mich so, als wolle es nicht allein sein, nicht mehr alleine stehen. Als sehne es sich nach Menschen, nach Leben und einer neuen Bestimmung. Nach mir.
Mit sanften, sandsteinumrahmten Augen blickte es aus kleinen, ehemals weiß lackierten Holzfenstern versonnen auf die Straße, die wie eine dicke Lebensader durch das Dorf führte. Das rote Ziegeldach lag tief auf, so als hätte das Häuschen es sich wie eine wärmende Mütze schützend ins verblasste Gesicht gezogen und sich dazu passend einen warmen Schal aus rotem Sandstein umgeschlungen. Schwer und warm, mit glänzender Patina überzogen, stach eine dunkle Eichentür prominent zwischen zwei Fenstern heraus und wenn ich sie öffnete, wenn sie bedächtig und ruhig den Weg freigab, überkam mich ein überwältigendes Gefühl von satter Schwere, gediegener Beständigkeit und schützender Verlässlichkeit.
Innen verteilten sich sechs Zimmer auf Erdgeschoss und Obergeschoss. Drei oben, drei unten. Niedrige Decken. Schmaler Flur, kleine Zimmer. Unten verfügte es über ein Wohnzimmer, eine Küche und einen Vorratsraum. Die Küche war der größte Raum. Oben befanden sich zwei Schlafzimmer und ein Bad, das, so wie ich es einschätzte, jemand vor geraumer Zeit mit gutem Willen aber eigenwilligem Geschmack renoviert hatte.
Das Erfreulichste, was man wohl über dieses Badezimmer sagen konnte, war, dass es erstaunlich geräumig war. Es verfügte sowohl über eine Dusche, als auch über eine ziemlich große Badewanne. Beim Einbau hatte man sich seinerzeit offenbar wenig Gedanken über den Wasserverbrauch gemacht, war mir spontan durch den Kopf gegangen.
Wahrscheinlicher war aber wohl, dass, wenn die Wanne erst einmal mit warmem Wasser befüllt gewesen war, alle Familienmitglieder gleichzeitig, bzw. schnell nacheinander im gleichen Wasser gebadet hatten. Die am wenigsten schmutzigen Familienmitglieder zuerst. Also die Kinder? Einmal in der Woche vielleicht; überlegte ich, für mehr war sicher keine Zeit gewesen. Für eine solche oder ähnliche Gewohnheit sprach auch der alte Badeofen, der noch immer einen prominenten Platz im Raum einnahm und der ein wenig wie eine hell lackierte Kanone wirkte.
Ein Feuer unten im Badeofen erhitzte das Wasser im Tank darüber und nach einiger Zeit zeigte ein altes rundes Thermometer oben an der Emaille an, wie heiß das Wasser war. Jederzeit über warmes Wasser zu verfügen, war lange keine Selbstverständlichkeit gewesen. Es gab auf diesem Thermometer ganz am Ende der Temperaturskala einen roten Bereich. Die sichtbare Warnung vor zu hohen Temperaturen. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, welche Verwüstung dieser Badeofen in Form einer aufgerichteten Kanone anrichten könnte, wenn sie… nicht auszudenken.
Also, wenn ich auf heißes Wasser aus diesem Badeofen angewiesen wäre, dann würde ich in Zukunft sehr oft sehr kalt duschen müssen. Am wahrscheinlichsten würde ich mich gelegentlich damit in die Luft jagen, versehentlich, dachte ich, wenn ich ihn betrachtete. Aber mein warmes Wasser kam eben mühelos und wie von selbst aus dem Wasserhahn. Ich fühlte Dankbarkeit.
Wer den Blick dann durch den Raum wandern ließ, der sah sich inmitten eines grotesken Farb- und Formenspektakels angekommen. Boden und Wände des Raums erstrahlten in einem wirren, gekachelten Mosaik von Braun- und Grüntönen. Becken, Wanne und Toilette hatte man seinerzeit in einem satten Grün eingebaut. Dunkelbraune Emaille-Armaturen machten den Farbwahnsinn komplett. Eine unfassbare Zusammenstellung.





























