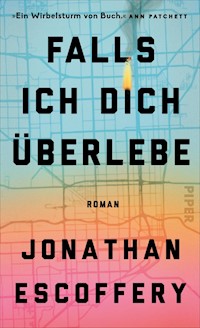
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn leben heißt, der Welt zu trotzen Selbst innerhalb seiner Familie ist Trelawny ein Außenseiter. Als Einziger ist er in Miami geboren. Seine Eltern, Topper und Sanya, sowie sein Bruder Delano sind vor der Gewalt auf Jamaica hierher geflohen. Die Vereinigten Staaten sind für sie nie wirklich ein Zuhause geworden. Sie alle kämpfen darum, irgendwie einen Fuß auf den Boden zu bekommen – gegen Ausgrenzung und Armut, gegen Heimatlosigkeit und Rassismus. Und insgeheim weiß Trelawny, wenn überhaupt, hat nur er die Chance auf ein besseres Leben. Auf ein Leben in einer Gesellschaft, die es ihm und seiner Familie unendlich schwer macht. »Dies ist ein fesselnder Wirbelsturm von einem Buch, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem unentwirrbaren Knoten verwebt. Hier beginnt Jonathan Escofferys Karriere. Seinem Schaffen sind keine Grenzen gesetzt.« Ann Patchett
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch und dem Patwah von Henning Ahrens
© Jonathan Escoffery 2022
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»If I survive you«, MCD, New York 2022
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von FSG / Macmillan Publishers
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Im Fluss
Unter der Akee
Gelegenheitsjobs
Pestilenz
Splashdown
Eigenständiges Leben
Würde Delano ahnen, dass er an diesem Vormittag den Tod eines Menschen verschuldet, dann würde er sich niemals vom Sofa erheben
Falls ich dich überlebe
Danksagung
Notiz des Übersetzers
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Mom, Dad und Jason
Im Fluss
Am Anfang steht die Frage Was bist du?, sie ertönt außerhalb eures Vorgartens, du warst damals neun – vielleicht jünger. Diese Frage wird dir immer wieder gestellt, auf der Junior High und auf der Highschool, anschließend draußen in der Welt, in Strip-Clubs und Food Courts, am Telefon und bei diversen Aushilfsjobs. Man fragt fordernd. Verlangt eine sofortige Antwort. Die Frage bringt dich auf deinen präpubertären Füßen ins Wanken, einerseits, weil du sie nicht begreifst, andererseits, weil du selbst dann keine Antwort hättest, wenn du sie begreifen würdest.
Oder steht Welche Sprache spricht deine Mutter? am Anfang? Gut möglich, dass diese Frage der Ursprung ist. Nicht weil es die erste wäre, die man dir stellt, sondern weil du wenigstens ansatzweise auf sie gefasst bist.
Diese Frage nervt dich sofort.
»Wieso redet deine Mutter so komisch?«, will euer Nachbar wissen.
Deine Mutter ruft von der Veranda, sie hat dich von diesem Ausguck mit Blick auf den abschüssigen Vorgarten gerufen, seit dir erlaubt wurde, mit den Nachbarskindern zu spielen. Sie ruft dich, weil du reinkommen sollst, nur findest du dieses Ritual inzwischen peinlich.
Vielleicht hast du gehofft, niemand würde es bemerken. Vielleicht hast du es selbst nie bemerkt. Vielleicht entgegnest du lahm: »Wie meinen Sie das: ›Welche Sprache‹?« Vielleicht denkst du das auch nur. Am Ende murmelst du: »Englisch. Sie spricht Englisch.« Und dann schleichst du mit gesenktem Kopf ins Haus.
In diesem Moment ist dir deine Mutter zum ersten Mal peinlich, und zugleich schämst du dich, weil du sie nicht verteidigt hast. Du bist feige, hältst nicht zu ihr, aber als Fremder zu gelten, ist noch schlimmer. Wenn du während deiner bisherigen paar Lebensjahre etwas gelernt hast, dann das.
Wir sind in Amerika, und wir schreiben die Achtziger. In der Schule, im Unterricht schwörst du der einzig wahren Fahne die Treue, den Stars and Stripes. Die morgendliche Hymne lautet Greatest Country on Earth. Sie ist ein Mantra, das euch täglich eingetrichtert wird, ein fester Bestandteil des Unterrichts – so unumstößlich, wie zwei plus zwei vier ergibt –, und was sich einprägt, nachdem du die Worte im Stillen oft genug wiederholt hast, ist die unausgesprochene Tatsache, dass alle anderen Nationen weniger wert sind, wenngleich diese anderen Nationen im Unterricht fast nie erwähnt werden.
Du glaubst daran.
Diese Botschaft lässt sich leicht verinnerlichen, nur ist dein Bruder, Delano, sind deine Eltern und fast alle Verwandten Jamaikaner. Als deine Cousine von Kingston nach Miami ins Cutler-Ridge-Viertel zieht, zu dir in die dritte Klasse kommt und den Treueeid auf die Fahne verweigert, gehst du auf Abstand. Im Stillen bist du froh, dass ihr unterschiedliche Nachnamen habt.
Wärst du besser informiert gewesen, als du zum ersten Mal gefragt wurdest, was du bist, dann hättest du sagen können: Amerikaner.
Du wurdest in den Vereinigten Staaten geboren, hast Dokumente, die das beweisen. Auf diese Tatsache, an der niemand rütteln kann, auf diesen in Stein gemeißelten Status, bist du stolz. Am vierten Juli schmetterst du Lee Greenwoods God Bless the U. S. A., und nachdem du in deinem neunten Sommer zwei Wochen auf der Heimatinsel deiner Eltern verbracht hast, singst du es noch inbrünstiger. Du findest das Leben auf der Insel in jeder Hinsicht nervig, auch was den allgemeinen Mangel an Klimaanlagen betrifft. Du magst Burger und Hotdogs lieber als irgendein Zeug mit Curry oder Jerk-Fleisch.
Als ihr wieder zu Hause seid, werfen dir deine Eltern vor, deine Sprechweise, vor allem aber dein Verhalten sei das eines typischen Yankees. Sollten sie unter Yankee einen Amerikaner verstehen, dann würde dich das nicht stören, im Gegenteil. »Ich spreche Englisch«, erwiderst du.
Das Patwah deiner Eltern, von anderen als unverständliches Kauderwelsch empfunden, klingt für dich ganz normal, nur dass es immer öfter mit Ermahnungen gespickt ist. Etwa, wenn deine Mutter auf Patwah meckert: »Auf den Boden kleckern, das könnt ihr, aber nicht aufwischen, wie?«
Und dein Bruder sagt: »Ich war’s nicht, Mummy.«
Und du sagst: »Ich habe das nicht getan, Mom.«
Und darauf sie: »Ja, und wer dann? Muss wohl ein Duppy gewesen sein.«
Der Duppy wird der Sündenbock für alle Ereignisse, die sich nicht erklären lassen, ob drinnen oder draußen. Der Duppy hat die Vase deiner Mutter zerdeppert und danach versucht, die Scherben zu kitten. Der Duppy hat das Zeugnis deines Bruders unter der Matratze versteckt. Der Duppy hat von deinem Vater Besitz ergriffen, er schleift ihn nach Feierabend in Bars und lässt ihn erst am nächsten Morgen heimkehren.
Und weil es schwierig ist, einen Duppy oder Geist, ja selbst einen erwachsenen Mann zur Ordnung zu rufen, müssen dein Bruder und du die Strafen ausbaden.
Als in der Schule das Erdkunde-Projekt angekündigt wird, bei dem jeder ein Land vorstellen soll, suchst du dir die Mongolei aus. Dir dämmert erst, dass Jamaika auch keine üble Wahl gewesen wäre, als sich eine Mitschülerin für die winzige Insel entscheidet.
Das Projekt beinhaltet die Zubereitung eines landestypischen Gerichts. Ihr seid in der vierten Klasse. Eure Mütter übernehmen das Kochen. Als sie sich am Tag der Präsentation versammeln, mit dunklen Ringen unter den Augen, weil sie sich bis spät in die Nacht mit ausländischen Rezepten herumschlagen mussten, fehlt ihnen die Kraft für Nettigkeiten, sie nicken einander nur schwach zu.
Als deine Klassenkameradin mit ihrer Präsentation Jamaikas beginnt, saugt deine Mutter so scharf Luft ein – ein Geräusch, das klingt, als würde man einen ultrastarken Klettverschluss öffnen –, dass einige Eltern zu ihr herumfahren. »Wenn du dich für zu Hause entschieden hättest«, flüstert sie dir zu, »hätte ich Reste mitbringen können.«
Am Career Day steht dein Vater vor der Klasse und stellt sich als Generalunternehmer vor. Oben auf der Tafel hängt ein Alphabet aus ausgeschnitten Großbuchstaben, es wölbt sich über seinen welligen, schwarzen Haaren. Er zieht dreißig Zentimeter seines Maßbands mit dem Daumen heraus und lässt es wieder in die Hülle schnellen. Das Klacken, mit dem es zurückschießt, sichert ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit der Klasse. Dein Vater wiederholt den Vorgang mehrmals, dann macht er endlich den Mund auf. Deine Mitschüler und Mitschülerinnen halten erwartungsvoll den Atem an.
Seine Erklärung, Bäder zu renovieren, Verputz und PVC inklusive, erfolgt in breitestem Patwah, was hinten im Klassenraum für lautes Kichern sorgt. Dein Vater dehnt die Vokale, er spricht das »Th« aus wie ein »D«, seine Wörter sind ebenso eigenwillig wie schlicht, sein Satzbau ist ungewöhnlich.
Deine Lehrerin ermahnt die Klasse, still zu sein, aber während sie deinem Vater lauscht, legt sich ihr Gesicht in erheiterte Falten, sie nickt im Takt des Patwah mit dem Kopf. Du behältst ihre Wangen im Blick, denn die Farbe, die diese annehmen, lässt Rückschlüsse auf das Ausmaß des Desasters zu. Bleibt es bei dem hellen Rosa – ein leichtes Erröten, ein rosiger Hauch, ein Ballettschuh-Ton – ist es halb so wild, dann wird sie die Sache mit der Zeit vergessen. Als ihre Röte zusehends tiefer wird, so tief, dass sie an Violett grenzt, wird dir klar, dass es eine Katastrophe ist.
Du fragst dich, warum du nicht darauf bestanden hast, dass deine Mutter vor die Klasse tritt. Sie kann ihre Aussprache den amerikanischen Hörgewohnheiten besser anpassen, das muss sie täglich bei der Arbeit tun.
Anfang der Woche hast du sie gebeten, etwas mehr über ihren Job als Sekretärin zu erzählen. Deine Mutter sitzt auf der Bettkante und erklärt, sie sei im Büro eines Unternehmens tätig, das Flugzeugturbinen in alle Welt verschiffe. Der Saum ihres Nachthemds schimmert, als sie quer durchs Zimmer springt, um den Globus von deinem Bücherregal zu holen. »Hierhin, siehst du? Und dahin. Und dorthin.« Sie kniet vor deinem Bett, zeigt auf Deutschland, dann auf Brasilien, danach auf die hawaiianische Inselgruppe und singt: »Wir liefern in alle Winkel der Welt«, wobei sie Zeige- und Mittelfinger über Ozeane und sattgrüne Kontinente tanzen lässt, um anschließend gegen deine Nase zu tippen.
»Wir?«, fragst du. »Du fährst ja nicht dorthin, oder?«
Deine Mutter blinzelt zweimal, dann stellt sie den Globus wieder aufs Regal. »Eines Tages«, sagt sie. »Eines Tages, wenn ihr alle groß seid.« Und sie fügt hinzu: »Du solltest deinen Vater bitten, von seiner Arbeit zu erzählen. Sie finden ihn bestimmt spannender als mich.«
Im Geschichtsunterricht der fünften Klasse wird die Gründung der Vereinigten Staaten behandelt. Ihr erfahrt auch etwas über ein Thema, das schlicht Sklaverei genannt wird. Diese wird knapp und verwässert behandelt. Unter dem Strich heißt es: Menschen, die eigentlich herzensgut waren, haben einen schlimmen Fehler begangen. Es heißt: Das ist ewig lange her. Es heißt: Der ehrliche Abe und Harriet Tubman und Martin Luther King haben diese scheußliche Sache geradegebogen. Es heißt: Heute sind alle gleich.
Während dieser Unterrichtsstunde wird deine Klasse von einem Unbehagen erfasst; ihr findet alle, dass es eine schreckliche Sache war. Ihr ahnt dunkel, dass manche Mitschüler und Mitschülerinnen möglicherweise von jenen Menschen abstammen, die diese Schandtaten begangen haben, manche von den Opfern. Und ihr ahnt noch dunkler, dass einige von beiden Gruppen zugleich abstammen. Fühlst du dich von diesem Land, das du so liebst, etwa ungerecht behandelt?
Der transatlantische Sklavenhandel ist für dich nichts Neues, denn dein Vater verdammt das Land deiner Geburt bei jeder Gelegenheit. In seiner Version der Unterrichtsstunde erzählt er dir selbstbewusst: »Darum sind die Schwarzen Menschen so, diese Idioten. Keine zwei Sekunden aus der Sklaverei befreit, und schon müssen sie zivilisiert tun? Ich sage dir, Junge, Weiße sind böse, vergiss das nie.« Sein Vortrag gipfelt in den Worten, in Jamaika sei die Sklaverei Jahrhunderte früher abgeschafft worden als in Amerika, womit er, wie du später herausfindest, Jahrhunderte danebenliegt.
Schwarze beider Nationen, die er für unehrenhaft hält, bezeichnet er mit einem jamaikanischen Wort: Butu. Wenn man etwas anstellt, das ihm zur Schande gereichen könnte, sagt er stets: »Du führst dich manchmal auf wie ein Butu.«
»Was bin ich?«, hast du deine Mutter mehrfach gefragt. Die Frage wurde dir so oft gestellt, dass du begonnen hast, Antworten zu suchen.
Ihre Antwort klingt einstudiert, ist aber nicht so eindeutig wie erhofft. Deine Mutter erläutert, du seiest eine bunte Mischung. Sie zählt Länder auf, mehrere Länder, denen sie Urgroß-Diese und Urgroß-Jene zuordnet. Deine Mutter versieht diese Vorfahren selten mit Namen, du bringst sie also leicht durcheinander. »Unser Nachname kommt aus Italien«, sagt sie, »über England.« Sie zählt überwiegend europäische Länder auf, und obwohl sie Afrika stets hinzufügt, als wäre es ein Nachtrag oder ein einzelnes Land, spricht sie nie von der Hautfarbe.
Du willst eine Antwort, die aus einem Wort besteht.
»Bin ich Schwarz?«, fragst du. Darum geht es dir. Die Frage der Hautfarbe ist in deine Welt eingebrochen, abrupt und gewaltsam, und du befürchtest am meisten, andere könnten etwas in dir sehen, das dir selbst nicht bewusst ist.
Wenn Kinder diese Frage stellen, nimmst du an, ihre beschränkten Kenntnisse seien mangelnder Lebenserfahrung geschuldet. Aber nun wollen auch Erwachsene eine Antwort hören. Manche Lehrer glotzen dich nur an, andere fragen, wie es kommt, dass du so gut Englisch sprichst.
In der Überzeugung, sie könnten zwischen deiner Sprache und deinen Eltern unterscheiden, antwortest du zunächst: »Ich bin Amerikaner.« Diese Antwort verwirrt sie noch tiefer. Später wird dir klar, dass sie etwas ganz anderes meinen, zumal, wenn es sich um Lehrer handelt, die deinen Eltern nie begegnet sind.
»Sind wir Schwarz?«, fragst du deine Mutter.
Sie ist plötzlich fahrig. Sie erschaudert am ganzen Körper, die helle, fleckige Haut erzittert, und sie führt die Genealogie der Familie rasch zu Ende, bis zu den letzten ungesicherten Details. »Die Mutter des Vaters deines Vaters war Jüdin. Die Mutter deiner Großmutter war Irin«, doziert sie. »Der Vater deiner Großmutter«, sie senkt ihre Stimme zum Flüstern, »war angeblich ein Araber.«
Du starrst sie verständnislos an und meinst: »Du hast meine Frage nicht beantwortet.«
In ihrer Aufregung wird sie zornig. »Puh. Eine so dumme Frage habe ich noch nie gehört, seit ich in Amerika bin. Wenn sie dir gestellt wird«, meint sie, »dann sagst du, du bist ein bisschen dies und ein bisschen das.«
Du spürst, ihre Antwort ist endgültig. Und anders als erhofft, hat sie wieder nicht mit einem Wort geantwortet, kein schlichtes Ja oder Nein.
Den wenigen eindeutig Schwarzen Kids auf der Schule bist du ein Rätsel. Sie gehören zu den Ersten, die von dir verlangen, dich zu bekennen. »Bist du Schwarz?«, wollen sie wissen, als würde sich Zugehörigkeit über Hautfarbe definieren.
Deine Haut ist von einem relativ hellen Braun. Bei deinen Eltern ist es genauso. Auch bei ihren Eltern. Deine Urgroßeltern sind auf den Fotos im Familienalbum nur in Schwarz-Weiß oder in Sepiatönen abgebildet, ihre Hautfarbe ist uneindeutig. Manche wirken, als könnten sie bei Die Jeffersons einen Gastauftritt haben, andere, als kämen sie eher für All in the Family infrage. Außerhalb deiner Familie ähneln dir deine engsten Schulfreunde, Jose und Luis, am meisten. Aber wenn sie zwischen Englisch und Spanisch wechseln, fühlst du dich ausgeschlossen. Und wenn sie, eure Lieblingsrocksongs schmetternd, ihre Haare mit ruckartigen Bewegungen vor- und zurückschütteln, wird dir schmerzhaft bewusst, dass du deine Haare nicht schütteln kannst, weil sie sowohl zu kurz als auch zu kräftig sind.
Zu allem Überfluss teilt dir Julie, deine Nachbarin, mit, ihr dürftet – nach fünfjähriger Freundschaft – nicht mehr miteinander spielen. »Weil deine Familie nicht an Gott glaubt.«
»Natürlich glauben wir an Gott«, erwiderst du überzeugt.
Sie entgegnet schulterzuckend: »›Jamaikaner tun das nicht‹, sagt mein Dad.«
Eines Tages ermahnt eure Mutter deinen Bruder und dich: »Schleppt mir ja kein Mädchen mit krausen Haaren an.« Um sie zu verteidigen – oder noch tiefer zu blamieren –, soll gesagt sein, dass ihre Liste unerwünschter Mädchen so lang ist, dass ihr euch fragt, ob ihr überhaupt je ein Mädchen anschleppen dürft. »Schleppt mir ja keine Chinesin an«, ermahnt sie euch, als ihr auf der Middle School seid. Beim Anblick deiner kraushaarigen, kaffeebraunen panamaischen Abschlussball-Partnerin verbarrikadiert sie sich im Schlafzimmer. Das Mädchen verschlägt ihr schlicht die Sprache. Und nach dem Uniabschluss wird sie dich anflehen: »Bitte, kein weißes Mädchen, das musst du mir versprechen.«
Du bist in der Fünften, und die erste Ermahnung verwirrt dich. Was kennzeichnet krause Haare in den Augen deiner Mutter? Du betrachtest ihre Haare – fein wie die Gitarrensaiten-Haare von Jose und Luis –, danach deinen üppig gelockten Schopf. Verrückt, wie kraus deine Haare sind. Wer, fragst du dich, wird dich je zu Hause anschleppen?
Der Duppy kehrt zurück, er veranstaltet noch mehr Unsinn als früher. Er versteckt deinen Vater in einer Bar, bei einem Saufgelage, in einer Dimension, die unerreichbar ist für deine Mutter. Bevor er wiederauftaucht, voller J’ouvert-Schminke, wird er von eurer Mutter als vermisst gemeldet. Sie ruft bei der Polizei an, und du hockst mit deinem Bruder dicht genug daneben, um hören zu können, wie der Beamte fragt: »Ma’am, ich verstehe kein Wort. Spricht bei Ihnen auch jemand Englisch?«
Sie reicht dir das Telefon, beginnt zu schluchzen. Der Mann bittet dich um eine Beschreibung deines Vaters.
»Eins dreiundachtzig«, antwortest du. »Mager.«
»Schwarz oder weiß?«, will der Mann wissen.
Du schaust deinen Bruder an. »Nicht weiß«, sagst du.
»Also Schwarz.«
»Braun«, sagt dein Bruder.
»Ist dein Vater oft verschwunden?«
»Wie oft ist oft?«
Die körperlose Stimme erklärt: »Überhaupt mal.«
»Oh«, sagst du. »Dann viel zu oft.«
An dem Tag, als du in die Sechste kommen sollst, reißt ein Hurrikan namens Andrew euer Hausdach auf, als wäre es der Deckel einer Suppendose von Campbell, und schüttet eine Portion des Atlantiks in Schlafzimmer und Wohnzimmer – also in alle Zimmer –, lässt Teppiche, Trockenwände und Hartfaserplatten aufquellen, tränkt alles mit salzigem Meerwasser. Er löst die rotbraunen Glasfaserplatten von Wänden und Decken und verteilt die Innereien des Hauses auf dem Rasen. Der Hurrikan zertrümmert das Haus eurer Nachbarn und parkt einen Schleppkahn ganz hinten in der Straße.
Also verlasst ihr Miami-Dade und sucht Zuflucht in Broward County, wo sich der Arbeitgeber deiner Mutter vorübergehend eingerichtet hat.
Auf der neuen Schule freundest du dich wieder mit braunhäutigen Jungs an. Wie du erfährst, sind es Puerto Ricaner. Einer, Osvaldo, nimmt dich unter seine Obhut. Du sitzt mit seiner Truppe in der Mensa, und während sie Spanisch sprechen, starrst du dein Tablett mit den Fächern für Erbsen und Möhren an. Wenn du ganz still bist, nehmen sie dich bei diesen Gelegenheiten nicht wahr – dann bist du unsichtbar. Und wenn dich niemand wahrnimmt, merkt auch niemand, dass tú no entiendes, dass du nicht dazugehörst. Osvaldo scheint aufgefallen zu sein, dass du kein Spanisch sprichst, doch er sieht darüber hinweg, schaltet auf Englisch um.
Kann sein, dass sie nichts merken, weil du deinen Kopf inzwischen kahl rasierst, deine verräterisch drahtigen Locken kappst, kann sein, dass du diesen Jungs ähnelst, obwohl ein bisschen mehr Afrika durch deine Adern fließt; oder sie nehmen an, du hättest kapiert, dass man sich auf dieser Schule und in eurem Alter an Seinesgleichen hält. Jedenfalls dämmert dir zu spät, dass sie dich für einen Puerto Ricaner halten.
Sie reißen Witze über Weiße: »Weiße stinken wie Cockerspaniel. Aber nur, wenn sie nass sind.«
Sie lachen über Schwarze: »Warum stinken Schwarze so schlimm? Damit sie auch von Blinden gehasst werden können.«
Schließlich will einer beim Mittagessen verächtlich von dir wissen, warum sich deine Eltern nie die Mühe gemacht haben, dir Spanisch beizubringen. Du glaubst, Osvaldo würde eingreifen, aber auch er wartet auf eine Antwort.
»Weil sie kein Spanisch sprechen«, sagst du.
Die Jungen tauschen verwirrte Blicke. »Auch nicht? Haben sie’s nicht von deinen Großeltern gelernt?«
»Meine sehr jamaikanischen Eltern sprechen nur Englisch«, stellst du klar.
»Halt mal«, sagt Osvaldo. »Du bist also Schwarz?«
Problematisch ist nicht nur, dass du dich zu erkennen gegeben hast, sondern auch, dass diese Gruppe eine andere Gruppe befehdet. Beide reklamieren bestimmte Abschnitte des Schulhofs für sich und geraten manchmal unter einer nahen Überführung aneinander. Du bist noch so neu auf dieser Schule, dass du nicht weißt, was Sache ist, aber wie es der Zufall will, sind die Rivalen zwei Inseln weiter zu Hause: auf Jamaika. Diese Information ist das Abschiedsgeschenk Osvaldos. Ab jetzt bist du unerwünscht an diesem Tisch.
Die Jamaikaner, von denen einige in deiner Jahrgangsstufe sind, ähneln weder deiner Familie noch euren Freunden von der Insel, die gelegentlich zu Besuch kommen. Und ihre skeptischen Mienen sagen dir, dass du niemandem ähnelst, den sie als Freund gelten lassen. Du fragst dich, ob es zwei Sorten Jamaikaner gibt.
Der Unterschied geht aus den Bezeichnungen hervor, mit denen du von ihnen und ihren amerikanischen Pendants belegt wirst: Heller Schwarzer, brauner Weißer. Manchmal nennen sie dich schlicht Spanier. Nachdem du aus der Enklave der Braunhäutigen geschasst wurdest, klammerst du dich in deiner Einsamkeit panisch an deine Verletzlichkeit.
Dein Bruder, Delano, der dir vier Jahre Erfahrung voraushat und merkt, dass du immer tiefer in diesem Schwellenzustand versackst, stellt die Sache schließlich klar: »Du bist Schwarz, Trelawney. In Jamaika war es anders, aber hier ist das nun mal so. Hier gibt’s nur Entweder-oder.«
Und mit einem Grinsen fügt er hinzu: »Sorry, dass ich deine Illusionen zerstören muss.«
Du versuchst, mit deinen jamaikanischen Klassenkameraden Freundschaft zu schließen. Das bringt ständige Demütigungen mit sich, darunter Kreuzverhöre zu jamaikanischen Städten (»Jeder kennt Kingston. Das zählt nicht.«), zu deinem Patwah (»Weißt du, was ein batty boy ist, batty boy?«) und zu den jamaikanischen Tänzen, die du beherrschst (»Du kannst den Bogle? Lass mal sehen!«). Bis du kapierst, dass sie dich nie akzeptieren werden, zumal nach deiner Zeit bei den Puerto Ricanern. Beide Gruppen wetteifern darum, dir im Flur ein Bein zu stellen oder das Essenstablett aus deiner Hand zu schlagen.
In der Mittagspause verziehst du dich in die Science-Fiction- und Dystopie-Abteilung der Bücherei, der einzige Ort, an dem du dich sicher fühlst. Diese doppelte Verbannung führt dir eines klar vor Augen: Wenn du irgendwas bist, dann ein schwarzes Schaf.
Dein Bruder beginnt, an den Wochenenden mit eurem Vater nach Miami zurückzufahren, die abgenutzte, lederne Werkzeugtasche über der Schulter wie den Gürtel eines Meisters im Schwergewicht. Seine Bizepse wachsen und straffen sich über Nacht, als hätte man mit einem Schuhlöffel Tennisbälle unter seine Haut gehebelt. Und in seinen Schultern scheinen Softbälle aufzuquellen. Seine Haut wird dunkler, sie nimmt unter dem Bart, der auf seinen Wangen sprießt, einen Terrakottaton an, seine Wangenknochen werden in der Sonne aschgrau.
»Dachdeckerarbeiten«, erklärt er. »Fiese Sonne, verstehst du?« Das sagt er grinsend auf Patwah, und als er mit einem Daumen über die Barthaare auf seinem Kinn streicht, strafft sich die Haut über den Knöcheln.
Unter Anleitung eures Vaters leistet er Aufbauarbeit: der Wiederaufbau des Hauses, des Lebens, das der Hurrikan Andrew in Trümmer gelegt hat. Er bastelt an seiner Männlichkeit.
Sie verschwinden am Freitagabend und kehren am Sonntag zurück. Angeblich schlafen sie in einem Zelt, das sie in den Trümmern der Küche oder des Wohnzimmers aufschlagen, je nachdem, wo sie gerade arbeiten.
Du bittest deinen Vater, dich mitzunehmen, dir zu erlauben, beim Wiederaufbau zu helfen.
»Das ist kein Kinderkram, Junge«, sagt er. Seine Entscheidung ist unumstößlich.
Am Wochenende sitzt du vor deiner Sega-Konsole und schlägst alles Mögliche tot: Vampire und Außerirdische und die Zeit.
Als dein Bruder eines Sonntagabends euer Zimmer betritt, stinkt er. Die vom Schweiß hinterlassene Salzkruste ist so dick, dass man sie von seinen Armen kratzen könnte. Würde man seine Klamotten ausklopfen, dann würde einen die Gipswolke, die dabei entstände, komplett einnebeln. Sein warmer Atem riecht nach Bier, nach Eintopf. Er klettert ins obere Etagenbett und klappt dort zusammen, ein brauner Stiefel ragt über die Bettkante. Du fragst dich, ob er es morgen zum Unterricht schafft, sagst aber nichts.
Du fragst bloß: »Wann seid ihr fertig?« Das fragst du an jedem Sonntagabend. Und die vage, beschwichtigende Antwort lautet stets: »Bald.«
Dies deutest du sehr optimistisch und wiederholst es vor deinen Lehrern, vor allen, die es hören wollen. »Dauert nicht mehr lange«, sagst du. »Hier sind meine Hausaufgaben. Sie können Sie gern benoten, aber es wäre möglich, dass ich am nächsten Montag nicht wiederkomme. Ich kann jeden Tag verschwinden.«
Und wenn du am Montag doch in die Schule zurückkehrst, heißt es immer: »Na, noch eine Woche bei uns, Miami?«
Du starrst die Tafel an und faltest deinen Blick nach innen, um den Ausdruck deiner Augen, deinen Tonfall zu verbergen. »Ist bald so weit«, erwiderst du monoton.
Beim nächsten Mal wird die Frage Wie lange noch? von deinem Bruder mit den gegähnten Worten beantwortet: »Wir sind fast fertig. Wird echt schön, Bruderherz. Besser als zuvor. Stabiler.«
»Hoffentlich bald. Ich gehör’ hier nicht hin.«
»Fakt ist«, sagt Delano und dämpft ein Rülpsen hinter der geballten Faust, »dass du nicht zurückgehst. Nicht dahin.«
»Nicht dahin? Was soll das heißen?«
Er schweigt eine Weile, will vielleicht warten, bis er nüchterner ist, und als er begreift, dass er sich verplappert hat, fügt er hinzu: »Dad hat es mir an diesem Wochenende gesagt. Du und Mom, ihr kommt nicht mit uns.«
Am Tag des Umzugs verabschiedet sich dein Vater mit einem festen Händedruck und sagt: »Bald, ja?« Seine Miene deutet an, dass er bei dieser Gelegenheit mehr sagen müsste, nur fällt ihm gerade nichts ein.
Deine Mom kann sich kaum von Delano losreißen, und als sie ihn aus ihrer Umarmung entlässt, stürmt sie in die Wohnung, ohne euren Vater eines weiteren Blickes zu würdigen. Dein Bruder verabschiedet sich mit einem Faustgruß von dir. »Auf bald, Alter«, sagt er und schenkt dir ein Lächeln. Es ist eine Geste. Alles halb so schlimm, soll diese Geste besagen, obwohl es katastrophal ist, wie ihr wisst.
Eine Woche, bevor du in die Siebte kommst, zieht deine Mutter mit dir wieder ins Miami-Dade-County, nach Kendall, wo niemand Amerikaner ist. Du könntest als Gringo gelten, sogar als Schwarzer Amerikaner, aber mit der Solidarität unter den Stars and Stripes ist es vorbei.
In der Schule verspotten dich Schwarze Mädchen in den Fluren als rehbraun. Die Jungs machen sich darüber lustig, wie du redest, sie nennen es weiß. Du willst nicht weiß sein, natürlich nicht, du lehnst es ab. Du schwörst Schwarz die Treue. Hörst die Musik, trägst die ausgebeulten Klamotten.
Die beliebtesten Kids an deiner überwiegend lateinamerikanischen Middle School sind Schwarze. Niemand, so die allgemeine Meinung, ist so charismatisch wie sie, niemand ist so sportlich wie sie, ihnen geht alles am Arsch vorbei. Du willst an diesem Schwarzsein teilhaben, an dieser geheimnisvollen Anziehungskraft. Du imitierst diese Jungs. Du ahmst nach, wie sie reden, wie sie gehen. Auf dem Heimweg von der Schule beginnst du zu schlurfen und zu humpeln und danach zu hoppeln und zu humpeln, dann zu hoppeln und danach zu humpeln. Dein neuer Gang trägt nicht zu deiner Integration bei, sondern erweckt den Eindruck, du hättest irgendwelche Probleme, aber weil niemand damit punkten kann, ein behindertes Kind zu mobben, hoppelst du weiter. Du entwickelst die Angewohnheit, Wörter zu dehnen und Konsonanten auszulassen, ganze Silben zu verschlucken, denn Scheiß auf die Schwarzen, wenn sie dich nich’ woll’n.
Die Vorteile sind simpel: Wenn du eine Mitgliedskarte hast, kommt dir niemand mehr dumm. Die Gangs im Viertel, meist Latinos aus der Vorstadt-Mittelschicht, sind den Schwarzen zahlenmäßig weit überlegen, hüten sich aber vor ihnen, weil sie Brüder, Cousins und Onkel in Overtown und Liberty City und im Knast haben, alle berühmt dafür, Menschen getötet zu haben. Dir wird klar, dass es dein Leben retten könnte, Schwarz zu sein.
Nur stellst du dich zu blöd an.
Wenn du dummen Scheiß machst, ist das peinlich. Wenn sie dummen Scheiß machen, ist das ansteckend.
Sie reden sich nur mit Nigga und Dog an. Dann greifen die Lationos Nigga und Dog auf. Irgendwann sagen auch Weiße Nigga und Dog, wenngleich verhalten und manchmal erst, nachdem sie sich umgeschaut haben. Kann sein, dass du es anfangs ironisch meinst, aber du machst mit.
Du beginnst mit My bad und kicherst. Du findest es rasch natürlicher als Sorry. Jahre später bekommst du mit, wie es in Friends und in den Abendnachrichten benutzt wird.
Wenn dich jemand fragt: »Was bist du?«, lautet die simple Antwort jetzt: »Schwarz.« Und man wird sie dir bald abkaufen.
Deine Mutter macht um siebzehn Uhr Feierabend und ist gegen neunzehn Uhr zu Hause. Der von Andrew erzwungene Umzug ihres Arbeitgebers nach Fort Lauderdale hat sich als dauerhaft und unumkehrbar erwiesen. Das Pendeln raubt ihr viel Lebenszeit, also hört sie unterwegs die Kassette Italienisch leicht gemacht! Seltsamerweise wird ihr amerikanischer Akzent dadurch stärker. Sie schläft abends vor dem Fernseher ein, hat kaum noch genug Kraft, um zu fragen: »Alles okay bei dir?«
»Alles okay«, antwortest du, egal wie es steht.
»Und deine Noten?«
»Sind okay.«
»Und deine Freunde? Schon Freunde gefunden?«
»Meine Freunde sind okay.«
Das Haus, das deine Mutter erworben hat, ist größer als das, in dem ihr als Familie gewohnt habt, aber viel kahler. Sie staffiert die Wohnbereiche an den Wochenenden mit Sesseln, Kunstwerken und Teppichen aus, aber die Zimmer wirken trotzdem leer. Ein drittes Schlafzimmer, deinem Bruder vorbehalten – sicher der eigentliche Grund für eure Rückkehr nach Miami-Dade –, wird so gut wie nie benutzt.
Obwohl sich das Familieneinkommen durch den Abschied deines Vaters halbiert hat, kann sie sich das Haus durch ein wundersames Darlehen mit flexiblen Raten leisten. »Es ist eine Investition«, sagt sie zu dir. »Im Moment ist ein Kauf ideal.«
»Warte«, sagst du. »Hast du das Haus jetzt gekauft, oder gehört es der Bank?«
»Ich habe es gekauft«, antwortet sie. »Und es gehört der Bank.«
Dein Vater kommt unregelmäßig vorbei und nimmt dich nur einmal zu dem Haus mit, das er mit deinem Bruder bewohnt. Unterwegs läuft Radio. Er ist ein Paradebeispiel für aktives Zuhören. Der Titel der Sendung lautet »Rassenkonflikte«.
Der Moderator sagt:
»Ich setze auf die Lateinamerikaner, denn diese Menschen haben ein bemerkenswertes Talent dafür gezeigt, an jeden gewünschten Ort zu gelangen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Grenzen und Hindernisse zu überwinden ist kein Problem – sie kommen überallhin. Sie halten lange ohne Wasser durch und sind bereit, Jobs anzunehmen, die andere verschmähen. Geschirrspülen, gärtnern …«
Dein Vater klatscht auf sein Knie und lacht heiser. »So ein Idiot«, sagt er, dann stellt er lauter. Er glättet seinen Schnurrbart mit zwei Fingern und reibt sich das Lächeln aus dem Gesicht, als er merkt, dass du ihn betrachtest.
»Die Schwarzen – und ich weiß, Sie werden mich für rassistisch halten – aber die Schwarzen haben keine Chance. Null. Und ich sage ihnen auch wieso. Sie können nicht schwimmen. Das ist erwiesen. Fast die Hälfte aller Ertrunkenen zwischen fünf und vierundzwanzig sind Schwarze, das besagt eine Studie in The American Journal of Public Opinion.«
»So ein Quatsch.« Dein Vater stellt wieder leiser. Zehn Sekunden später lacht er und sagt zu sich selbst: »Aber gut, vielleicht hat der Mann nicht ganz unrecht.«
Als du das Haus deines Vaters betrittst, stellst du fest, dass der graublaue Teppich im Wohnzimmer strahlend weißen Fliesen gewichen ist. Die Fruchtsaftflecke und borstigen Stellen auf der Landkarte deiner Kindheit sind mit dem Teppich verschwunden. Am auffälligsten ist der Durchbruch zwischen der Küche und deinem alten Schlafzimmer. Sie haben es in eine Art Essbereich verwandelt. Der naturbelassene Esstisch wird von einem grün-weißen Gartenstuhl und einem weinroten Schreibtischstuhl flankiert. Das Haus ist tadellos sauber, abgesehen von den Kaffeebechern und den Zeitungen auf der unbehandelten Tischplatte.
Dein Bruder, im vorletzten Highschooljahr, lehnt mit bloßem Oberkörper am Plastikgeflecht des Gartenstuhls und überfliegt die Kleinanzeigen. Er ist so hager, dass sich die Rippen abzeichnen, ähnelt eurem Vater noch mehr.
Während du dich umschaust, betrachtet dein Vater missbilligend deine Klamotten; er horcht bei Wörtern auf, die du benutzt oder auch nicht benutzt. Du weißt nicht genau, welche es sind, obwohl du in seiner Gegenwart manchmal Slang verwendest. »Hängst du etwa mit den Schwarzen Kids ab, Junge?«, fragt er.
Du schaust zu deinem Bruder, der die muskulösen Schultern abwechselnd hochzieht und sinken lässt und weiter Stellenanzeigen einkringelt.
»Du wirst immer mehr zu einem Yankee-Butu«, sagt dein Vater.
»Du hast mich benutzt, um eine Greencard zu kriegen, also beschwer dich nicht«, entgegnest du. »Ich hab’s mir nicht ausgesucht, hier geboren zu werden.« Du kennst deine Position auf dieser Welt inzwischen besser, wie du sie ändern könntest, weißt du allerdings nicht so genau.
Auf der Highschool fragen die Lehrer nicht mehr, wie es kommt, dass du so gut Englisch sprichst. Sie richten sowieso kaum noch Fragen an dich, außer einmal, als man dir vorwirft, plagiiert zu haben, weil dein naturwissenschaftlicher Aufsatz zu gebildet klinge. Du redest und kleidest dich wie ein Schwarzer, schreibst aber weiß, ein Widerspruch, den du erklären musst.
Dir dämmert, dass du von der Schule fliegen könntest, weil du dir die Redeweise der Schwarzen angeeignet hast.
Dein Lehrer, Mr Garcia, zwingt dich, den Aufsatz noch einmal zu schreiben, damit er so klingt, als hättest du ihn tatsächlich selbst verfasst. Also schreibst du alles neu: Niggas wollen wissen wieso Niggas krepieren, wenn Kugeln fliegen. Das ist so, sagt Newton, weil Scheiß, der in Bewegung ist, in Bewegung bleibt. Der Nigga war mal ein richtig schlauer Nigga.
Dein überarbeiteter Aufsatz beschert dir ein fettes Häkchen und eine Vier minus.
Als im Februar die Gräuel thematisiert werden, die in Amerika an den Schwarzen verübt wurden, nickst du, schaltest dann ab und denkst: Das ist nicht meine Geschichte. Damals waren meine Vorfahren nicht hier. Zugleich kultivierst du eine Verachtung für Amerika, was gar nicht nötig wäre, weil Amerika wie von selbst für Verachtung sorgt. In irgendeinem Winkel deines Gehirns ist dir klar, dass du diese Verachtung empfindest, weil du die amerikanische Geschichte für deine Geschichte hältst.
Du hoffst dennoch, jenseits von Amerika eine angenehmere Alternative zum unterdrückungsfixierten Narrativ der Menschen der afrikanischen Diaspora zu finden. Aber du entdeckst bestenfalls Schlupflöcher in der Definition dessen, was Schwarz ist, Begriffe wie Mischling oder Mulatte, semantische Fallschirme, die es dir erlauben könnten, der Klassifizierung als Schwarzer zu entrinnen. Du lehnst diese Begriffe ab und erfindest eigene: Halbafrikaner und Heller Schwarzer.
Wenn du Jungen mit deinem oder einem dunkleren Teint begegnest, mit krauseren Haaren, volleren Lippen und breiterer Nase, die sich an ihr puerto-ricanisches oder dominikanisches Erbe klammern, um behaupten zu können: Ich bin kein Schwarzer, ich komme aus der Dominikanischen Republik, dann beschimpfst du sie zusammen mit deinen Freunden als Verräter. Als Schwarze, die sich selbst hassen. Denn Schwarze, so deine Meinung, müssen stark und einig sein.
Eines Tages – die Medien haben über eine endlose Folge rassistischer Übergriffe berichtet – zieht eine Truppe afroamerikanischer Jungs mit Rufen wie chico und oye an dir vorbei, und du beobachtest sie, hältst Ausschau nach der Person, auf die sie es abgesehen haben, und denkst: Irgendjemand ist gleich fällig, ohne zu kapieren, dass sie dich im Visier haben. Ein Dutzend Hände rammen dich gegen einen Maschendrahtzaun, sie schubsen dich herum, als wollten sie das Schwarz aus deiner Haut schütteln, um sich mit vollem Recht an deinem Weiß austoben zu können.
Bevor jemand zuschlägt, schlendert Shells, ein gemeinsamer und eindeutig Schwarzer Freund vorbei und rettet dir den Arsch. »Nee, der ist cool«, sagt Shells unverbindlich. Aber es genügt.
Wie kommt es, dass dein Schwarzsein so wenig überzeugend ist?
Warum kann man nicht als Schwarz gelten, wenn man Spanisch spricht? Warum kann man nicht als Schwarz gelten, wenn man von einer Insel in der Karibik kommt?
Das würdest du gern wissen, ernsthaft, weil einige Jamaikaner aus deinem Umfeld seit geraumer Zeit Ähnliches behaupten. »Kulturell gesehen sind wir anders«, sagen sie. Du kennst diese Einstellung aus deiner Familie. Sie ist inzwischen so weit verbreitet, dass dir sogar afroamerikanische Freunde damit kommen.
Im Lagerhaus, wo du jobbst, fragt dich ein weißer Kollege, ob du ihm beim Wegniggern einer Palette helfen kannst.
»Findest du den Begriff in meinem Fall korrekt?«, fragst du.
»Kann dir doch egal sein. Du bist kein Schwarzer. Du bist Jamaikaner«, meint er. »Ein jamaikanischer Freund hat mir den Unterschied erklärt.« Wäre schön, wenn sein Freund dir diesen Unterschied auch mal erklären könnte.
Schwarze Amerikaner sind die einzigen Schwarzen. Schwarzer als Afrikaner. Schwarz auf die (gesenkte Stimme) fiese Art.
Während du immer mehr darüber erfährst, was es bedeutet, ein Schwarzer in Amerika zu sein, beschließt du, dich doch noch mit deinem jamaikanischen Erbe zu befassen.
Du beginnst mit simplen Dingen.
Auf einmal magst du alles mit Curry und Jerk-Fleisch. Deine Flagge, bis dahin rot, weiß und blau, leuchtet jetzt in Gold, Grün und Schwarz. Du stopfst deine Schubladen mit Bandanas und Armbändern in den jamaikanischen Nationalfarben voll. Deine Ein-Wort-Antwort lautet jetzt Jamaikaner, denn du findest sie offener, allumfassender.
Außerdem: Wenn du Amerikaner ergänzt hast, weil die Antwort Schwarz nicht zufriedenstellte, schüttelten die Fragenden stets den Kopf und sagten: »Nein, du Idiot. Woher kommen deine Eltern? Das meine ich.«
Jamaika ist die Lösung. Präziser geht’s nicht.
Trotzdem entgegnet die Hälfte der Leute, deren Frage Was bist du? mit Jamaikaner beantwortet wird: »Du klingst aber nicht jamaikanisch. Wenn du Jamaikaner bist, wieso hast du dann keinen Akzent?«
Du steigst tief ein. Nicht Shaggy-Mr.-Lover-Lover-Tralala-Radio-tief. Eher Capleton-More-Fire-Mixx-96-Underground-Radio-tief. Panyard-Warehouse-Tanzclub-tief. Du stehst nicht auf Rap, außer Kool Herc, ein Yardie, war als erster Hip-Hop-tief. Oder die Mom von B. I. G. wäre Jamaika-tief. Und so tief wie er war kei-ner.
Du bist kein Rasta, quasselst aber Prinzipien-tief. Du betest nicht zu Selassie, bist aber Marcus-Garvey-tief. Du brüllst Zur-Hölle-mit-Bush, giltst aber nur als Colin-Powell-tief.
Bully-Beef-tief. Samstags-mach-ich-Chocho-Suppe-tief. Du isst Marie-Patties-und-Sangos-tief, also isst du in der Colonial, also bist du Akee-und-Klippfisch-tief. Fisch-und-Festival-tief. Johnnycake-und-Fritters-tief.
Du bist Ich-weiß-von-Seaga-gegen-Manley-tief, du bist JLP-gegen-PNP-tief, wie in Red-Stripe-gegen-Heineken-tief. Du bist Tanz-auf-den-Tischen-Bayside-Hut-Rhythmus-tief.





























