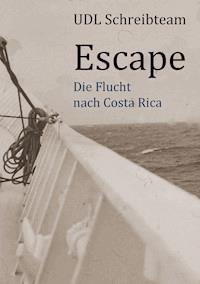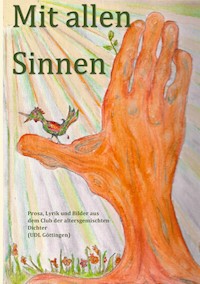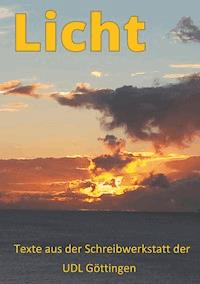Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unterschiedlichen Facetten zumThema "Familie" spürt die Anthologie aus der Schreibwerkstatt der UDL in Geschichten, Gedichten und Bildern auf. Die Verfasser gehören verschiedenen Generationen an und haben teilweise in altersübergreifenden Teams gemeinsame Entwürfe gestaltet. Die literarischen Texte werden ergänzt durch Bilder verschiedener Künstlerinnen, insbesondere aus der Ateliergemeinschaft Farbenkreis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Anthologie entstand im Rahmen der von Ruth Finckh geleiteten Schreibwerkstatt des Dritten Lebensalters an der Universität Göttingen (UDL).
Zu diesem Buch haben beigetragen
Nevena Radeva
Iris Nicola Haferland
Helga Margenburg
Martina Maly
Hans-Jochen Hüchting
Albrecht Thiel
Eva Jänecke-Lauke
Lore I. Lehmann
Ruth Finckh
Christoph Große
Katharina Nolte
Manfred Kirchner
Brigitte Rosetz
Petra Mielcke
Claire Seibt
Gerhard Diehl
Mareile Steinsiek
Carmen Lotzmann
Wilfried Seitz
Hansi Sondermann
Sylvia Kerl
Martina Scheible
Für Anregungen und Bilder danken wir Ingrid Hüchting und der Ateliergemeinschaft „Farbenkreis“
Collage: Lore I. Lehmann
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Erinnerungen
Nevena Radeva
Meine Familie
Iris Nicola Haferland
Warten auf Marian
Helga Margenburg
Das Cello
Martina Maly
Weltall.Erde.Mensch
Hans-Jochen Hüchting
Kraftquelle
Iris Nicola Haferland
Das Mädchen auf der Treppe
Albrecht Thiel
Familie auf der Flucht
Kapitel 2
Bekenntnisse
Ein Schulbuchauszug aus dem Jahr 1911
Familienfoto 1919
Eva Jänecke-Lauke
My Family first
Lore I. Lehmann
Lukas ist leider nicht Familie
Eva Jänecke-Lauke
Wie werde ich meine Mutter los?
Sylvia Kerl
Reif
Ruth Finckh
Für eine Freundin und ein Pflegekind
Martina Scheible
And do I have another Christmas
Martina Scheible
Without you – Song for my mum and me
Lore I. Lehmann
Ich hatte eine Schwester
Ruth Finckh
Spielgefährte
Albrecht Thiel
Ein Bekenntnis zur Familie
Kapitel 3
Familienalltag
Helga Margenburg
Endlich!
Martina Maly
Das natürliche Kind
Ruth Finckh
Putztag im Wald
Helga Margenburg
Der ganz normale Wahnsinn
Christoph Große
In welcher Familie ist schon alles in Ordnung?
Katharina Nolte
Kinderalltag
Ruth Finckh
Sonntagmorgen
Eva Jänecke-Lauke
Seine Familie
Kapitel 4
Spuren der Ahnen
Ruth Finckh
Sippentreffen 1
Ruth Finckh
Sippentreffen 2
Martina Maly
Ferdinand und Fernanda
Martina Maly
Falk
Manfred Kirchner
Gefangen
Brigitte Rosetz
Gedicht in der Zeitung
Manfred Kirchner
Familienschatz
Brigitte Rosetz
Mein Vater
Martina Maly
Verbirg mich in deinem Vergessen
Kapitel 5
Träume und Fantasien
Petra Mielcke
FAMILIENLABYRINTHE
Claire Seibt
Alles für die Katz'
Ruth Finckh
Mein Wolkenkind
Petra Mielcke
Im Garten der Püschelbergers
Gerhard Diehl
Familiennachmittag
Ruth Finckh
Tacitus
Mareile Steinsiek
Das Schächtelchen
Kapitel 6
Am Scheidepunkt
Carmen Lotzmann und Wilfried Seitz
EntScheidungen
Hansi Sondermann
Das Rosenblatt–Quartett– eine Familie?
Hansi Sondermann
Holy Family
Iris Nicola Haferland
Lebenslänglich
Die Autoren
Ateliergemeinschaft „Farbenkreis“
Kapitel 1
Erinnerungen
Ursula Buchhorn
Nevena Radeva
Meine Familie
„Wo gehen wir denn hin?“ „Immer nach Hause.“ Novalis
Ich möchte dir keine traditionelle Familiengeschichte erzählen, denn für mich erschöpft sich der Begriff Familie nicht nur in den verwandtschaftlichen Beziehungen. Für mich ist Familie etwas mehr, ein weit umfassender Begriff. Ein Gefühl. Eine Weltwahrnehmung.
Wenn man geboren wird, bekommt man eine Familie. Geschenkt. Es kommt aber die Zeit, wo man sich von dieser Familie trennt, um seinen eigenen Weg einzuschlagen. Von da an beginnt die Suche nach neuen Familien. Sie können nie die eigentliche ersetzen. Sie erleichtern nur den Weg ohne sie.
Und damit dies nicht so abstrakt klingt, lass mich bitte eine kurze Geschichte erzählen.
Es ist schon dunkel an diesem herbstlichen Tag. Es nieselt. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Das gelbrote, warme Licht eines Hauses zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Dieses Licht... Vor meinem inneren Auge taucht das kleine, helle, warme Zimmer auf, wo wir versammelt waren. Drei Generationen vermochte dieses Zimmer in sich aufzunehmen, ohne dass jemand sich eingeengt fühlte. Der Kamin brannte. Der Geruch von verbranntem Holz steigt mir in die Nase. Und die Wärme... Diese Wärme vergesse ich nie. Gelbrote Lichtstreifen eines vorbeifahrenden Autos blenden mich. Mir ist kalt. Der Rauch verblasst, der Kamin erlischt. Ich sehe Passanten, die eingehüllt in ihren warmen Jacken an mir vorbeigehen. Sie lächeln mich nicht an. Sie schauen mich nicht einmal an. Da habe ich mich wohl geirrt!
Ich bin auf dem Weg nach Hause und immer noch auf der Suche nach meiner Familie. Ob ich sie finde?
Bestimmt!
Ursula Buchhorn
Iris Nicola Haferland
Warten auf Marian
Da bog der rote Omnibus mit der leuchtend orangen 450 auch schon um die Ecke und entlockte ihr einen erleichterten Seufzer. Gleich würde sie ihren Marian die alte knarrende Holztreppe hinaufgerannt kommen hören, seinen türkisfarbenen Tornister mit Seepferdchenmuster eilig abwerfen und zu ihr laufen, um die Ärmchen um sie zu schlingen. „Wie schön, dass du wieder da bist“, würde sie sagen, ihm liebevoll über die stoppelige Kurzhaarfrisur streichen. „Wie war es in der Schule?“
Sie hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte und die Wohnungstür geöffnet wurde. „Hallo Marian“, rief sie mit brüchiger Stimme, indem sie sich in ihrem am Fenster stehenden Sessel zu drehen versuchte. Plötzlich nahm ihre Miene kindliche Züge an. „Ich habe das Essen noch nicht fertig.“ Ihre Stimme klang erschrocken wie die eines schuldbewussten Schulmädchens.
„Ich bin's doch, der Jan“, sagte der junge Mann etwas zu laut.
Sie schwieg verwirrt und kramte nach Sätzen, mit denen sie Fehler zu überspielen gelernt hatte.
Jan bemühte sich, der alten Dame den Eindruck zu vermitteln, er habe weder ihren Fehler noch ihre Verwirrung bemerkt. „Ich bringe Ihnen Ihr Essen, Frau Reisler. Leckere Erbsensuppe gibt's heute.“ Jan hob den Deckel von dem Tablett und stellte es auf den Tisch, der vollgekramt mit gerahmten Fotos, Steinen, die wahrscheinlich voller Erinnerungen steckten, und geriatrischen Medikamenten war. Eigentlich hatte er nur fünf Minuten für die Essensauslieferung. Zwei davon musste er schon für Parken und die Treppen in den zweiten Stock abziehen. Aber er brachte es nicht fertig, gleich wieder zu gehen. Wahrscheinlich war er noch nicht lange genug als Bufdi tätig, dachte er entschuldigend.
„Ihr Sohn ist doch schon erwachsen, Frau Reisler, nicht wahr?“, versuchte er, geschickt ein Gespräch zu beginnen, indem er sich gegen die Fensterbank lehnte und die alte Dame prüfend ansah. Man konnte nie wissen, ob es ein guter oder ein schlechter Tag war. Er hatte in dem einen Jahr, in dem er ihr jetzt das Essen brachte, oft genug beides unvermittelt hintereinander erlebt. Diesmal aber hellte ihr Blick sich bei seiner Ansprache auf und sie nickte dankbar. „Ja, sicher“, sagte sie schnell. „Ich dachte nur gerade, es ist noch gestern und Marian ist wieder klein. Ich habe immer hier am Fenster gestanden und er hat immer gewinkt, wenn er morgens zum Bus ging und wenn er mittags heimkam.“
Jan kannte ihre Geschichte. Er wusste, dass ihr einziger Sohn weit weg lebte und in der Pathologie beschäftigt war. Sein Vorgänger bei der Essensausgabe hatte ihm das einmal erzählt. Zum Geburtstag und zu Weihnachten schickte dieser Marian Päckchen mit Bananenchips, die seine Mutter früher gemocht hatte, und mit Nüssen, die sie schon lange nicht mehr beißen konnte. Sie baute die Tüten dann immer wochenlang vor sich auf, bis sie an einem schlechten Tag vergessen hatte, von wem sie waren. Dann wurden sie unauffällig von der Diakonie entsorgt. Jan hatte sich nie getraut zu fragen, ob jemand dort die Sachen aß.
„Marian hat so viel Arbeit. Aber bald kommt er und dann fahren wir an die See.“
Jan nickte unsicher, blickte verstohlen auf seine Handyuhr, blieb aber am Fenster lehnen. „Da sind Sie früher immer hingefahren?“
Die alte Dame schloss die Augen und lächelte. „Marian liebt das Wasser. Als mein Mann uns verließ, da war Marian drei, da fuhren wir zum ersten Mal zusammen ans Meer, an die Ostsee, und dann jeden Sommer wieder.“ Und sie fügte hinzu: „Auf Usedom haben wir oft gezeltet, direkt am Strand, wissen Sie, nur wir beide.“ Während sie von diesen Zeiten erzählte, glaubte Jan, ihren kleinen Jungen im Wasser planschen zu sehen und mit seiner Kinderstimme sich mit den Möwen um die Wette gegen die Wellen behaupten zu hören. Er staunte stumm, wie viele Worte und Bilder im Kopf der meist so einsilbigen Frau gespeichert zu sein schienen. Heute war definitiv ein guter Tag, dachte Jan und entschied spontan, einen Rüffel von seinem Vorgesetzten für den nicht eingehaltenen Zeitplan in Kauf zu nehmen.
„Marian ist so ein guter Junge“, hörte er die alte Frau da sagen, „so mitfühlend. In einem Sommer gab es ganz viele Hummeln an der Steilküste, wo wir unser Zelt aufgeschlagen hatten. Da hat Marian im Sand eine verletzte gefunden. Ich hatte Angst, dass sie ihn beißt, aber er hat Blätter und Blüten zusammengetragen und ihr ein Krankenlager gebaut. Eine halben Nachmittag hat er damit zugebracht, sie gesund zu pflegen, wie er das nannte. Er hat ihr Wasser aus einem nahen Flussbett gebracht und dafür gesorgt, dass sie stets Schatten hatte.“ Die Augen der alten Frau waren jetzt geschlossen und während sie versonnen lächelte, wirkte ihr Gesicht jünger und lebendiger als sonst.
„Deshalb ist Ihr Sohn ja wohl Arzt geworden“, sagte Jan schließlich, weil er das Schweigen nicht siegen lassen wollte. Im Stillen fragte er sich, wie ein Kind von der Hummelpflege wohl zur Pathologie gekommen sein mochte.
Frau Reisler schwieg weiter. Und ihm lief die Zeit davon.
„Wissen Sie was, Frau Reisler...“, sagte Jan da, einer spontanen Eingebung folgend, „ich habe morgen meinen freien Tag. Was halten Sie davon, wenn ich mit Ihnen nach dem Essen zum Blauen See rausfahre? Den kennen Sie doch?“
Der Augen der alten Dame begannen zu strahlen. Sie nickte. „Da hat Marian schwimmen gelernt.“ Ihr Blick glitt über das vollgekramte Tischchen und sie nahm zielsicher einen glatten hellen Kieselstein in die Hand, der - mit etwas Fantasie betrachtet - die Form eines Herzes hatte. „Den hat er beim Tauchen gefunden und mir ans Ufer gebracht... ,Weil ich dich lieb habe, Mama.'“ Die letzten Worte hatte sie ganz leise hinzugefügt, aber Jan hatte verstanden. Er legte seine Hand auf die ihre, die den Stein fest umschlossen hielt.
„Dann bis morgen Nachmittag, ja?“, sagte er betont fröhlich. „Vielleicht finden wir ja auch einen Stein.“ Etwas unschlüssig stand er auf. „Und nun denken Sie an Ihre Suppe, bevor die ganz kalt ist.“ Er ging zögerlich zur Wohnungstür und zog sie leise hinter sich ins Schloss.
Von der Straße sah er noch einmal zu dem Fenster im zweiten Stock hoch, aber er konnte die alte Frau nicht sehen.
Christine Herbold-Ohmes
Helga Margenburg
Das Cello
„Nicht“, schreit Uli verzweifelt, als die Männer das Cello seines Vaters packen. „Nicht das Cello, es gehört meinem Papa!“ Ulis Stimme ist kräftig, obwohl er zierlich und erst sieben Jahre alt ist, sie überschlägt sich fast, doch die beiden Russen, die es zum Fenster schleifen wollen, lachen nur und erklären in gebrochenem Deutsch „Papa weg. Nix wiederkommen.“ Einer der Männer tritt zu ihm und will ihm über das kurzgeschnittene semmelblonde Haar streichen, doch Uli duckt sich unter der groben Hand weg. Diese Hand soll ihn nicht berühren. Keine der fremden Männerhände soll das. Sie haben bereits seine Schwestern und seine Mutter angefasst, er hat es genau gesehen, und außerdem haben sie ihre Möbel angefasst und sein Spielzeug. Alles liegt jetzt unten im Hinterhof des Mietshauses, in dem sie wohnen, auf einem großen Haufen, übereinander und nebeneinander, zerbrochen auf den harten Pflastersteinen.
Einfach hinunter geworfen, aus dem vierten Stock, haben sie all ihre Sachen! Auch das, was seinen älteren Schwestern Inge, Christel und Rosi gehört. Gehört hat. Rosis Farbpalette und Christels Stoffe und die Nähmaschine. Von Inges Sachen kann er nichts entdecken.
Er kann es einfach nicht begreifen. In ihrem Zuhause sollen jetzt diese fremden Menschen wohnen? Nein, er will nicht sehen, was sie angerichtet haben und hält sich die Augen zu. Vielleicht ist alles ja nur ein Albtraum und die Dinge stehen wieder an ihrem Platz, wenn er die Augen öffnet.
Doch als er seine Hände wegnimmt, liegen die Sachen noch immer unten im Hof. Er sieht den kaputten Tisch, der einmal ihr Esstisch war; die Tischplatte haben die Männer zuvor mit einer Axt durchgehauen, damit der Tisch durchs Fenster passte. Auch von Papas Lieblingssessel haben sie die Lehne abgeschlagen. „So eine Gemeinheit“, denkt Uli. Er glaubt, das Geräusch der Axtschläge und des splitternden Holzes noch immer zu hören. Es dringt durch sein Trommelfell hindurch bis in seinen Kopf hinein, wo es sich festkrallt und nie wieder loslassen wird, das weiß er genau.
Zwei kleine Schränkchen liegen da, die Türen stehen offen und hängen schief in den Angeln; da sind auch Papas Bücher und obenauf die zerborstene Spielzeugkiste. Der braune Teppich, der sonst unter dem Tisch lag, hat den Sturz der Holzstühle abgebremst und alle bis auf einen sind heil geblieben, soviel er sehen kann.
Das Bücherregal hängt im Fliederbäumchen und hat die Äste weit heruntergedrückt.
„Der arme Baum“, denkt Uli, er weiß noch, wie die Eltern ihn vor einigen Jahren auf dem schmalen ungepflasterten Streifen des Hofes angepflanzt haben. Das Bäumchen hat sie alle erstaunt, denn trotz des schattigen Standortes reckt es seine Zweige der Sonne entgegen und blüht im Frühjahr hellviolett.
Als die Wohnung fast leer war, haben die Männer ihre eigenen Dinge heraufgeschleppt. Das ist erst heute Morgen gewesen, doch Uli kommt es vor, als habe sich das in einem anderen Leben abgespielt. Da stehen jetzt Lampen und Vasen aus funkelndem Kristall, dicke, glänzende, teils bunt gemusterte Teppiche liegen auf den Holzdielen, so wie er sie einmal in einem Buch aus dem Orient gesehen hat, und gepolsterte Sitzmöbel thronen an der Wand, wo das Regal mit Papas Büchern gestanden hat. Ziemlich teuer sehen die Sachen aus, aber irgendwie passen sie nicht in ihre Wohnung, findet Uli. Trotzdem bewundert er das, was er sieht und fragt sich, woher die Männer all das wohl haben.
Noch immer trampeln die Männer die schmale Stiege hinauf und schleppen weitere Gegenstände an. Vier Leute hat er gezählt. „Die werden mehr Platz haben als wir mit sechs, da kann einer jetzt auch allein schlafen, wie Inge“, überlegt er. Außer dem Esszimmer und der Küche gibt es schließlich drei Schlafräume. Inge als Älteste hat zuletzt ein Zimmer für sich allein gehabt, sie ist ja auch schon sechzehn, denn er schlief in Papas Bett, zusammen mit Mama, solange Papa nicht da war. Christel und Rosi schliefen zusammen, „Gott sei Dank“, denkt er, „die beiden gackern ja ständig wie alberne Hühner.“ Das war oft nicht zum Aushalten.
Ob sie bei Tante Dora wohl jeder ein eigenes Bett bekommen?
Als einer der Männer das Foto von Mamas Bruder, das mit dem schwarzen Trauerflor, von der Wand genommen hat und damit zum Fenster gegangen ist, ist seine Mutter in Tränen ausgebrochen, doch der Russe hat ihr eine Pistole vorgehalten und „Frau Ruhe!“ befohlen.
Statt Onkel Max prangt nun ein prächtiges Gemälde mit Bergen und Wald in einem verschnörkelten goldenen Rahmen an der gleichen Stelle an der Wand.
Noch nie hat Uli seine Mutter weinen sehen, jedenfalls nicht so heftig wie vorhin. Wortlos und unter Schluchzen hat sie sich umgedreht und ist langsam die Treppe hinuntergegangen. Schritt für Schritt. Sie hat sich nicht mehr umgedreht.
Uli weiß, unten steht bereits der gepackte Handwagen und alle warten nur auf ihn. Die fremden Männer haben ihnen erlaubt, ein paar Sachen mitzunehmen, so viel, wie in den Handwagen hinein passt, viel ist es nicht, hauptsächlich warme Kleidung und ein paar Decken und Kissen und etwas zu essen und zu trinken. Die neunzig Kilometer bis zu Tante Dora seien ein weiter Weg, hat die Mutter erklärt, sie würden zu Fuß gehen, aber wenn die Füße zu sehr schmerzten, dürfe abwechselnd immer eines der Geschwister in dem Karren ausruhen, Also musste dafür etwas freier Raum bleiben. Die Decken und Kissen würden sie brauchen, das sieht Uli ein, auch, dass für das Cello kein Platz mehr ist. Es ist einfach zu groß.
Ob sie wohl unterwegs einen Platz für die Nacht finden? Nachts müssen sie ja irgendwo schlafen, überlegt er.
Er müsste sich jetzt beeilen, trotzdem kann er sich nicht entschließen, der Mutter zu folgen. Noch nicht. Seine Gedanken gelten seinem Vater. Hoffentlich findet er sie, wenn er zurückkommt und sie nicht mehr hier wohnen.
Noch immer steht Uli am Fenster. Er zittert und muss mühsam die Tränen zurückhalten. Fassungslos sieht er auf alles, was ihn bisher begleitet, das sein Leben ausgemacht hat, und das jetzt zertrümmert auf einem großen Haufen liegt.
Das schlimmste ist die Spielzeugkiste, darin sind die Puppen der Schwestern, ihre Spielesammlung und seine Eisenbahn, die er zu Weihnachten bekommen hat, als er sechs war. „Schöne Weihnachten waren das“, denkt er wehmütig. Papa war da, er hatte auf dem Cello gespielt, sie hatten gemeinsam gesungen und es hatte geschneit. Da waren sie eine richtige Familie gewesen, er hatte sich geborgen gefühlt und war glücklich.
Die Kiste ist bei dem Aufprall auseinander gebrochen, einzelne Holzlatten liegen herum; er sieht seine Eisenbahn aus den Trümmern herausragen, die Waggons stehen in der Luft, sie haben sich von der Lok gelöst und sind zerbeult. Nie wieder wird er damit über die Schienen fahren können. Aber auch die sind nicht mehr da. Zumindest kann er sie aus dieser Höhe nicht entdecken.
Auch wenn ihre eigenen Möbel vielleicht nicht so prächtig waren wie diese, die jetzt ihren Platz einnehmen, er ist damit aufgewachsen, er liebte sie, sie gehörten zur Familie, sie waren sein Zuhause. Am Esstisch hat er seine Schulaufgaben gemacht bis die Schule zerbombt wurde und er nicht mehr hingehen konnte, und auf den Stühlen haben sie gesessen und gemeinsam das Essen eingenommen. Worauf sollen sie denn jetzt sitzen? Ein Sofa besitzen sie ja nicht. Vielleicht hätte man ihnen das Sofa gelassen, wenn sie eins gehabt hätten, das wäre zu groß gewesen, um es aus dem Fenster zu werfen. Dass es auch zu groß wäre, um es auf dem kleinen Handwagen zu transportieren, daran denkt er nicht.
Warum haben die Männer das bloß getan? Seine Mutter hat ihm erklärt, dass der Krieg zwar zu Ende ist, sie ihre Wohnung aber jetzt den Russen überlassen müssten, weil Deutschland den Krieg verloren hat und die anderen die Gewinner seien, aber er versteht es noch immer nicht richtig.
Warum wollen die russischen Männer ausgerechnet in ihrer Wohnung wohnen und was hat seine Eisenbahn damit zu tun und was Vaters Cello?
Seine Mutter hat geweint und verzweifelt zu den Männern gesagt „Aber das können Sie doch nicht machen!“, aber sie haben nur gegrinst und weiter die Sachen gegriffen und aus dem Fenster geschmissen. Vier Stockwerke tief! Es schien ihnen Vergnügen gemacht zu haben. Bei jedem Teil, das unten ankam, haben sie in die Hände geklatscht. Das krachende Geräusch, mit dem die Sachen auf den Pflastersteinen aufgeschlagen und zerborsten sind, wird er nie vergessen.
Das war fast genauso schlimm wie das Heulen der Sirenen, wenn es wieder einmal Bombenalarm gegeben hatte und sie in den Keller mussten. Da hat er jedes Mal vor Angst gezittert und sich hinter der Mutter versteckt, damit die Bomben ihn nicht finden. Diesmal hat es nichts genützt.
Er sei jetzt der Mann im Hause und müsse die Mama und die Schwestern beschützen, hat der Vater zum Abschied zu ihm gesagt, als er nach seinem letzten Besuch wieder weggefahren ist.
Er hatte ihn ernsthaft angesehen, sich dann sich zu ihm herunter gebeugt, und ihm einen Kuss gegeben.
Seitdem ist Uli derjenige, der als Vertretung des Vaters das Tischgebet spricht. Komm Herr Jesus, sei unser Gast. Er hat jetzt die Verantwortung. Auch für das Cello, das ist er Papa schuldig. Warum kam er denn bloß nicht nach Hause?
„Das Cello bleibt!“ sagt Uli noch einmal laut mit seiner kräftigen Stimme und so bestimmt, wie es klingt, klingt es wohl auch für die Männer. Die klare Anweisung des Kleinen überrascht sie offenbar, denn sie stellen das Instrument wieder zurück und lassen sich auf das Sofa mit den dicken altrosa Polstern fallen, das sie vor kurzem heraufgetragen haben. Sie greifen zu den beiden Wodka-Flaschen, die auf dem Glastisch vor ihnen stehen, und setzen sie an den Mund. Nur kurz setzen sie sie wieder ab, grölen „Nastrovje“ und schwenken die Flaschen in Ulis Richtung, dann trinken sie weiter.
Er weiß nicht, was ihm befremdlicher vorkommt: dass der Tisch eine Platte aus Glas hat, durch die man bis auf den Boden hindurch sehen kann, ihrer war aus Holz, oder dass sie keine Trinkgläser benutzen.
Uli klemmt die Hände unter die Hosenträger seiner dünnen Stoffhose, die zu kurz geworden ist und seine nackten Waden frei lässt. Er friert. Es ist schon November und die Luft riecht bereits nach Schnee. Christel hat ihm versprochen, ihm ein paar lange Strümpfe zu stricken, doch es gibt keine Wolle. „Junge, du wächst zu schnell“, sagt Mama immer. „Papa wird dich gar nicht wiedererkennen, wenn er nach Hause kommt.“ „Ja, wenn...“ denkt Uli. Es ist lange her, seit er seinen Vater das letzte Mal gesehen hat. Sehr lange. Viel zu lange. Damals gab es ein Kammerkonzert in der Wittenberger Schlosskirche und Papa hatte auf dem Cello gespielt. Uli liebt diese Kirche, sie hat so ein schönes buntes Glasfenster. In ihr ist er getauft worden, und hier besucht er regelmäßig den Kindergottesdienst. Es sei eine berühmte Kirche wegen Luther, erzählen die Leute, aber Uli findet, die Kirche sei bestimmt nur berühmt, weil sein Vater hier Musik macht.
Trotz der schrecklichen Situation flüchtet er sich in diese Bilder, sie geben ihm für den Moment ein kleines bisschen Halt.
Er schließt die Augen und sieht seinen Vater vor sich: wie er auf einem der Kirchenstühle sitzt, das Instrument zwischen die Beine geklemmt und mit dem Bogen voller Hingabe über die Saiten streicht, aus denen er überirdisch klangvolle und schwingende Töne hervor zaubert. Töne, die sich aneinander reihen und die Luft erfüllen.
Das Cello sei eine Bassgeige und sie sei aus verschiedenen Holzarten gefertigt, hatte er ihm erklärt, und es seien Stücke von Haydn und Beethoven. Ja, diese Namen hat sein Vater erwähnt, daran erinnert er sich. Diese Musik gefällt ihm. Aber auch die Musik, die Papa selbst komponiert, gefällt ihm. Kirchenmusik sei das, hat Papa gesagt und sie der Familie manchmal vorgespielt.
Die Schwestern sind auch musikalisch, er weiß, dass sie helle und klare Singstimmen haben, er hat sie ja schon oft gehört, und in diesem Moment hört er sie wieder, als er die Augen schließt. Kein schöner Land in dieser Zeit und Die Gedanken sind frei. Warum spielen sie eigentlich kein Instrument? Rosi malt, immerzu malt sie, Tiere, Bäume, Blumen. Christel hat gerade eine Lehre als Schneiderin begonnen, die ist den ganzen Tag nicht da, und wenn sie nach Hause kommt, sitzt sie an der Nähmaschine und die kleine Handkurbel, mit der sie sie antreibt, läuft heiß.
Überall liegt Stoff herum, Christel schneidert fast ihre gesamten Anziehsachen. Manche werden auch an andere Leute verkauft. Und Inge? Inge hat überhaupt keine Zeit, denn sie versorgt zusammen mit Mama den Haushalt. „Vier Kinder machen ganz schön viel Arbeit“, hat Mama einmal gesagt. Also muss Inge Mama wohl helfen.
„Wenn Papa wieder da ist, werde ich ganz bestimmt richtig Cello lernen“, nimmt er sich vor. Er hat es früher bereits ein paarmal versucht, sein Vater hat ihm gezeigt, wie das geht, aber er hat dem Instrument nur ein paar quietschende Töne entlocken können. Seine Mutter hat ihn ermutigt, es trotzdem weiter zu versuchen, irgendwann würde es schon klappen, und ihm sogar für jedes Üben eine extra Scheibe Brot versprochen, doch er findet, er sei noch zu klein, um das jetzt schon zu lernen. Er will lieber warten bis der Vater zurückkommt, unter seiner Anleitung ist es bestimmt nicht so schwierig. Schon allein deshalb muss das Cello in der Wohnung bleiben.
Noch immer leeren die fremden Männer die Wodka-Flaschen und beachten Uli nicht. Versonnen streicht er mit der Hand über das glänzende, warme Holz des Cellos. Die Erinnerung an seinen Vater beginnt bereits zu verblassen. „Hoffentlich kommt er bald zurück“, denkt er, „das Cello braucht jemanden, der auf ihm spielt.“
Verzweifelt presst er sein Gesicht an die kalte Fensterscheibe. Es scheint, die verbogenen Waggons seiner Eisenbahn recken sich nach oben, zu ihm hin. Dass alles noch einmal wäre wie damals, das wünscht er sich in diesem Augenblick. Mit der Mutter und den Schwestern gemeinsam singen, Weihnachtslieder, und Papa begleitete sie auf dem Cello.
Weihnachten mit Schnee. Noch einmal Schneeflocken mit der Zunge auffangen, Schneeflocken, die in den Wolken gewohnt haben, deren Weg zur Erde so weit war, und die sich an sein Fenster setzen, so wie in dem Kinderlied.
Die Glocken der Schlosskirche läuten zum Mittagsgebet und die Mutter drängt zum Aufbruch. „Junge, wo bleibst du denn? Wir müssen los!“ ruft sie von unten zu ihm herauf.
Traurig blickt Uli sich ein letztes Mal um. Einsam steht das Cello auf seinem Stachel und lehnt an der Wand neben dem Fenster.
Er hofft inständig, die Russen werden nicht ein zweites Mal versuchen, es hinauszuwerfen. Es muss doch da sein, wenn der Vater zurückkommt.
Worauf soll er denn sonst spielen?
Ursula Buchhorn
Martina Maly
Weltall.Erde.Mensch
Weißt Du, wo Sabine ist? - die Mutter sieht ihre Älteste fragend an.
„Keine Ahnung“ - kommt schnell und desinteressiert zurück.
Mechthild ist mit ihren Gedanken schon wieder im Internat des Lehrerbildungsinstitutes Leipzig. Raus aus der Provinz, darauf hatte sie sehnlich gewartet. Nach Hause kam sie nur noch am Wochenende und das auch nicht regelmäßig. Wie sollte sie also wissen, was ihre jüngeren Geschwister so machten. Das Tuttchen nervte sie allenfalls mit Klavier üben, aber da konnte man ja in den Garten gehen und lesen, jedenfalls im Sommer.
Jetzt also war Sabine weg.
Es war Sonntagvormittag, Tutti hatte Kurrendedienst, die Mutter kochte das Mittagessen und
Sabine war bestimmt nicht in der Kirche, wenn sie nicht musste.
Also, wo ist Sabine?
Hätte die Mutter in den Kinderkleiderschrank gesehen und nach Sabines guten Sachen gesucht, wäre ihr aufgefallen, dass das Konfirmationskleid fehlte. Dieses Kleid war entgegen der Tradition nicht schwarz sondern blau und somit zu vielerlei festlichen Anlässen zu tragen. Noch dazu war es aus dem Westen und allein schon deswegen todchic.
Sabine machte damit auch eine gute Figur in der Reihe der Jugendweihlinge, wie sie mir später erzählte. Denn genau dort war sie an diesem Sonntagmorgen, zur Jugendweihe. Heimlich. Die Mutter hätte es nicht erlaubt, noch dazu 14 Tage nach der Konfirmation! Aber Mütter wissen nie alles. Schon gar nicht, was Töchter um die vierzehn herum so treiben. So fiel auch der Besuch der Jugendstunden unter „Ich gehe zu Karin Kleeberg, Hausaufgaben machen.“ oder „Die Schule hat heute Nachmittag Sammelaktion.“ u.ä.
Dass Sabine ohne Familie zur Jugendweihe kam, fiel schon auf, ging aber im Trubel der Veranstaltung wieder unter. Sie stand jedenfalls stolz mit ihren Klassenkameradinnen auf der Bühne. Davon sind später Fotos aufgetaucht. Alle im großen Kulturhaussaal sahen ihr tolles Kleid. Sabine nahm die Blumen, Urkunde und das Buch „Weltall.Erde.Mensch“ mit einem Knicks entgegen (ein Knicks war noch ganz selbstverständlich).
Dann ging es von der Bühne und die Nächsten wurden aufgerufen.
Als die Feier samt kultureller Umrahmung vorbei war, ging Sabine mit der Familie ihrer Freundin in deren Wohnung und tauschte ihre Kleidung wieder.
Wie es ihr gelang, unserer Mutter ihre Abwesenheit zu erklären, weiß ich nicht mehr.
Ich weiß aber noch, dass meine Schwester einige Zeit später ihr Konfirmationskleid und das Jugendweihebuch nach Hause schmuggelte. Das Buch wurde versteckt und durfte nur angesehen werden, wenn unsere Mutter nicht im Haus war. Ich durfte natürlich auch nichts sagen. Ich habe das Buch gern angesehen, es war spannend. Weltall.Erde.Mensch hatte viele Bilder und alles wurde so gut erklärt: wie die Frösche entstanden und der Kommunismus, die Sterne und die Kinder (das war besonders aufregend).
Ich las oft in dem Buch. Einmal muss ich es wohl nicht wieder gründlich genug versteckt haben – die Mutter fand es. Mit Widmung.
Was da in unserer Mutter vorging, kann man nur ahnen. Besonders, wenn man weiß, mit wieviel Durchsetzungskraft sie unseren protestantischen Standpunkt verteidigte; in der Schule, auf ihrer Arbeit und letztlich vor der Öffentlichkeit.
Christine Herbold-Ohmes
Hans-Jochen Hüchting
Kraftquelle
Prolog
Stine, die in Oldenburg ein Blumengeschäft führt, traf ich nur durch Zufall. Ich wollte meinen ehemaligen Schulfreund Folker mit seiner Frau besuchen. Auf der Suche nach der Straße, in der er wohnt, fiel mir siedend heiß ein, dass ich mein Gastgeschenk, einige Weinflaschen aus der Region, in der meine Frau und ich leben, zu Hause vergessen hatte. Zu Glück hatte ich noch etwas Zeit. Ich stellte meinen Wagen am Rande der alten Innenstadt ab und schlenderte durch die Straßen auf der Suche nach einem Laden, in dem ich etwas für Folker und Sabine würde finden können. Ein älterer Herr, dem offenbar mein suchender Blick aufgefallen war, sprach mich an, ob er mir helfen könnte, und empfahl mir einen Blumenladen in derselben Straße, der von einer Dame betrieben wird, die alle ihre Kunden Stine nennen.
„Der Blumenladen ist sehr besonders“, kündigte er an. „Lassen Sie sich überraschen. Ich bin sicher, dass Sie dort etwas Passendes finden werden.“
Obwohl der Laden nur klein ist, lädt er die Kunden ein, sich an Tischchen, auf eine Fensterbank oder in einen versteckten Winkel zu setzen, den man in dem kleinen Raum gar nicht vermutet. Düfte aromatischer Teesorten verführen dazu, an einem der kleinen runden Tische Platz zu nehmen. Leseproben aus dem benachbarten Buchladen liegen aus, und Kostproben einer benachbarten Confiserie verwöhnen die Gaumen. So werden viele, die bei Stine einen Blumenstrauß gekauft haben, in die benachbarte Confiserie und den Buchladen gelockt, in denen wiederum kostbar zusammengebundene Blumensträuße auf Stines Laden aufmerksam machen. Wer gut einkauft, erhält einen Gutschein für Marios italienische Restaurant am Ende der Straße. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Verweilen.
„Guten Tag! Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr?“, höre ich eine Stimme neben mir. Sie gehört einer kleinen, etwas rundlichen Dame, die mich aufmerksam und einladend anlächelt und deren Augen mich fröhlich und prüfend zugleich mustern.
„Ja, ich bin fremd in dieser Stadt“, antworte ich. „Ich suche einen Blumenstrauß für einen Freund und seine Frau, die mich für heute Abend zu sich eingeladen haben.“
„Ich bin die Inhaberin dieses Geschäfts“, sagt sie. „Wenn Sie mir ein wenig von Ihrem Freund und seiner Frau erzählen, helfe ich Ihnen gern bei Ihrer Suche.“
„Nun, das ist ungewöhnlich“, reagiere ich verwundert.
Ihre Augen strahlen unbefangen. Ich begreife, dass jeder Widerstand zwecklos ist.
„Mit meinem Freund habe ich vor 50 Jahren Abitur gemacht“, setze ich an. „Er ist Architekt, aber nicht mehr berufstätig, engagiert sich jedoch für den Erhalt architekturhistorisch besonders wertvoller Gebäude der Altstadt und fördert zusätzlich viele kulturelle Einrichtungen.“
„Ist sein Name Folker mit F?“, unterbricht sie mich.
„Ja“, bestätige ich. „Kennen Sie ihn?“
„Natürlich“, lacht sie. „Er und seine Frau sind treue Stammkunden von mir. Daher gehen wir wie Freunde miteinander um. Warten Sie einen Augenblick, bitte.“
Sie geht hinter den Tresen und an einen der Tische, die im Verkaufsraum stehen, und kommt mit drei fertig gebundenen Sträußen wieder zu mir.
„Suchen Sie sich einen aus“, fordert sie mich auf. „Sie alle treffen genau den Geschmack der beiden. Bitte, grüßen Sie sie von mir, von Stine.“
„Du warst bei Stine“, lacht Sabine, als ich ihr den Strauß überreiche.
„Ja“, bestätige ich. „Ich soll euch von ihr grüßen.“
„Danke“, sagt Sabine. „Stine ist ein Phänomen. Blumen sind ihre Welt. Ihre Liebe zu ihnen prägt ihren Laden. Das hast du sicher auch bemerkt.“
„Ich bin beeindruckt, mit welcher Sicherheit sie die Blumen herausgesucht hat, die zu euch passen“, ergänze ich.
Während des gemeinsamen Essens kommen wir auf Stine zu sprechen.
„Du schreibst doch Lebensgeschichten“ sagt Folker. „Stines Leben würde dich sicher interessieren und anregen. Man könnte meinen, sie habe ihren Blumenladen schon immer betrieben. Aber das ist nicht so. Ein langer, verschlungener Weg, der sie bis nach Südamerika geführt hat, lag davor. Lange schon sind wir ihre Kunden und kaufen Blumensträuße bei ihr. Aber unsere Beziehung zueinander ist mehr als das. Wir haben uns im Laufe der Zeit so sehr angefreundet, dass sie uns an einigen langen Sommerabenden auf unserer Terrasse in Etappen ihre lange und wechselvolle ihre Lebensgeschichte erzählt hat. Soll ich versuchen, das Wesentliche wiederzugeben?“
„Da hast mich neugierig gemacht“, antworte ich.
„Sei mir nicht böse, Folker“, mischt sich Sabine ein. „Ich meine, Jochen sollte Stine selbst hören.“
Sie wendet sich mir zu.
„Du fährst doch von hier aus an die Nordsee. Kannst du es einrichten, auf dem Rückweg noch einmal bei uns Station zu machen? Ich werde versuchen, ein gemeinsames Abendessen mit Stine bei uns zu organisieren.“
„Das anzunehmen, fände ich ziemlich unbescheiden“, wende ich zögernd ein.
„Nun reicht es aber“, ruft Folker mit gespielter Empörung. „Weißt du nicht, dass niemand Sabine widersprechen sollte?“
Sabine schüttelt lachend den Kopf.
„Du kennst Folker gut genug, um seine Sprüche einzuordnen“, sagt sie. „Im Ernst: Du bist uns sehr willkommen, und wir würden uns wirklich freuen.“
„Abgemacht“, willige ich ein, und wir einigen uns auf einen Termin.
„Ich ruf dich an und sage dir, ob es mit Stine klappt“, verspricht Folker.
Stine wirkt nicht ganz so sicher und selbstbewusst wie in ihrem Laden, als sie mit uns am Tisch sitzt. Aber ihre wachen Augen, die unter kurz geschnittenen üppigen Haaren aus ihrem rundlichen Gesicht mit den rosa Wangen strahlen, und ihr tief aus ihr heraus brechendes Lachen bannen meine Aufmerksamkeit.
„Ich rede nicht so gern über mich selbst“, bekennt sie. „Folker hat mir von Ihnen erzählt und mir Ihr Buch mit Lebensgeschichten zum Lesen gegeben. Ich bin bereit, Ihnen meine Geschichte anzuvertrauen. Aber sie ist zu lang für unseren gemeinsamen Abend. Darum will ich nur in ganz groben Zügen die Stationen anreißen und mich heute auf meine Kindheit beschränken. Nach meiner Schulzeit hat mich das Schicksal als Au Pair nach England verschlagen, wo ich verwöhnte Kinder dafür begeistern konnte, nur mit dem zu spielen, was die Natur ihnen bot, oder sich aus dem, was sie im Garten, im Wald oder auf Wiesen fanden, ihr Spielzeug selbst zu basteln. Später habe ich in Ecuador im Rahmen einer eigenen privaten Initiative einfache Menschen dazu gebracht, ihr Wissen und Können zusammen mit der Expertise eines lokalen Kaufmanns zu selbst gegründeten Unternehmen zu bündeln. Erst nach meiner Rückkehr nach vielen Jahren im Ausland hat meine Liebe zur Natur mir den Weg zu meinem Blumenladen gewiesen, der heute mein Lebensinhalt ist.
Oft habe ich mich gefragt, woraus ich all die Jahre den Mut und die Zuversicht geschöpft habe, mich so früh schon auf meine eigene Füße zu stellen und mich auf meine Kraft und meinen Einfallsreichtum zu verlassen. Heute glaube ich, dass, so widersprüchlich das auch klingen mag, gerade meine in meiner Erinnerung freud- und lieblose Kindheit, in der ich viele Verletzungen und Zurücksetzung erfahren habe, für mich der wesentliche Kraftquell war.“
Stine erzählt