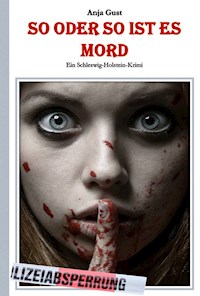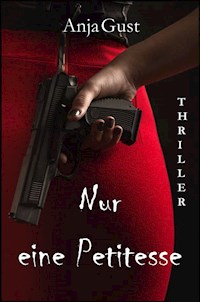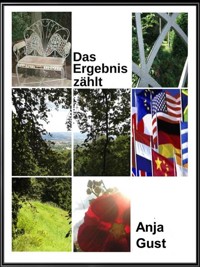5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Krimi, Krabben und ganz viel Meer
Tiefe Wasser und weiße Strände, Schlick und Watt vor einsamen Dünenlandschaften, dazu knorrige und wortkarge Typen, aber nicht minder herzlich und mit dem Herz am rechten Fleck – Meer und Küsten im Norden sind Sehnsuchtsorte. Sie laden ein, am Wasser zu verweilen und eine Auszeit für die Seele zu nehmen. Meer und Küsten sind aber auch Schauplatz von Schauergeschichten, durch Unglücke und Verbrechen – nicht nur im wahren Leben. »Das Wesen des Meeres ist aus dem Tropfen nicht ersichtlich«, schrieb einst Kurt Tucholosky.
27 Krimi-Autorinnen und -Autoren von der Küste nehmen das wörtlich und bereiten mit mörderischen Kurzgeschichten ein kriminelles Lesevergnügen. Hauptsache am Wasser und »bei die Fische«.
Mit Kurzkrimis von Britta Bendixen, Karsten Blaas, Thomas Breuer, Marion Demme-Zech, Reimer Boy Eilers, Christoph Elbern, Manfred Ertel, Renate Folkers, Kurt Geisler, Sylvia Gruchot, Anja Gust, Lars Herlinghaus, Nick Jentsch, Bernhard Klaffke, Cornelia Leymann, Bodo Manstein, Heike Meckelmann, Meike Messal, Sünje Meyer, Ines Müller-Hansen, Doris Oetting, Joachim H. Peters, Jörg Rönnau, Gesa Schröder, Nadine Sorgenfrei, Jacob Walden und Inken B. Weiss.
Diese Anthologie entstand in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren des »Krimi-Kartells«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Fangfrische Küsten-Krimis
27 Kurzgeschichten
Herausgegeben von Anja Gust und Kurt Geisler
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Meike Messal mit Bärenklau Exklusiv, 2025
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau (OT), Gemeinde Oberkrämer. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
www.baerenklauexklusiv.de / [email protected]
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Fangfrische Küsten-Krimis
Rungholts Erbe
Die Lammkeule – frei nach Roald Dahl
Ein ungewöhnlicher Name
Krabben, Koks und coole Typen
Anglerlatein
Südfriesland
Der Nachbar
Die Rache der Punks
Blond und süß
Ein ganz besonderer Friesennerz
Im Bilde
Untiefe
Die Dame in Rot
Echt Helgoländer Koks
Die große Sause
Schöne Aussicht
Der Fehting
Gut versichert
Travemünder Stippvisite
Kaller, Eddie und die Sache mit den Flaschen
Dat fleuht – Die Flut naht
Bis der letzte Vorhang fällt
Rucke di guh, Blut ist im Schuh
All die Namenlosen
Krabben nach Maß
Ein typisch maritimes Verbrechen
Der Putsch
Die Herausgeber
Die Autoren und Autorinnen
Das Buch
Krimi, Krabben und ganz viel Meer
Tiefe Wasser und weiße Strände, Schlick und Watt vor einsamen Dünenlandschaften, dazu knorrige und wortkarge Typen, aber nicht minder herzlich und mit dem Herz am rechten Fleck – Meer und Küsten im Norden sind Sehnsuchtsorte. Sie laden ein, am Wasser zu verweilen und eine Auszeit für die Seele zu nehmen. Meer und Küsten sind aber auch Schauplatz von Schauergeschichten, durch Unglücke und Verbrechen – nicht nur im wahren Leben. »Das Wesen des Meeres ist aus dem Tropfen nicht ersichtlich«, schrieb einst Kurt Tucholosky.
27 Krimi-Autorinnen und -Autoren von der Küste nehmen das wörtlich und bereiten mit mörderischen Kurzgeschichten ein kriminelles Lesevergnügen. Hauptsache am Wasser und »bei die Fische«.
Mit Kurzkrimis von Britta Bendixen, Karsten Blaas, Thomas Breuer, Marion Demme-Zech, Reimer Boy Eilers, Christoph Elbern, Manfred Ertel, Renate Folkers, Kurt Geisler, Sylvia Gruchot, Anja Gust, Lars Herlinghaus, Nick Jentsch, Bernhard Klaffke, Cornelia Leymann, Bodo Manstein, Heike Meckelmann, Meike Messal, Sünje Meyer, Ines Müller-Hansen, Doris Oetting, Joachim H. Peters, Jörg Rönnau, Gesa Schröder, Nadine Sorgenfrei, Jacob Walden und Inken B. Weiss.
Diese Anthologie entstand in Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren des
»Krimi Kartells«.
***
Fangfrische Küsten-Krimis
Rungholts Erbe
Jörg Rönnau
Wattenmeer
An der Nordsee strahlte die warme Sonne über dem Watt. Im Westen flimmerten die Hallig Südfall und das karge Eiland Süderoogsand wie eine Fata Morgana über der Meeresoberfläche. Weit entfernt am Horizont zog die Silhouette eines Krabbenkutters dahin, der aus seinem Fanggebiet in den Heimathafen zurückkehrte. Im Nordwesten lag Pellworm. Seevögel zogen kreischend umher. Möwen, Brachvögel, Strandläufer, Kiebitze und wie sie alle hießen. Nur eine leichte Brise strich sanft von der Nordsee her über das Land. Im Osten, etwas über einen Kilometer entfernt, bewegten sich weiße Punkte auf dem Grün, die für diese Gegend so typischen Deichschafe. Zudem drehten sich dort überall Windräder. Bei diesem schönen Wetter entpuppte sich das nordfriesische Wattenmeer als ein idyllischer Traum, Natur pur.
Und dann waren da noch diese Handvoll Frauen und Männer, die mit merkwürdigen Messgeräten auf hochachsigen Handkarren durch den Schlick taperten und deren Gummistiefel dabei schmatzende Geräusche verursachten, sodass sich sämtliche Wattwürmer und Muscheln vor Schreck noch tiefer in den Boden bohrten.
Einer von ihnen war Hinnerk Brodersen, der nicht wusste, warum er sich dieses Ding in die Tasche gesteckt hatte. Normalerweise meldete er jeden Fund dem Grabungsleiter, aber dieses Medaillon, das dort wahrscheinlich seit Hunderten von Jahren im Watt lag, bestimmte plötzlich sein ganzes Denken und Handeln. Schwups, war es in seiner Jackentasche verschwunden und jedes Mal, wenn Brodersen diese Scheibe hervorkramte und in die Hand nahm, fühlte er sich eigenartig stark, fast schon allmächtig. Ihn durchströmte ein wunderbares Glücksgefühl, so, als hätte er Schmetterlinge im Bauch, wie damals, als die Liebe zu Marlies noch frisch war und sie jeden Tag mehrmals miteinander schliefen. Gleichzeitig lief ihm lief ihm beim Berühren des Medaillons jedoch auch stets ein Schauer über den Rücken und er konnte sich all dies nicht erklären.
Er wusste nicht warum, aber dieses Ding aus Bronze, so groß wie ein Bierdeckel faszinierte ihn sofort. Auf der einen Seite prangte ein Pentagramm, ein sogenannter Drudenfuß, manche nannten es auch Teufelsfuß; auf der Rückseite befanden sich Schriftzeichen, die an Runen erinnerten. Aber Brodersen kannte Runen und konnte sie eigentlich entziffern, denn als ein in Norddeutschland beheimateter Archäologe, sollte er sich mit dieser uralten Schriftform der Germanen und Wikinger auskennen, aber diese Zeichen waren ihm fremd, erschienen ihm weitaus älter als Runen. Wahrscheinlich sogar uralt. Vielleicht war dies so eine Art sumerischer Keilschrift. Manchmal meinte er, diese Buchstaben würden anfangen, sich zu bewegen, phosphoreszierten im Dunkeln und bisweilen konnte er sie sogar sprechen hören, dann schüttelte er stets erschrocken den Kopf und der Spuk verschwand.
Immer wieder dachte er daran, wie alles begann. Vor etwas weniger als einem Monat befand er sich mit Kollegen vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein im nordfriesischen Wattenmeer in der Nähe der Hallig Südfall. Durch einen Hallig-Bewohner wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass durch veränderte Gezeitenströme in den Prielen neue Grundmauern freigespült wurden, die sich schnell als der Grundriss einer Kirche herausstellten. Zudem fanden sie die Reste von mehreren Häusern und die Sensation war perfekt. Er und seine Kollegen hatten den Standort der sagenumwobenen mittelalterlichen Stadt Rungholt gefunden, die am 16. Januar 1362 bei der zweiten Marcellusflut, der sogenannten Groten Mandränke zerstört wurde und auf Nimmerwiedersehen in den Fluten des Blanken Hans, der von schweren Orkanen sturmgepeitschten Nordsee, verschwand. Viele Sagen umgaben dieses Ereignis und die Stadt. Es hieß, ihre Einwohner seien so wohlhabend und dekadent gewesen, dass sie Gott, Kirche, Fürsten und die Naturgewalten verspotteten und ihre Religion der Mammon gewesen sei. Dieses Rungholt hatten sie nun wiederentdeckt, was auch international großes Aufsehen erregte.
Brodersen befand sich damals auf dem Areal der Kirche, grub an der Stirnseite des ehemaligen Gebäudes, dort, wo sich einmal der Altar befunden haben musste. Genau dort schimmerte etwas Güldenes im Moder eines Priels. Schnell spülte er den Gegenstand mit dem Salzwasser der Nordsee frei und ihm stockte der Atem, als er das Pentagramm erkannte und schnell einsteckte. Erst am Abend, als er allein in seiner winzigen Mansarde der Husumer Pension am Tisch saß, kramte er das Medaillon wieder heraus, säuberte es im Waschbecken des Bades, legte das bronzene Ding auf den Tisch und bestaunte den Fund, konnte sich aber immer noch nicht erklären, warum er es einfach verschwinden ließ. So etwas hatte er noch niemals zuvor getan.
Bereits in der ersten Nacht bemerkte Brodersen etwas Merkwürdiges. Er konnte nicht einschlafen, denn ein zunehmender Vollmond schien durchs Fenster, als er plötzlich ein Leuchten auf dem Tisch wahrnahm. Schnell stand er auf, um nachzusehen und tatsächlich, diese Scheibe phosphoreszierte, besser gesagt, das darauf befindliche Pentagramm. Zuerst erschrak er, nahm es aber trotzdem in die Hand und schaute auf die Rückseite. Auch die Runen drehten sich, tanzten regelrecht auf der Scheibe herum. Schnell schüttelte Brodersen den Kopf und der Spuk verschwand wieder. Verwirrt schaute er aus dem Fenster und konnte im dämmrigen Licht erkennen, dass gerade ein Fischkutter Richtung Nordsee durch den Hafen tuckerte.
Als am nächsten Morgen um 5:30 Uhr der Wecker klingelte, konnte er sich an die nächtliche Begebenheit erinnern, schmunzelte jedoch und hielt es für einen seltsamen Traum, oder hatte er in jungen Jahren zu viel Indiana Jones geschaut? Nun musste er über sich selbst lachen.
Brodersen verbarg das Medaillon ganz unten in seiner Reisetasche und machte sich auf den Weg in den Speisesaal zum Frühstück, wo zwei seiner Kollegen bereits auf ihn warteten und über den dicken Arsch einer Kellnerin frotzelten. Danach fuhren sie mit einem Kutter zur Ausgrabungsstelle, wo sie nur ein paar Stunden während der Ebbe arbeiten konnten. Immer wieder dachte er an seinen Schatz, konnte seiner Arbeit kaum nachgehen, gaukelte den anderen Mitarbeitern irgendwann starke Kopfschmerzen vor, simulierte eine beginnende Grippe und wollte deswegen seine Kollegen nicht in eines der Restaurants am Husumer Marktplatz begleiten. Stattdessen verkroch er sich in seine Mansarde und starrte unentwegt auf das bronzene Ding.
Am nächsten Tag meldete er sich beim Grabungsleiter endgültig krank, setzte sich bereits früh in sein Auto, preschte mit überhöhter Geschwindigkeit zurück nach Kiel. Allerdings wurde er auf der A7 ausgebremst. Wieder einmal quälte sich der Verkehr dort wegen einer der vielen Baustellen kilometerlang nur im Schritttempo dahin. Nach geschlagenen zweieinhalb Stunden erreichte Brodersen endlich die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt, wo ihn erneut ein Stau an einer Großbaustelle auf der B 76 drosselte. Erst nach weiteren dreißig Minuten erreichte er die Universität, wo er ein paar Formalitäten erledigte. Danach fuhr Brodersen in seinen Heimatort nach Laboe und ließ sich von seinem Hausarzt ein paar Tage krankschreiben. Vom Hunger geplagt, fuhr er noch schnell hinunter zum Hafen des Ostseebades, wo er bei Tally’s Fischbrötchen zwei Matjes mit Kartoffelsalat und eine Flasche Flens bestellte. Der Laden war wie immer voll mit Touristen, aber auf einer anliegenden Parkbank fand er noch ein Plätzchen im Schatten einiger Bäume, deren Blätter im Ostseewind rauschten. Beim Ploppen des Bügelverschlusses schaute er über die Kieler Förde, auf der es von Segelschiffen nur so wimmelte. Die Sonne strahlte von einem hellblauen Himmel herunter. Auf der Berlin, dem Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger standen zwei Männer in roten Overalls am Bug, klönten und lachten herzhaft zusammen mit dem Laboer Bürgermeister, der der Crew gerade eine Stippvisite erteilte. Außerdem liefen zwei Containerfrachter von der Ostsee kommend Richtung Holtenauer Schleuse, um den Nord-Ostsee-Kanal zu passieren.
Schnell verschlang Brodersen sein Mittagessen. Eigentlich mochte er die maritime Atmosphäre des kleinen Ostseehafens, saß hier gerne zusammen mit Marlies, denn sie liebten es, sich die Schiffe auf der Förde anzusehen und dabei über die viel besuchte Strandpromenade zu flanieren, lästerten dabei gerne über die unzähligen Badegäste, die sich am Sandstrand wie die Ölsardinen in der Sonne aalten und waren gleichzeitig froh, dort zu wohnen, wo andere Urlaub machten. Aber heute konnte er nur einen einzigen Gedanken fassen und der drehte sich um dieses bronzene Ding aus dem Watt, seinen Schatz!
In seinem Haus angekommen, packte er sofort das Medaillon aus und legte es andächtig auf den Wohnzimmertisch. Seine Frau Marlies würde erst um sechzehn Uhr aus dem Büro zurückkommen und wäre sicherlich überrascht, ihn hier vor dem Wochenende anzutreffen.
Immerzu streichelte er liebevoll über das Pentagramm und die Runen. Zärtlich murmelte er dabei einige Male »mein Schatz«, dachte unwillkürlich an diesen hässlichen Knilch Gollum aus »Herr der Ringe«, der diesen vermaledeiten Ring ebenfalls ständig »mein Schatz« nannte und schmunzelte.
Plötzlich begann die Bronze erneut zu leuchten und zum ersten Mal hörte er diese dunkle Stimme in seinem Kopf, die ihm eindeutig und klar befahl, im Internet nach einem gewissen Pfarrer Magnus Mauritzen zu recherchieren. Auch eine Jahreszahl nannte die imaginäre Stimme: ANNO 1353.
Schnell legte er das Ding zurück auf den Tisch und sagte: »Was ist das für ein Mist? So ein Blödsinn!«, woraufhin er in die Küche ging, um sich einen Kaffee zu kochen. Vielleicht half der ihm, wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Gleichzeitig schaltete er das Notebook auf dem Küchentisch ein und suchte in der Datenbank des Landesmuseums Gottorf in Schleswig nach dem Namen. Dort, im Intranet des Instituts, stieß er in einer digitalisierten Bibliothek auf ein mittelalterliches Werk namens »ANNALES FRISIORUM SEPTENTRIONALIUM« (Maritime Chronik Nordfrieslands), das im 15. Jahrhundert von einem gewissen Bartholomäus von Balmau, Abt im Kloster zu Husum, verfasst wurde. Dieser erwähnte den Namen gleich mehrfach und Brodersen konnte kaum glauben, was er dort auf dem Monitor las, denn sogar die Jahreszahl stimmte. Drehte er nun durch, oder spielte ihm sein Verstand einen Streich? Befasste er sich beruflich zu sehr mit diesem Thema? Immer wieder schlürfte er an seinem Kaffee und las.
ANNO 1353 wurde Magnus Mauritzen vom Lübecker Bischof Bertram Cremon quasi strafversetzt und zum Pfarrer von Rungholt ernannt. Mauritzen entpuppte sich als Querulant, der sich sogar mehrerer Straftaten schuldig gemacht hatte und durch die Hilfe eines Kardinals aus Köln in letzter Minute der Verfolgung durch die Inquisition nach Friesland entkam! Abt Bartholomäus von Balmau wusste ebenfalls zu erzählen, dass dieser Magnus Mauritzen in Rungholt sein Unwesen trieb und bei den Bewohnern wegen seines Jähzorns als äußerst unbeliebt galt. Sogar der damalige Rungholter Bürgermeister beschwerte sich mehrfach bei seinem Landesfürsten sowie den Bischöfen in Hamburg und Lübeck.
Kurz vor dem Unglück, der Groten Mandränke, soll Mauritzen in der Kirche satanische Messen mit mehreren Adepten abgehalten haben und Zeugen wussten zu berichten, dass dieser Pfarrer das Meer und die Sturmflut regelrecht herbeigerufen hätte.
Zudem konnte Brodersen etwas von einer bronzenen Scheibe lesen, die anscheinend aus einem Grab im Morgenland stammte und neben einer uralten Mumie gefunden wurde, aber genau an der Stelle hatte jemand eine halbe Seite aus dem Buch herausgerissen, sodass ein Weiterlesen nicht möglich war.
Konnte das vielleicht sogar das Medaillon sein? Sein Schatz? Die Beschreibung in der alten Schrift traf darauf zu … aber … war so etwas tatsächlich möglich … nein … oder doch?
Mit zittrigen Fingern schaltete Brodersen den Rechner aus. Mumie, Grab, Morgenland, Mandränke, Medaillon, Mauritzen, Mittelalter, all das spukte in seinem Kopf herum und er konnte keinen klaren Gedanken fassen.
Er ging zum Tisch und schaute sich die bronzene Scheibe nochmals an. Erneut begannen die Runen zu leuchten, diesmal sogar noch heller und die Stimme befahl ihm: Berühre mich. Er dachte an das wohlige Glücksgefühl, das ihn jedes Mal durchströmte. So wunderschön.
Langsam näherten sich seine Finger der Scheibe. Genau in dem Moment, als er die Bronze berührte, spürte er wieder die Schmetterlinge in seinem Bauch, so herrlich war das Gefühl. Er führte das Medaillon Richtung Herz und drückte es an seine Brust … überglücklich … mein Schatz …
Blitzartig durchfuhr ihn plötzlich ein bestialischer Schmerz, sodass er laut aufschrie und wie vom Schlag getroffen zusammenbrach. Er hörte auf einmal Tausende gequälter Stimmen, die alle zusammen in unermesslichem Leid jammerten, sie seien die in alle Ewigkeit gefangenen Seelen eines diabolischen Dämons, eines jahrtausendealten Dschinns aus den tiefsten Tiefen der Unterwelt, der sie auch nach dem Tod noch bestialisch quälen würde … dann wurde alles schwarz um Brodersen herum und er verlor die Besinnung.
Nur wenige Stunden später wunderte sich Marlies Brodersen darüber, dass der Wagen ihres Mannes bereits im Carport des Laboer Einfamilienhauses stand, wollte er doch erst am Wochenende aus Nordfriesland zurückkehren. Verwundert öffnete sie die Haustür und ging hinein.
»Hinnerk!? Bist du zu Hause? Ist alles in Ordnung mit dir? Bist du krank? Liebling, wo bist du?«
Sie bemerkte ihn im Wohnzimmer. Er saß mit dem Rücken zu ihr auf der Ledercouch. Ein seltsames violettes Licht umgab ihn und er knurrte. Sie erschrak darüber zutiefst und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Hier stimmte etwas ganz und gar nicht.
»Hinnerk …«
Als sie ihn an der Schulter berührte, schoss er abrupt herum und eine wilde Bestie, mit riesigen Fangzähnen und einem vor Speichel geifernden Maul sprang sie an. Nur wenig später lag sie tot in ihrer eigenen Blutlache. Marlies spürte keinerlei Schmerzen, es hatte nur kurz geknackt, als das Monster ihr die Halswirbel brach und die Haut mit seinen scharfen Krallen zerfetzte. Wäre jemand dabei gewesen, hätte derjenige später zu Protokoll gegeben, dass man die ganze Zeit über das Meer und den Wind heulen hörte, so, wie während einer schweren Sturmflut … oder wie der Schrei einer wilden Bestie, die aus der Unterwelt entfesselt wurde.
Eine Woche später fand man im Wattenmeer vor der Hallig Südfall eine nackte Männerleiche. Sie lag genau an der Stelle, an der sich einmal der Altar der Rungholter Kirche befunden haben musste. Später stellte sich heraus, dass dieser Mann ein angesehener Mitarbeiter des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein war, dessen Ehefrau erst vor ein paar Tagen auf bestialische Weise ermordet und von einer Nachbarin gefunden wurde. Der Ehemann galt zuerst als vermisst, nun lag er hier, splitterfasernackt im Schlick der Nordsee.
Hauptkommissar Jens Klüver von der Kieler Mordkommission plagten furchtbare Zahnschmerzen und er verfluchte sich selbst für seine vermaledeite Zahnarztphobie. Nun hatte er den Salat dafür, dass er bereits mehrere Jahre nicht mehr zur Kontrolle beim Dentisten war, zudem musste er nun auch noch an die Westküste, um sich diese Geschichte mit dem toten Archäologen aus Kiel anzusehen. Wattwanderer hatten den nackten Leichnam am gestrigen Nachmittag entdeckt. Wegen der beginnenden Flut blieb jedoch nicht viel Zeit, um die Kollegen der Spurensicherung dorthin zu schicken. Deshalb hatten Beamte der Küstenwache den Mann geborgen und ihn vorerst in die Kühlkammer eines Bestatters nach Husum gebracht. Von dort aus würde er noch heute in die Rechtsmedizin nach Kiel überführt werden, denn dass es sich hier um einen grausamen Mord handelte, war mehr als offensichtlich. Der Leichnam wies multiple Verletzungen auf, so, als sei er von einem wilden Tier angefallen worden. Zudem wurden ihm die Halswirbel gebrochen. Fast vollständig identisch mit dem Mord an der Ehefrau des Mannes, dessen Fall Klüver ebenfalls bearbeitete.
Nun kam Klüver gerade vom Bestatter, wo er sich den Leichnam des Mannes angeschaut hatte, aber er musste sich sputen. Im Husumer Hafen wartete bereits ein Schiff der Wasserschutzpolizei auf ihn, denn er wollte sich den Fundort unbedingt selbst ansehen. Dazu blieb nun wegen der Gezeiten nur wenig Zeit. Der Beamte der Küstenwache meinte, das Zeitfenster würde nur höchstens zwei Stunden betragen.
Im Hafen angekommen begrüßten ihn die Beamten des Schiffes und sie legten ab. Die Fahrt bis zum Fundort dauerte etwas weniger als eine halbe Stunde. Allerdings konnten sie wegen des ablaufenden Wassers nicht bis zum ehemaligen Rungholt fahren, sondern stoppten die Motoren in einem tiefen Priel, der sich fünfhundert Meter davon entfernt befand. Klüver und zwei Beamte kletterten über die Bordwand und mittels einer Leiter hinunter aufs Watt. Während sie gingen, hinterließen ihre Gummistiefel schmatzende Geräusche im Moder. Angekommen informierte einer der Beamten Klüver über den genauen Fundort der Leiche, danach zogen sich die beiden ein Stück zurück, unterhielten sich und rauchten.
Klüver marschierte unterdessen im Gelände herum, schaute hier, schaute dort und sinnierte, verfluchte sich gleichzeitig, dass es eine blöde Idee gewesen sei, hierher zu kommen, denn die Flut hatte alle verwendbaren Hinweise mitgenommen. Gleichzeitig strich er sich immer wieder über die Wange, der Backenzahn tat höllisch weh, trotz mehrerer starker Schmerztabletten.
Plötzlich bemerkte er, dass in einiger Entfernung etwas durchs Sonnenlicht im Wasser aufblinkte. Zielstrebig marschierte er darauf zu, kniete sich nieder und zog ein bronzenes Medaillon aus dem Priel, während gleichzeitig über ihm ein Schwarm kreischender Möwen Richtung Norden dahinzog. Auf der einen Seite des Fundstückes befand sich ein Pentagramm, auf der anderen erkannte er Buchstaben, die aussahen wie Runen. Das ganze Ding schien von innen her zu leuchten, oder spiegelte sich nur die Sonne darauf? Außerdem meinte er, als bewegten sich die Zeichen darauf, nein, es war eher als kreisten sie um sich selbst. Hektisch blickte er sich um. Die Kollegen der Wasserschutzpolizei standen etwa einhundert Meter weit entfernt und unterhielten sich darüber, ob der HSV wohl in diesem Jahr endlich wieder in die 1. Bundesliga aufsteigen würde. Sie beachteten ihn nicht.
Er berührte die Scheibe und schaute sie genauer an, im selben Moment verschwanden auf unerklärliche Weise die Zahnschmerzen. Verwundert fasste sich Klüver an die Wange. Wirkten die verdammten Tabletten endlich oder sollte ihm dieses merkwürdige Ding Glück bringen? Schwups, ohne zu wissen warum, steckte Klüver die Scheibe schnell in seine Jackentasche. Sie fühlte sich so warm und angenehm an, so unendlich warm. Ihn durchfuhr ein Gefühl, als hätte er Schmetterlinge im Bauch. Dieses Medaillon war etwas ganz Besonderes, ein …
So ein Schatz, so ein wunderbarer Schatz, dachte Klüver und freute sich darauf, die Scheibe abends genauer in Augenschein zu nehmen.
Die Lammkeule – frei nach Roald Dahl
Cornelia Leymann
Kiel
Manchmal kann man wirklich nichts dafür. Meist schon, aber manchmal eben auch nicht. Du weißt, wovon ich rede. Das fängt schon im Kleinkindalter an. Erst ist der Wortschatz begrenzt und man muss mit den Worten Mama und Papa auskommen, kann froh sein, wenn man sie richtig einsetzt und nicht mit einem begeisterten Papapapa hinter dem Briefträger herstolpert. Aber dann geht es Schlag auf Schlag. Auto, Ticktack, HappaHappa, all diese Zweisilber und Dopplungen des täglichen Gebrauchs und dann der erste Höhepunkt: NEIN. Und ziemlich bald danach die ersten Drei-Wort-Sätze, sozusagen der erste Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes. Und auch hier wieder ein Höhepunkt: ICH WAR’S NICHT. Aber ich muss zugeben, ein Nein nützt meist wenig und ein ich war’s nicht stimmt selten.
Nun, warum erzähle ich dir das? Ja eben, weil Silvi anscheinend dieses Wissen aus früher Kindheit im Laufe ihres bisher recht kurzen Lebens völlig vergessen hat. Wie sonst lässt es sich erklären, dass sie vor dem Pastor ein Ja gehaucht hat, wo doch ein Nein ihre letzte Chance gewesen wäre. Aber nein, sie sagt Ja. Hat ein weißes Kleid an, einen Schleier auf dem Kopf, sogar ein kleines Krönchen zum Festhalten obendrauf, fühlt sich schön wie nie und bedankt sich für all dieses Schöne mit einem Ja. Ich weiß, du schüttelst jetzt den Kopf über so viel Naivität, aber sie weiß es eben nicht besser. Und wer es nicht besser weiß, tut, was von ihm erwartet wird. Und wer mit Schleier und weißem Kleid vor dem Traualtar steht, von dem wird ganz klar ein Ja erwartet.
Und jetzt hat sie den Salat. Na, ja nun, so richtig Salat natürlich nicht. Immerhin ist sie verheiratet, was man von den meisten Mädels in ihrem Alter noch nicht sagen kann. Obendrein mit einem Mann, der was darstellt. Sagt man so: er stellt was dar, ist Staatsanwalt am Strafgericht, obendrein ein gefürchteter. Bei ihm haben die bösen Buben nichts zu lachen – und die bösen Mädels auch nicht.
Da kann sie von Glück sagen, dass sie ein liebes Mädchen ist, total lieb sogar. Bleibt ihr auch gar nichts anderes übrig. So von der Schule weg geheiratet, da hat man nichts – von Haushalt und Mann einmal abgesehen. Und ihm gefällt’s. Wenn ihr Heinz nach Hause kommt, ist alles picobello. Gestaubsaugt von oben bis unten, die Fensterscheiben glasklar, das Bad die reinste Freude, die Wäsche gewaschen, die Hemden gebügelt, alles ganz großartig. Sogar seine Strümpfe, die er abends immer als erstes auszieht, weil er so heiße Füße hat, dass er im Gerichtssaal manchmal verrückt werden könnte, also sogar seine qualmenden Socken sind am nächsten Tag weggeräumt, obwohl ich sagen muss, dass das eigentlich eine Zumutung ist und er die weiß Gott selbst dezent im Wäschepuff entsorgen könnte. Tut er aber nicht und braucht er ja auch nicht, denn am nächsten Abend – wie gesagt – alles wieder picobello.
Warum auch nicht? Sie hat ja sonst nichts zu tun. Da kann sie ruhig mal seine stinkigen Socken unter dem Sofa hervorklauben. Und sie tut es. Aber nun ist sie schon vier Monate, drei Wochen und fünf Tage verheiratet. Das sind 158 Paar Socken. In Bücken und Unter-dem-Sofa-Nachsehen gerechnet sogar schon an die 200 Mal, denn er streift seine Strümpfe nicht in eins von den Füßen. Eine Socke liegt immer mal woanders.
»Schatz«, sagt sie, setzt sich zu ihrem Heinz auf die Lehne seines Sessels und krault ihm den Nacken. Das macht sie meistens, weil sie sich so freut, dass er nach ihrem langweiligen Tag endlich nach Hause gekommen ist. »Was hältst du von einem Weinchen vorm Essen?«
»Hmm«, sagt er und wenn er »Hmm« sagt, weiß sie schon: Er hat sich Arbeit mit nach Hause genommen. So ist das bei Staatsanwälten, und bei gefürchteten besonders. Die tragen ihre Fälle bis ins Wohnzimmer. Geht nicht anders, hat er gesagt. Die Personaldecke wird immer dünner, hat er erklärt. Da kann er froh sein, wenn er wenigstens am Sonntag mal zur Ruhe kommen kann, hat er gestöhnt. Aber bei so einem guten Gehalt, wie er es kriegt, muss man halt Opfer bringen, hat er gelächelt.
Das sieht sie natürlich ein. Sie sieht alles ein, was er sagt. Er sagt viel, lässt sie teilhaben an seinem aufregenden, staatsanwaltlichen Leben. Wie oft hat er ihr die Fälle, mit denen er sich herumschlagen muss, haarklein auseinander klabüstert; von der Frau erzählt, die ihren Mann vergiftet hat. »Kann man drauf wetten, dass bei Gift die Gattin im Spiel war. Andere Möglichkeiten haben Frauen nicht, den Ehemann aus dem Weg zu räumen.«
Oder die Geschichte von dem Mann, der seine Frau erstochen hat, weil sie untreu geworden ist. Geleugnet bis zum Schluss, der Mann. Aber er hat ihn drangekriegt, hat ihm das Messer unter die Nase gehalten. Da war er fällig. Wo gibt es denn so was, die eigene Frau umbringen, nur weil sie fremd gegangen ist.
Sie liebt es, wenn er erzählt. Ihr Leben zwischen Staubsauger, Putzmopp und Seifenlauge ist nicht wirklich spannend, deshalb fiebert sie immer dem Augenblick entgegen, wenn sie die Reifen von seinem Mercedes auf dem Kies der Auffahrt hört und weiß, dass er jetzt gleich zur Tür reinkommt. Ist ja nicht wirklich verwunderlich. Eine Frau freut sich immer, wenn ihr Mann heimkommt. Zumindest, wenn sie erst vier Monate, drei Wochen und fünf Tage verheiratet ist. Später mag sich das etwas verschieben und die Ehefrau ist vielleicht froh, wenn er mal zwei Wochen weg auf Dienstreise ist. Aber – sagen wir mal – in den ersten ein, zwei Jahren, da freut sich die Frau noch. Und Silvi freut sich besonders. Eben wegen Staubsauger und Seifenlauge und so.
»Die Mordwaffe«, sagt Heinz und gibt ihr einen kleinen lustigen Stups mit dem Zeigefinger auf die Nase, »die Mordwaffe ist immer das A und O. Aber neulich. Wie verhext. Ich hab die ganze Bude auf den Kopf stellen lassen. Keine Mordwaffe. Wir mussten den Kerl wieder laufen lassen.«
Sie strahlt ihn an. Wie spannend er erzählen kann. Aber das Strahlen ist leider falsch. Strahlen nur bei Erfolg. Wenn er von Misserfolgen erzählt, dann muss sie traurig gucken, das weiß sie. Jetzt, nach vier Monaten, drei Wochen und fünf Tagen, weiß sie das. Im Grunde weiß sie das schon seit langer Zeit. Das hat sie fast gleich am ersten Tag, also genau genommen drei Monate, zwei Wochen und drei Tage vor der Sache mit dem Schleier und dem Traualtar, gemerkt.
»Mitjammern«, nennt sie das insgeheim. Bei dem Hasch-Verkäufer, den man in seiner Wohnung mit seiner Grammwaage und den hunderttausend kleinen Tütchen sozusagen auf frischer Tat ertappt hat, ist Mitgefühl »der arme Kerl, muss zwei Jahre in den Bau und wenn er wieder draußen ist, ist das mit dem Hasch vielleicht schon legal« ganz falsch. Da ist Freude angesagt: wie wundervoll, dass der von der Straße ist und den armen Kindern keine Joints mehr andrehen kann.
Wenn Heinz dagegen erzählt, dass sein Wagen ums Verrecken nicht angesprungen ist, dann ist Mitgefühl total richtig: wie schrecklich, was hast du da nur gemacht, ich wäre gestorben vor Angst. So was in der Art. Da wären Einwände ganz falsch: vielleicht wäre gleich einer gekommen und hätte dich angeschoben oder hast du einen Kollegen gefragt, ob der ein Starterkabel hat. So was geht gar nicht. Dann flippt Heinz aus, beschimpft sie, fragt, ob sie mal wieder alles besser weiß und wer hier wohl das Geld ranschleppt, damit sie ein gemütliches Leben hat.
Ein richtiges Sensibelchen kann er dann sein, der große Herr Staatsanwalt. Aber so was, wie das vor zwei Monaten, einer Woche und zwei Tagen wird ihr nie wieder passieren. Das will sie nie wieder erleben. Da gibt sie lieber klein bei, selbst wenn sie ihm erklären könnte, dass sie gar nicht gestrahlt hat, weil die Mordwaffe nicht gefunden wurde, sondern wegen des kleinen Stupses, den er ihr auf die Nase gegeben hat. Sie mag das. Sie mag es überhaupt, wenn er sie anfasst. Wenn sie ganz ehrlich ist, hätte sie sogar gedacht, dass Eheleute sich ständig anfassen. Natürlich nicht vor der Ehe. Da war klar, dass er sich zurückgehalten hat. Schließlich ist er um einiges älter als sie, hat sicher jede Menge Erfahrung und wollte sie nicht unsittlich bestürmen. Hat ihre Jungfräulichkeit geachtet, ganz genau so, wie sie es in ihren Romanen liest, wo auch immer der Graf bis zur Ehe wartet, bevor er die Gouvernante seiner beiden Kinder in die Liebe einführt. Ja, so steht das in ihren Büchern: in die Liebe einführen. Total romantisch findet sie das.
Wenn du jetzt sagst, was liest das Gör denn da für einen Schund, dann muss ich dir natürlich recht geben, aber genau betrachtet sind die Zeiten von Courths-Mahler eben doch noch nicht ganz vorbei und auch auf der Spiegel-Bestsellerliste könnte ich dir Titel nennen – da sind manchmal Geschichten dabei – heile Welt von vorne bis hinten, ganz rührend. Und was soll man machen. so was liest sie eben gern und so was liest sie viel. Denn das Haus ist nicht so groß, dass es sie den ganzen Tag auf Trab hält und mit dem Garten hat sie gar nichts zu tun. Dafür kommt ein Gärtner. Heinz will sie da nicht rumschnippeln lassen. Nachher ist die Hecke ganz schief.
Deshalb liest sie, wenn er nicht da ist, von der heilen Welt. Die gehörige Portion Mord und Totschlag bekommt sie von ihm und seinen Geschichten.
»Schatz«, sagt sie, nachdem sie findet, dass sie nun ihr Strahlen lange genug korrigiert und stattdessen traurig geguckt hat wegen des nicht gefundenen Hackebeilchens, »Schatz, warum haben wir eigentlich dieses Haus. Das ist doch viel zu groß für zwei Leute.« Abrupt ändert sich seine Stimmung. Eben noch mit Feuer und Flamme voll im Mord an der Prostituierten wird er still und quetscht nur ein »das ist schließlich mein Elternhaus. Hier wohne ich schon immer und auch jetzt, seit sie tot sind« heraus. Dabei schaut er ganz düster, das mag sie gar nicht. Dann bekommt er diesen scharfen Zug um die Mundwinkel, richtig gruselig wird ihr dann.
Sie kuschelt sich noch dichter an ihn, als sie merkt, dass sie da wieder was Falsches gesagt hat. Aber mit dem Kuscheln hat er es nicht so. Nicht dass er abrückt, nein das nicht. Nur, er kuschelt eben nicht zurück, wie sie es aus den Büchern kennt. Bleibt einfach stocksteif sitzen. Manchmal hat sie den Eindruck, dass er nur wartet, bis ihr Kuschelanfall endlich vorbei ist.
»Oben hätten wir genug Platz für ein Kinderzimmer«, sagt sie wie in Gedanken und krault seinen Nacken. »Oben hab ich mein Arbeitszimmer«, sagt er. »Ja, aber es wäre trotzdem noch Platz da für ein Kinderzimmer.« Sie lässt einfach nicht locker und da muss ich sagen, das ist jetzt wirklich ungeschickt von ihr, wenn er so düster guckt und seinen scharfen Zug um die Mundwinkel kriegt. Ausgesprochen ungünstig, so was.
Aber kommt vor. Vor allem bei Frauen, die nun schon acht Monate, vier Wochen und zwei Tage darauf warten, dass was passiert. Also sagen wir mal: sexuell was passiert. Nicht gleich das Schlimmste, nur eben so ein bisschen was. Wenn solche Frauen einen Mann haben und damit den Sex zum Greifen nah immer vor der Nase und dürfen nicht zugreifen – schlimm so was. Ähnlich wie die Sache mit dem Esel und der Mohrrübe. Der will auch die Rübe haben und läuft im Kreis hinterher. Aber anders als der Esel haben solche Frauen dann irgendwann das Gefühl: Nun ist aber mal gut mit der Im-Kreis-Lauferei und greifen sich die Rübe.
Nachher ist sie richtig froh, dass sie nicht nach der Rübe gegriffen, sondern sich nur die Bluse aufgeknöpft hat. »Schatz«, sagt sie nach dem vierten Knopf, »ich will ein Kind.«
»Aber doch wohl nicht jetzt«, antwortet er. »Und lass das«, fügt er mit bösem Blick auf die geöffnete Bluse hinzu. Vielleicht hast du so was auch schon mal erlebt. Man sitzt da mit halb raushängendem Busen und der Mann schaut nur böse und will nicht. Peinlich so was. Oberpeinlich sogar.
Mit hochrotem Kopf springt sie auf und ruft im Wegrennen noch: »Ich schau mal unten in der Truhe nach, ob ich was Schönes für uns zu Essen finde.«
Ich weiß jetzt wirklich nicht, was in sie gefahren ist. Man hätte sich vorstellen können, dass sie vielleicht mit ein paar eingefrorenen Frikadellen und einer Dose Erbsen wieder auftaucht. Oder, wenn’s etwas festlicher werden soll, mit ein paar Tiefkühl-Garnelen, die sie mit ihrer leckeren Hummersauce und frischem Baguette in ein großartiges Essen verwandeln kann. Aber nein, sie schleppt diese riesige, tief gefrorene Lammkeule an.
»Was soll das denn«, fragt er. »Das dauert doch Stunden, bis die aufgetaut ist. Da sitzen wir nachts um eins noch hungrig am Tisch.«
»Wir müssen ja nicht am Tisch warten«, sagt sie, »wir könnten doch so lange ins Bett gehen und das Kind machen«, sagt sie. Also, wenn du mich fragst, so ist das schon sehr bedenklich nahe am Griff nach der Rübe.
»Ach, so hast du dir das gedacht«, sagt er und der scharfe Zug um die Mundwinkel ist beinah nicht auszuhalten. So macht er das immer mit den Mundwinkeln, wenn er sich in die Enge gedrängt fühlt. Wie damals im Gerichtssaal, als dieser Kerl doch tatsächlich etwas von einem warmen Bruder durch die heiligen Hallen geschrien hat. Wenn so ein Gerücht die Runde macht, kann er sich den gefürchteten Staatsanwalt abschminken und den Rest seines Daseins allenfalls als kleines Anwältchen in Zivilverfahren fristen.
Wir leben zwar nicht mehr im Mittelalter und man weiß inzwischen, dass Gott neben Mann und Frau jede Menge Zwischenstufen erschaffen hat bis hin zu Männern, für die das wahre Paradies erst anfängt, wenn Eva von der Schlange weggebissen worden ist. Aber eben nicht vor Gericht, wo der Staatsanwalt nicht als Weichei daherkommen kann, sondern die Respektsperson rauskehren muss. Also hat er gegensteuern müssen und womit kann man besser allen Gerüchten den Wind aus den Segeln nehmen als mit einer Hochzeit mit einer schönen, jungen Frau.
»Liebes«, sagt er und hofft, dass seine heruntergezogenen Mundwinkel den Rest regeln. »Ich will keine Kinder.«
»Na gut«, sagt sie. »Dann machen wir eben kein Kind, sondern machen es nur so.« Jetzt endlich merkt er, dass er in der Falle sitzt. Noch nicht einmal ein halbes Jahr verheiratet und schon sitzt er in der Falle. »Und wenn du dir für nur so einen anderen suchst?«, sagt er und sieht vorsichtig zu ihr hinüber.
Also, das hätte er sich nun wirklich früher überlegen sollen. Für so ein Gentlemen-Agreement braucht es eine gestandene Frau und kein unerfahrenes Mädchen. »Was … was«, stottert sie, »was willst du denn damit sagen?«
»Ich will dich nicht«, sagt er roh.
»Aber … aber …« Tränen steigen ihr in die Augen, »aber ich liebe dich doch«, flüstert sie.
Sie begreift es nicht, denkt er. Vielleicht begreift sie es, wenn ich deutlicher werde. Und er wird deutlicher. »Aber ich liebe dich nicht«, sagt er grob. »Dein Busen ist mir zu groß, dein Atem stößt mich ab und was du zwischen den Beinen hast, will ich gar nicht wissen.«
Und da hat sie eben zugeschlagen.
Mit der Lammkeule.
Genau auf die Stelle, die sie so gut kennt, genau genommen die einzige Stelle, die sie von ihm kennt, weil sie da immer krault. Wie sein Kopf dann so merkwürdig schief an seinem Körper gehangen hat, hat sie es gleich gewusst. Auf ein Kind muss sie nicht mehr hoffen, zumindest nicht von ihm. Das wird nichts mehr. Aus ihm wird sie gar nichts mehr rauskriegen und ein Kind schon gar nicht.
Und siehst du, da ist ihr dann der Drei-Wort-Satz wieder eingefallen, den sie ganz früher mal gelernt hat und der bis heute verschüttet ganz hinten in ihrem Hinterkopf weiterlebt. Ich war’s nicht, denkt sie, nimmt die Keule, wirft sie in die Kasserolle, schiebt das Ganze in den Backofen und dreht den Knopf auf 160 Grad.
Nun musst du nicht denken, dass sie alles Weitere geplant hat. Also ich zumindest denke das nicht, denn schließlich ist sie ein liebes Mädchen und liebe Mädchen tun so was nicht. Die machen nicht vorsichtig die Terrassentür einen Spalt auf, greifen nach dem Autoschlüssel, rennen durch die Vordertür zur Auffahrt, setzen sich ins Auto, brettern mit dem Wagen auf die Straße und setzen dann die Kiste gegen den nächsten Laternenpfahl. Tun die einfach nicht, die lieben Mädchen, und auch sie wird das nicht getan haben – zumindest nicht mit Absicht.
Als sie nach dem Aufprall wieder zu sich kommt, ist schon überall Blaulicht und alles mit Flatterband abgesperrt. »Da ist einer im Haus«, sagt sie mit zitternder Stimme. Die Tränen rinnen ihr übers Gesicht, während die beiden Polizisten ihr vorsichtig aus dem Auto helfen. »Haben Sie sich was getan?«, fragt der linke fürsorglich. Sie schüttelt den Kopf und lässt sich etwas mehr von ihm stützen, als vielleicht erforderlich gewesen wäre.
Verständlich, nach solch einem Schock. Aber nicht ganz ungefährlich. Ein Flirt mit der Polizei kann leicht mal nach hinten losgehen. »Ich hab Angst«, flüstert sie. »Da ist einer im Haus«, haucht sie und sie lässt sich mehr ziehen, als dass sie selber geht. »Keine Sorge, gnädige Frau«, sagt der Polizist. »Unsere Leute sind schon im Haus. Ihnen kann nichts passieren.«
Ja, denkt sie, er hat Recht. Mir kann nichts passieren. Als sie die Stufen zur Eingangstür erreicht haben, macht sie sich von seinem Arm los, stürzt ins Wohnzimmer, sieht ihren Mann mit diesem merkwürdig schiefen Kopf und fängt an zu schreien.
*
Sie kann sich nicht erinnern, dass jemals so viele Männer in ihrem Schlafzimmer waren. »Na, nun sind Sie ja endlich wieder wach«, sagt der Mann, der neben ihr auf der Bettkante sitzt. »Ich dachte schon, ich müsste Ihnen noch eine Spritze geben.«
»Ich will zu meinem Mann«, sagt sie und versucht, sich hochzustemmen. Doch der Mann hält sie fest. »Sie sollten sich jetzt erst mal etwas ausruhen. Diese Herren hier«, er zeigt auf zwei Männer in Zivil, »haben einige Fragen. Meinen Sie, sie könnten sie schon beantworten?«
Silvi nickt schwach. »Ist was Schlimmes passiert?«, fragt sie und sieht die beiden Männer mit großen Augen an. Der ältere von beiden nickt. Der Arzt steht von Silvis Bettkante auf und der Kriminalkommissar nimmt Platz. So hat ihr Mann auch immer abends an ihrem Bett gesessen. Und ein Küsschen auf die Stirn gedrückt. Das hat der Herr, der jetzt an ihrem Bett sitzt, zwar noch nicht getan, aber wer weiß, so väterlich wie er tut, kommt das vielleicht noch. Danach aber kommt sicher nichts mehr. Von ihrem Mann zumindest ist danach nichts mehr gekommen. Die Arme, die sie um ihn geschlungen hat, hat er immer ganz sanft wieder auf die Bettdecke zurückgelegt und »Liebes, wie schön wäre es, aber ich hab noch zu arbeiten« gesagt. Jetzt weiß sie, dass das wie schön wäre es gelogen war und deshalb ist es auch ganz leicht, die Tränen fließen zu lassen.
»Na, na, kleines Frauchen«, sagt der Kommissar beruhigend und tupft ihr mit einem Tuch die Tränen ab, »es wird doch alles wieder gut.« So was sagen Männer, wenn sie nicht weiter wissen. Denn es wird natürlich gar nichts wieder gut, wenn der Ehemann erschlagen im Wohnzimmer liegt. Aber wenn man selbst der Totschläger ist, dann können solche Worte einen sehr trösten und Silvi ist auch gleich sehr getröstet und erzählt, was passiert ist: wie sie und ihr Mann gemütlich im Wohnzimmer gesessen haben und plötzlich ein Mann durch die angelehnte Terrassentür reingekommen ist und ganz böse ausgesehen hat und dass sie dann ganz erschreckt ganz schnell rausgelaufen und mit dem Wagen geflüchtet ist und dass sie mehr nicht mehr weiß.
»Aber daran, dass Sie trotz der Eile noch an den Autoschlüssel gedacht haben, daran erinnern Sie sich noch?«, fragt der Kommissar und tupft weiter an ihren Tränen herum. Silvi lässt ihren Tränen freien Lauf, während sie überlegt, was es darauf zu sagen geben könnte.
»Es wäre dann soweit alles erledigt. Können wir abrücken?« Der junge Polizist, die Stütze ihres Rückwegs ins Haus des toten Gatten, steht in der Tür und sieht den Kommissar fragend an. »Ist die Tatwaffe gefunden?«, fragt der Kommissar.
»Nein«, sagt der Polizist.
»Dann weitermachen.«
»Jawoll«, sagt der Polizist und kann sich gerade noch bremsen, nicht auch noch die Hacken zusammen zu schlagen. Die Hand hat er schon halb an der Mütze.
Wie gesagt: Silvi ist es nicht gewöhnt, dass Männer sich bei ihr die Klinke in die Hand geben und es in ihrem Schlafzimmer zugeht wie im Taubenschlag. Wunderbar, denkt sie. Ganz wunderbar. Und am wunderbarsten ist, dass sie dadurch verwirrt von einem zum anderen sehen kann und auf diese Weise genügend Zeit hat, nach einer Antwort auf die Frage des Kommissars zu suchen.
Wofür ist sie mit einem Staatsanwalt verheiratet – gewesen. »Die Fakten lagen klar auf dem Tisch«, hatte ihr Mann ihr einmal erzählt. »Aber die Frau hat einfach nichts gesagt. Hat getan, als könnte sie sich nicht erinnern. Die ganze Verhandlung für die Katz. Und ich hab mit meiner Mordanklage wie ein Trottel dagestanden.« Das ist vor einem Monat gewesen, als sie schon gewusst hat, dass sie nicht naseweis fragen darf, ob man sowas nicht vorher abklären muss. »Wie gemein von der Frau«, hat sie nur gesagt, »richtig verlogen. Was für ein Miststück.«
»Ich weiß nicht«, wird sie also hauchen, wenn der Kommissar sie fragt. Aber er fragt nicht. Anscheinend ist er durch das ganze Gewusel im Schlafzimmer abgelenkt worden. »Komm«, sagt er zu dem anderen, der in respektvollem Abstand beim Spiegelschrank steht, »wir wollen denen da unten mal Beine machen. Kann doch nicht so schwer sein, das Ding zu finden, mit dem der Einbrecher zugeschlagen hat.«
»Und Sie«, sagt er und löscht das Licht, »Sie ruhen sich etwas aus.« Silvi bleibt im Dunkeln zurück. Wie immer, denkt sie, ganz genau wie immer. Im Haus wird gearbeitet und sie liegt allein hier oben und wartet auf den Schlaf. Aber der will nicht kommen. Vielleicht verständlich, wenn man gerade seinen Mann um die Ecke gebracht hat. Viele Menschen können schon nicht einschlafen, wenn sie nur die Spiegeleier haben anbrennen lassen oder eine Fliese im Bad falsch verlegt ist. Auch sie wälzt sich im Bett und starrt in die Dunkelheit.
Da kommt er. Erst glaubt sie, es wäre nur ein Schatten an der Wand. Doch er kommt langsam auf sie zu. Mit seiner schwarzen Robe steht er vor ihr und schaut drohend auf sie herab. »Du kommst nicht davon«, wispert es dumpf. »Schuldig«, raunt die allzu bekannte Stimme unter dem schwarzen Umhang. »Lebenslänglich«, brodelt es aus ihm heraus. »Ich war’s nicht«, wimmert sie. Da langt eine Hand aus der Robe, fasst sich im Nacken an die tödliche Wunde und will blutverschmiert nach ihr greifen.
Und sie schreit und schreit und schreit, wie sie noch nie in ihrem Leben geschrien hat.
Er stürzt in ihr Zimmer, er, der Polizist, ihre Stütze. Der kleine, junge, hübsche Polizist greift ihre Arme, die wild um sich schlagen, streichelt sie, tröstet sie, lehnt sich über sie, um sie zu bändigen und zu beruhigen.
»Ich war’s nicht«, wimmert sie wieder.
Na, das weiß nun wirklich jeder, dass, wenn einer sagt, dass er’s nicht war, obwohl gar keiner behauptet, dass er’s gewesen wäre, dann war er’s todsicher. Er muss ihr den Mund zuhalten und weil seine Hände mit ihren Armen beschäftigt sind und streicheln müssen, bleibt ihm zum Zuhalten nur sein Mund.
»Wir haben was gefunden«, flüstert er, nachdem sie endlich unter seinen Küssen zur Ruhe gekommen ist. »Unten. Im Backofen. Komm.«
*
Leichenblass steht sie zwischen den Männern, die Schubladen aufziehen, Kommoden abrücken, Schränke aufreißen. Und durch die Fenster sieht sie Polizisten den Garten durchwühlen. »Nichts«, sagt der Kommissar. »Die Tatwaffe ist nicht zu finden. Wir sind völlig am Ende«, sagt er. »Ob Sie uns wohl eine Kleinigkeit zu essen machen könnten. Es riecht hier so gut nach Gebratenem.«
Der kleine, junge, hübsche, zärtliche Polizist hilft ihr und löst das Fleisch vom Knochen der Lammkeule, während sie mechanisch Baguette schneidet und eine Sauce anrührt. Als er fertig ist und den Knochen da liegen sieht, überlegt er, ob nicht jemand auf die Idee kommen könnte, dass so eine große Lammkeule vielleicht wunderbar dazu geeignet wäre, unliebsame Ehemänner zu erschlagen. Deshalb wirft er den Knochen lieber in den Mülleimer unter der Spüle. Den haben seine Kollegen schon durchsucht.
Ein ungewöhnlicher Name
Britta Bendixen
Southhampton
Wie üblich wurde Edith mit einem missbilligenden Blick bedacht, als sie das Zimmer betrat. Ihre Mutter lag mit drei Kissen im Rücken im Bett, der stickige Geruch nach Alter und Krankheit kroch in Ediths Nase. Sie ging zum Fenster hinüber, öffnete es und atmete tief die frische Luft ein.
»Wo bleibt mein Essen?«, fragte ihre Mutter gereizt. »Es ist längst Mittagszeit.«
»Hab noch ein klein wenig Geduld, es ist bald fertig.« Sie wandte sich ihrer Mutter zu und schüttelte ihre Kissen auf. »Der Postbote hat mich in ein Gespräch verwickelt, darum dauert es länger.« Sie griff in die Tasche ihrer Kittelschürze und zog einen dicken Umschlag hervor. »Hier, du hast wieder Post aus New York. Willst du mir nicht endlich erzählen, wer diese Meredith Fenworthy ist?«
Ihre Mutter riss ihr den Brief aus der Hand. »Nein, will ich nicht. Das geht dich nichts an.«
Edith seufzte leise, dann wechselte sie das Thema. »Ich brauche Geld zum Einkaufen. Soll ich gehen, wenn Dr. Jones kommt, um dich zu untersuchen? Dann hast du Gesellschaft.«
Die Augenbrauen ihrer Mutter, dunkelgrau und etwas zu buschig, kräuselten sich unheilvoll. »Schlag dir das aus dem Kopf. Ich will nicht mit dem Kerl allein sein.«
Edith versuchte, ruhig zu bleiben. »Mutter, Dr. Jones ist –«
»Du bleibst, bis er gegangen ist, verstanden? Und hol endlich mein Mittagessen, auch wenn es wieder grässlich schmeckt. Ich verhungere.«
Ediths Hände ballten sich zu Fäusten. Wortlos verließ sie den Raum und stieg die schmale, knarrende Treppe hinunter ins Erdgeschoss.
Wie sie das alte Weib verabscheute! Edith war fünfundvierzig und ihr einziger Lebensinhalt bestand in der Pflege ihrer herzkranken und streitsüchtigen Mutter. Den Traum von einer eigenen Familie hatte sie längst begraben. Dabei hätte sie sehr gern Kinder gehabt.
Während sie Kartoffeln stampfte, überflog Edith einen Artikel in der Zeitung. Die Suffragetten um Emmeline Pankhurst machten wieder einmal von sich reden. In dem Artikel wurden zerbrochene Fenster und angezündete Briefkästen im Bereich des Londoner Parlaments erwähnt.
Diese Frauen wehren sich wenigstens und kämpfen für das, was sie wollen, dachte Edith trübsinnig. Ich dagegen lasse mich seit Jahren drangsalieren. Aber was bleibt mir auch übrig? Sie ist meine Familie, sie braucht mich, und außer ihr habe ich niemanden.
»Das Fleisch ist trocken«, beschwerte sich ihre Mutter. »Und das Püree schmeckt nach gar nichts. Wie schaffst du es nur, aus jeder Mahlzeit Schweinefutter zu machen?«
Edith senkte schuldbewusst den Kopf. »Entschuldige, Mutter. Du weißt, ich kann nicht besonders gut kochen.«
»Du kannst überhaupt nichts besonders gut. Leider.«
Es war nicht das erste Mal, dass ihre Mutter ihr ihre Unzulänglichkeiten vorhielt, doch es tat trotzdem weh. Schweigend auf einem Stuhl neben dem Bett sitzend wartete Edith ab, bis ihre Mutter mit dem Essen fertig war.
Als diese die Gabel niederlegte und sich die schmalen Lippen mit der Stoffserviette sauber wischte, stand Edith auf und nahm ihr das Tablett ab, um es in die Küche zu bringen.
»Warte! Gib mir die Schatulle.«
Edith stellte das Tablett auf der Kommode ab und holte die schwere dunkle Holzkiste aus dem Nachttisch. Behutsam legte sie sie auf die Bettdecke und stellte sich, wie immer, wenn ihre Mutter die Kiste öffnete, ans Fußende. Unter keinen Umständen war es ihr erlaubt, einen Blick hineinzuwerfen. Dabei hätte sie sehr gern gewusst, was sich in der geheimnisvollen Schatulle befand.
Die knochigen Finger ihrer Mutter tasteten nach dem Schlüssel, den sie an einer Kette um den Hals zu tragen pflegte. Schweigend beobachtete Edith, wie die alte Frau aufschloss, den Deckel hochklappte, der Kiste ein paar Geldscheine entnahm und den jüngsten Brief aus New York hineinlegte. Danach schloss sie sofort wieder ab.
»Stell sie wieder weg.«
Edith tat es. Anschließend reichte ihre Mutter ihr das Geld. »Hier, das sollte für den Einkauf reichen. Aber du bleibst, bis der Arzt gegangen ist, verstanden?«
Edith nickte und mühte sich ein Lächeln ab. »Natürlich, Mutter. Jetzt ruh dich aus, du hast doch wieder so schlecht geschlafen letzte Nacht.«
Dr. Jones kam jede Woche um diese Zeit vorbei. Er war ein untersetzter Mann in den Fünfzigern mit einem buschigen Schnauzbart und kurzen, dicklichen Fingern. Er untersuchte seine herzkranke Patientin gründlich, hörte sich ihre Klagen an, ermahnte sie, sich weiterhin zu schonen und verabschiedete sich.
Edith brachte ihn zur Tür und reichte ihm seinen Hut.
»Ihre Mutter sagte gerade, sie schlafe in letzter Zeit unruhig«, sagte Dr. Jones. »Ist das wahr?«
Edith atmete tief durch und nickte. »Allerdings. Seither ist sie noch unleidlicher.«
»Haben Sie es schon mit warmer Milch und frischer Luft versucht?«
»Natürlich. Aber dadurch wurde es nicht besser.«
Der Arzt nickte nachdenklich und musterte Edith. »Sie ist eine recht anstrengende Person, nicht wahr? Sie sind blasser als sonst, fiel mir auf.«
Edith lächelte scheu. »Einfach war sie noch nie. Doch in letzter Zeit …« Sie seufzte.
»Ich verstehe.« Dr. Jones öffnete seine Tasche und holte ein Papiertütchen hervor. »Das ist ein leichtes Schlafmittel. Geben Sie Ihrer Mutter abends eine Messerspitze davon in den Tee. Und gönnen Sie sich hin und wieder eine Pause.«
Edith nahm die Medizin entgegen. »Haben Sie vielen Dank, Doktor«, sagte sie erleichtert.
Auf dem Weg zum Einkaufen kam Edith am Hafen vorbei. Es war ein milder Apriltag, die Luft war frisch und zum ersten Mal in diesem Jahr spürte sie die Kraft der Sonne. Das schöne Wetter und die Aussicht auf ruhige Nächte hoben ihre Stimmung.
Ein gewaltiges Schiff war eingelaufen und sorgte für aufgeregtes Getuschel entlang des Kais. Arbeiter mit Schiebermütze, Hosenträgern und aufgekrempelten Ärmeln wiesen auf das Ungetüm, Kinder hatten die Köpfe in den Nacken gelegt und staunten das Riesenschiff an. Es roch nach Fisch, den Händler feilboten, und hier und da flitzte eine Ratte an Lagerhäusern entlang.
Edith beobachtete, wie elegant gekleidete Passagiere die Gangway auf- und abgingen und über die Reling gebeugt winkten, wobei die Frauen ihre Hüte mit der anderen Hand festhielten.
Mit diesem Schiff zu reisen, wäre gewiss wunderbar, dachte Edith sehnsüchtig. Wohin es wohl fuhr? Ein Weilchen blieb sie stehen und träumte von exotischen Orten, die man damit erreichen könnte. Schließlich riss sie sich los. Sie wollte ihre Mutter nicht zu lange warten lassen.
»Wo bist du gewesen?«, fuhr ihre Mutter sie an, kaum dass sie zurück war. »Ich habe mich beschmutzt, und das ist allein deine Schuld.«
Die nächste Stunde verbrachte Edith damit, das übelriechende Bett und die zeternde alte Frau zu säubern. Statt auf deren Vorwürfe einzugehen, träumte sie sich auf das wunderschöne Schiff, das, wie sie gehört hatte, am nächsten Mittag auslaufen sollte.
Am Abend gab sie etwas von der Medizin in den Tee, ehe sie ihrer Mutter das Abendbrot brachte. Es wirkte, die alte Frau schlief ein, noch ehe sie ihr Mahl beendet hatte. Ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig.
Edith nahm das Tablett an sich. Dabei streifte ihr Blick den Nachttisch. Dies war die perfekte Gelegenheit, endlich zu erfahren, was ihre Mutter vor ihr verbarg.
Langsam platzierte sie das Tablett mit dem schmutzigen Geschirr auf der Kommode und näherte sich dem Nachttisch. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, als sie, jedes Geräusch vermeidend, die Kiste hervorholte und sie neben die Schlafende aufs Bett stellte. Dann zog sie mit zitternden Fingern den Schlüssel aus dem Nachthemd hervor und schob ihn in das Schloss. Dabei ließ sie die alte Frau nicht aus den Augen. Was, wenn sie aus dem Schlaf hochschrecken würde? Edith hatte einen Kloß im Hals, während sie das faltige und bleiche Gesicht betrachtete und dabei den Schlüssel herumdrehte. Es quietschte vernehmlich. Edith verharrte mit angehaltenem Atem, den Blick auf das Antlitz der alten Frau gerichtet.
Zu ihrer Erleichterung wirkte das Mittel von Dr. Jones zuverlässig, die Lider ihrer Mutter blieben geschlossen, ihre Gesichtszüge entspannt. Rasch verstaute sie den Schlüssel wieder an seinem Platz und verließ mit der Schatulle in den Händen und aufgeregt klopfendem Herzen den Raum.
In der Küche setzte sie sich an den Tisch und hob feierlich den Deckel.
Obenauf lag das Geld. Viel Geld. Mit vor Staunen offenem Mund holte Edith die Scheine heraus und zählte. Es waren mehrere hundert Pfund! Mit so viel hatte sie nicht gerechnet. Zumal ihre Mutter ihr stets das Gefühl vermittelt hatte, sie würden am Hungertuch nagen.
»Du geizige alte Hexe«, murmelte sie verärgert und stöberte weiter in der Kiste.
Ein Stapel Briefe. Alle von der ihr unbekannten Meredith Fenworthy aus New York. Edith wollte gerade neugierig einen von ihnen öffnen, als sie unter den Briefen wertvoll aussehenden Schmuck entdeckte. Sie legte die Umschläge zur Seite und nahm zaghaft einen Rubinring heraus. Schob ihn über ihren rechten Ringfinger. Er passte perfekt. Entzückt drehte sie ihre Hand im Licht der kleinen Gaslampe. Wie wunderschön das aussah! Der rote Stein schimmerte und leuchtete wie die untergehende Sonne.
Ohne ihn abzunehmen, ließ sie ihre Hände durch die Ketten, Armbänder und Broschen gleiten. All diese Sachen waren gewiss ein Vermögen wert!
Plötzlich stutzte sie. Aus den Schmucksteinen ragte die Ecke eines zusammengefalteten Blattes Papier hervor. Sie zog es heraus, faltete es auseinander und begann zu lesen.
Ihre Unterlippe zitterte, als sie den Brief sinken ließ.
Kurz darauf öffnete sie die Tür zum Zimmer ihrer Mutter. Langsam trat sie an das Bett und betrachtete das im Schlaf so friedlich wirkende Gesicht.
»Jetzt weiß ich endlich, wer Meredith Fenworthy ist«, flüsterte sie, griff nach einem Kissen und drückte es fest auf das runzlige Gesicht der schlafenden Frau.
Dabei ging ihr wieder und wieder der Inhalt des Briefes durch den Kopf.
»Geliebte Schwester,
ich danke dir, dass du dich um mein Baby kümmern willst, wenn ich nach Amerika gehe. George Fenworthy würde mich niemals heiraten, wenn er von Edith wüsste.
Ich werde dir regelmäßig Geld schicken, du weißt ja, dass mein Verlobter vermögend ist. Ihr braucht euch in dieser Hinsicht also keine Sorgen zu machen, es wird euch beiden gut gehen, das verspreche ich dir.
Den Schmuck, den Mutter mir vermacht hat, gebe ich zu deinen treuen Händen,
damit du ihn an meine geliebte Tochter weitergeben kannst, wenn sie alt genug ist.
In Liebe, Meredith.«
Als Edith das Kissen anhob, atmete die alte Frau nicht mehr. Ihr Mund hatte sich leicht geöffnet, die bleiche Gesichtsfarbe wirkte grauer als zuvor.
Edith musterte die Tote mit kühler Miene. »Schluss mit den Lügen, Mutter.«
Dann verließ sie mit festen Schritten den Raum.
Mit einem Koffer, in dem sich neben ihrer Kleidung auch der Schmuck, die Briefe und das Geld befanden, stand Edith am Hafen. Sie trug ihr Sonntagskleid und ihren schönsten Hut.
Zufrieden betrachtete sie das Ticket in ihrer Hand, an deren Ringfinger der Rubin funkelte. Wenn jemand die Leiche ihrer ›Mutter‹ entdeckte, würde sie England längst für immer verlassen haben.
Ein neues, wunderbares Leben lag vor ihr. In Amerika, dem Land, in dem ihre wirkliche Mutter lebte. Wie sie wohl reagieren würde, wenn Edith vor ihr stand?
Während sie die Gangway hinaufstieg, betrachtete sie lächelnd den strahlend weißen Schriftzug am dunklen Bug des Schiffes.
Titanic, las sie. Was für ein ungewöhnlicher Name.
Krabben, Koks und coole Typen
Manfred Ertel
Hamburg
Mühsam schiebt sich der Koloss den Strom rauf Richtung Hafen. Die wulstige Schiffsnase zerteilt die schmutziggrauen Fluten der Elbe in zwei mächtige Wogen, die auf die Flucht zu den Ufern gehen. Der Schwell klatscht dort so heftig auf die Steine des Elbstrandes, dass die Hunde erschreckt zurückspringen. Aufgescheuchte Eltern fangen ihre Kleinen ein und bringen sie ein Stück den Sand hoch in Sicherheit.
Die Container auf dem Deck der ›Kong Haaland‹ stapeln sich haushoch. Immer sechs oder sieben aufeinander. Bis knapp unter die Kommandobrücke. Der schwere Pott liegt so tief im Fahrwasser, dass der Rostschutzanstrich nur noch wie eine rote Linie knapp über dem trüben Wasserspiegel in der spätsommerlichen Nachmittagssonne leuchtet. Fast schon symbolisch. Mit etwas mehr Tiefgang würde es über dem Alten Elbtunnel sicher eng werden.
»Warum läuft der Containerriese eigentlich unter der Flagge einer Bananenrepublik?« Klaas Boehlsen steht am Strand und traktiert sein Smartphone. Ungeduldig tippt sein Zeigefinger immer wieder aufs Display, während seine Blicke gleichzeitig im Stakkato zur Elbe wandern. Hin und zurück, in kurzen Abständen. Endlich hat er Empfang. Und findet, was er hingebungsvoll gesucht hat. »Panama«, sagt er abschätzig und hält seiner Frau das Handy hin. »Sieht ja ganz schick aus. Weiß-rot und blau-weiß mit Sternchen. Aber warum ausgerechnet Panama?«
Seine Frau kennt das schon. Sie schaut nur kurz auf sein Display. Dann kümmert sie sich wieder um den riesigen Findling dicht am Uferweg. Das Rentnerpaar ist oft an der Elbe. Klaas, ein ehemaliger Angestellter der Hafenbehörde, träumt sich da hinaus auf See. Und nervt seine Frau mit unnötigem Wissen über Schiffe und Schifffahrt. So sehr, dass sie nach 42 Ehejahren kaum noch zuhört. Elke Boehlsen hat Geschichte studiert und mit Auszeichnung die Uni verlassen. Um in der heimischen Küche zu stranden. Nach drei Kindern ist sie schließlich als Mitarbeiterin in einer Öffentlichen Bücherhalle in Ottensen hängengeblieben. Ein sicherer Job. Aber ohne große Perspektive. Mit Geschichte haben die Geschichten in ihren Bücherregalen wenig zu tun. Jetzt will sie der Historie des riesenhaften Granits aus dem schwedischen Småland auf den Grund gehen. »Alter Schwede« heißt der Brocken aus irgendeiner Eiszeit, seitdem er mit viel Tamtam von der Zweiten Bürgermeisterin der Stadt hochoffiziell so getauft wurde. Über 300 000 Jahre hatte er auf einen Namen warten müssen.
Elke Boehlsen schaut von ihrer geologischen Studie über die Granitstruktur des Steins hoch und rüber zum Containerriesen. Irgendwas hat sich in ihr Unterbewusstsein gedrängt, ihr Blickfeld gestört. Mit einem Fremdkörper, der da nicht hingehört. »Was macht denn die lütte Barkasse da vorn? Die liegt doch mitten in der Fahrrinne.« Ihre Stimme wird laut, sie wedelt aufgeregt mit der Hand Richtung Elbe. Klaas’ prüfende Blicke folgen ihrem Fingerzeig. »Bremsen kann der nich’ mehr«, sagt er dann. »Die Nussschale muss da wech’ und zwar dalli, dalli. Bannig veel Tied blifft dar nich’.« Vor Nervosität ist er in seinen Hafenslang von früher gefallen. Ein Mischmasch aus Platt und Missingsch.
Die Hafenbarkasse reagiert endlich, als ob da jemand mitgehört hätte. Mit langsamer Fahrt schiebt sich der flache Passagierkutter an den Rand der Fahrrinne und legt sich längsseits des Containerschiffs. Wie ein Furunkel am mächtigen Rumpf eines Riesen. »Das kann kein Lotse sein«, stellt Elke nüchtern fest, »allein schon der Name: ›Schietbüdel‹.« Sie klatscht sich mit der Hand vor die Stirn. »Wer nennt ein Schiff schon so. Und Lotsenschiffe sehen auch ganz anders aus.«
Klaas schüttelt den Kopf. »Nie und nimmer. Der Hafenlotse ist schon längst an Bord. Er hat den Elblotsen schon vor Finkenwerder abgelöst.« Der Fachmann weiß Bescheid. Die beiden schauen sich an und suchen nach einer Erklärung.
»Wirft da jemand etwas über Bord? Schau’ doch mal. Oder hängt da ein Tau?« Elke zeigt dem Frachter hinterher, der sich langsam weiter flussaufwärts schiebt. »Von oben runter auf die Barkasse? Tinnef«, sagt der Fachmann leicht genervt. Seine Frau nun wieder. Irgendwie hat er die Lage nicht unter Kontrolle. »Aus der Höhe! Und außerdem: Was soll das sein?«