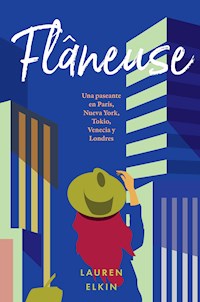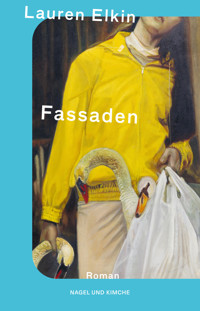
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2019 verarbeitet Anna, eine Psychoanalytikerin, eine kürzlich erlittene Fehlgeburt. Ihr Mann David nimmt einen Job in London an, und so verbringt sie die Tage damit, wie besessen die Küche zu renovieren, während sie sich mit einer jüngeren Frau namens Clémentine anfreundet, die in das Haus eingezogen ist und zu einem radikal-feministischen Kollektiv namens les colleuses gehört. In der Zwischenzeit, 1972, renovieren Florence und Henry ihre Küche. Florence beendet gerade ihr Psychologiestudium und hofft, schwanger zu werden. Aber Henry ist sich nicht sicher, ob er für die Vaterschaft bereit ist... Beide Paare stehen vor den Herausforderungen der Ehe, der Treue und der Schwangerschaft. Die Figuren und ihre Geister stoßen aufeinander und umkreisen sich, ohne zu wissen, dass sie einst alle denselben Raum bewohnten.
Ein außergewöhnlicher Roman über die Bindungen, die wir mit anderen Menschen eingehen, und die Schwierigkeit, sie jemals ganz zu lösen; über die Art und Weise, wie Menschen, die wir gekannt haben, in uns weiterleben; und die Häuser, die wir bauen, Erinnerungen und Geschichten speichern und weitergeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lauren Elkin
Fassaden
Roman
Aus dem Englischen vonEva Bonné
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Scaffolding bei Chatto & Windus, London.
Chatto & Windus, ein Imprint von Vintage,
ist Teil der Verlagsgruppe Penguin Random House.
© 2024 Lauren Elkin
Deutsche Erstausgabe
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
NAGEL UND KIMCHE in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch, Zürich
Coverabbildung von Girl with Swans © Shannon Cartier Lucy
E-Book Produktion von GGP Media Gmbh, Pößneck
ISBN 978-3-312-01385-2
www.nagel-kimche.ch
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Autorin und des Verlags bleiben davon unberührt.
Für B. H.
Nachdem ein Bewohner ausgezogen ist, nehmen andere seinen Platz ein, verrücken die Möbel und mauern den Kamin zu, auf dessen Sims sich die Pendeluhr befand, die Muscheln, der Krimskrams; oder sie teilen das Zimmer neu auf und nutzen es zu einem anderen Zweck. Sie streichen die Wände und tauschen die Tapeten aus.
Michelle Perrot, Histoire de chambres
Der andere muss uns absolut fremd bleiben, bei größtmöglicher Nähe.
Hélène Cixous, »Extreme Fidelity«
Mit der Zeit kommen die Dinge ans Licht!
Jacques Lacan, Seminar XX: Encore
I
Hör mal. Da spielt jemand Klavier.
Woran erinnert es dich?
An eine hektische, steil ansteigende Straße.
An eine grüne Tür in einer Steinfassade.
An einen Ort, der dein Zuhause war.
An einen Ort, den du noch nie gesehen hast.
Ich lernte Clémentine einen Tag nach ihrem Einzug kennen. Sie stand vor der flaschengrünen Haustür und gab willkürliche Zahlenkombinationen in das kleine Tastenfeld ein, das den Zugang zum Hausflur regelt. An ihren Armbeugen hingen vollgestopfte Plastiktüten. Ich war nass geschwitzt von meiner morgendlichen Joggingrunde; der August war drückend heiß.
21B12, sage ich. Sie hört mich erst beim zweiten Mal.
Das Türschloss klickt. Und ich hatte schon Angst, ich müsste stundenlang hier stehen und warten, bis jemand rauskommt!, sagt Clémentine und lacht nervös. Sie ist groß, aber irgendwie zierlich. Stupsnase, blondes Haar.
Die Hausmeisterin kann dich reinlassen, du musst nur klingeln, sage ich. Sie heißt Madame Vasquez und wohnt im Erdgeschoss. Ich deute auf die Pförtnerloge. Falls es dir noch mal passiert.
Ach, ich dachte, irgendwann fällt mir die Kombination bestimmt wieder ein. Meine Erinnerung funktioniert so: Sachen verschwinden, aber irgendwann stoße ich aus Versehen gegen die richtige Gehirnschublade, sie springt auf und – voilà! Ich finde genau das, wonach ich gesucht habe.
Wir bleiben vor den Briefkästen stehen, und Clémentine erzählt mir, dass sie und ihr Freund Jonathan eben erst eingezogen sind. Sie wohnen im Haus B. Mein Mann und ich wohnen in A. Wir unterhalten uns über Umzüge und Umzugsunternehmen und stellen uns vor. Ich sehe auf meine Uhr. Tut mir leid, ich habe gleich einen Termin und muss vorher noch duschen. Aber komm doch diese Woche auf einen Tee vorbei.
Clémentine klingelt am Donnerstagnachmittag. Was für eine hübsche Wohnung, sagt sie, geht direkt ans Fenster und sieht hinaus. Wir wohnen oben auf dem Hügel und haben einen unverbauten Blick nach Süden, auf das Durcheinander von Paris. Gerundete, aneinandergepuzzelte Schieferdächer, so weit das Auge reicht. Unmittelbar gegenüber ein moderner Wohnblock, in der Ferne der gereckte Mittelfinger der Tour Montparnasse, links davon die Zuckergusskuppel des Panthéon.
Danke, sage ich. Wir haben das Zimmer gerade erst renoviert.
Die breiten Panoramafenster nehmen fast zwei komplette Wände ein. Eins geht auf eine ruhige Seitenstraße hinaus, das andere auf die Rue de Belleville. David hat die Fenster eigenhändig restauriert, er hat die vielen Schichten aus alter Tapete und Farbe entfernt, die sich im Lauf der Jahre übereinandergelegt hatten, und anschließend die Rahmen neu lackiert. Wir wollten die ursprüngliche Einfachverglasung unbedingt behalten. Es ist laut, aber diese neuen doppelt verglasten Kunststofffenster gefallen uns nicht. Selbstverständlich fetischisieren wir Originalität. Gleich nach den Sommerferien kommen die Handwerker, denn die Küche ist als Nächstes dran und zu irgendeinem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, wenn wir ein bisschen Geld übrig haben, auch das Bad.
Draußen vor dem Haus wird es eine weitere Baustelle geben. Pariser Fassaden müssen etwa alle zehn Jahre saniert werden, und wir hatten das Pech, die Wohnung kurz vor dem anstehenden ravalement zu kaufen. Das Ganze wird teuer und unglaublich störend. Bei der Eigentümerversammlung haben wir dagegengestimmt, aber man kann die Sache nicht ewig hinauszögern; jedes Pariser Leben muss seinen kleinen Anteil an den lästigen, kostspieligen Fassadenarbeiten tragen.
Weil demnächst drinnen und draußen Bauarbeiten stattfinden, sage ich zu Clémentine, fühlt es sich an, als wären wir noch gar nicht richtig eingezogen. Ab wann können wir hier einfach nur wohnen?
Bei uns herrscht immer noch das totale Chaos, erwidert Clémentine. Es ist wirklich schön, mal rauszukommen und was anderes zu sehen als Umzugskartons. Manchmal fühlt es sich an, als würden sie mich anstarren und nur darauf warten, dass ich sie endlich auspacke. Clémentine lässt den Blick über den biederen Schick des Wohnzimmers schweifen. Es ist nicht sehr groß – an dem Morgen hatte ich am Fenster Yoga gemacht und mit dem Fuß eine Vase vom Tisch gestoßen –, aber gemütlich, und ich empfinde einen gewissen Besitzerstolz. Parkett mit Fischgrätmuster, wuchtiger Couchtisch vor einem l-förmigen Sofa, in der Ecke neben dem Fenster die geschwungene Silhouette eines Tulip Table von Saarinen (jetzt ohne Vase). Die knubbelige, ungefaltete Wolldecke auf dem Sofa verrät, dass ich einen Mittagsschlaf gemacht habe, dahinter steht ein rot lackiertes Tischchen mit einer rot gestreiften DDR-Midcentury-Keramiklampe. Davids Pflanzen: einige zart rankend, andere wild wuchernd, alle in unterschiedlichen Stadien des Vertrocknens, weil niemand außer mir sie gießt und ich es oft vergesse. In den Regalen kleine, sorgsam arrangierte von unseren Reisen – David liebt Reisen – mitgebrachte Andenken. Der letzte Neuzugang ist ein winziger roter Doppeldeckerbus aus London. Dazwischen Muscheln, die ich zwanghaft vom Strand auflese, und Steine, deren Fundort ich mit einem dünnen schwarzen Stift auf der Unterseite notiert habe. Im Lauf der Jahre ist die Schrift verschmiert. Ich weiß, dass einige der Steine aus Vermont stammen und andere aus der Bretagne, aber inzwischen sehen sie alle gleich aus. Am Boden stehen ein paar gerahmte Bilder, die aufzuhängen ich noch keine Zeit hatte. Alle sind zur Wand gedreht.
Schöne Lampe, sagt sie.
Oh, danke. Sie ist vom Flohmarkt. Eigentlich wollten wir wieder dorthin und zwei alte Art-déco-Spiegel kaufen, aber bis jetzt hatten wir noch keine Gelegenheit. Wenn David hier ist, wollen wir unsere Zeit nicht mit Shoppen verbringen. Wahrscheinlich sind sie sowieso längst weg.
Wahrscheinlich, sagt Clémentine, dann fragt sie:
Denkst du manchmal an die Leute, die in die Wohnungen eingezogen sind, die du nicht wolltest? Denn wenn du die Wohnung genommen hättest, würden sie jetzt woanders leben. Deine Entscheidung hat einen riesigen Einfluss auf den Alltag komplett fremder Leute.
Ja, und dann sind da noch diejenigen, die dort einziehen, wo man früher gewohnt hat, sage ich und muss dabei an unser altes, weiter unten am Hang gelegenes Appartement denken und an das Paar, das zur Besichtigung kam. Am Ende sagten sie zu, die Frau war hochschwanger. Wo wären sie heute, hätten wir uns damals gegen einen Umzug entschieden? Manchmal gehe ich an ihren Fenstern vorbei und denke an sie und das Baby, das inzwischen schon fast ein Jahr alt sein muss. Ein bisschen fühlt es sich an, als führten sie unser altes Leben weiter, während wir ein fremdes übernommen haben.
Wir setzen uns in den sonnigen Teil des Wohnzimmers, die Balkontüren sind geöffnet, nach der drückenden Hitze weht endlich eine Brise herein. Clémentine fühlt sich anscheinend sofort wie zu Hause und hockt sich auf die Sofalehne. Wir trinken Tee und rauchen die von ihr mitgebrachten Lucky Strikes. Als sie sich die Zigarette an die Lippen führt, bemerke ich die Tätowierungen an ihrer rechten Hand: lange elegante Pfeile mit Doppelspitze. Reflexhaft wandert mein Blick zu ihrer linken, am Ringfinger entdecke ich einen weiteren Pfeil. Clémentine hat meine Blicke bemerkt, ich wende schnell die Augen ab. Vom stöhnenden Mülllaster unten auf der Straße steigen die Abgase bis in den fünften Stock herauf und mischen sich mit unserem Zigarettenqualm.
Die Luftqualität ist wirklich schlecht, oder?, sage ich und stehe auf, um das Fenster zu schließen. Davids Mutter schickt mir mindestens einmal pro Woche einen Artikel darüber. Sie möchte, dass wir aufs Land ziehen. Sie besitzen dort ein Haus. Es wäre viel einfacher, sagt sie, vor allem, wenn wir ein Kind bekämen, dann könnten sie babysitten …
In letzter Zeit ist es mit der Luftverschmutzung so schlimm, dass eine halbe Stunde spazieren zu gehen so ungesund ist, wie eine Schachtel Zigaretten zu rauchen, sagt Clémentine.
Wirklich?
Ja! Schminkst du dich abends mit Wattepads ab? Hast du schon mal bemerkt, wie schwarz die immer sind?
Ja, schon, aber ich dachte, das sei Mascara.
Was glaubst du, woher das kommt? Und an den Häusern sieht man es auch. Die Fassaden sind kaum saniert und schon wieder verdreckt. Na ja, wenigstens kann ich, wenn die Luft mich sowieso umbringt, so viel rauchen, wie ich will.
Ich atme den Qualm tief ein. Der Tabak drückt auf meinen Kreislauf, wirkt beruhigend.
Was macht dein Mann beruflich?, fragt Clémentine.
Er ist Anwalt. Momentan hat er ein Projekt in London. Ich weiß nicht, was er genau macht, aber es hat was mit dem Brexit zu tun.
London ist nicht weit von hier, sagt sie.
Zwei Stunden mit dem Eurostar.
Dann fährst du bestimmt oft rüber?
Nein, bis jetzt noch gar nicht. Ich kann London nicht leiden.
Sie nimmt unser Hochzeitsalbum vom Sofatisch und zieht vorsichtig das Pergament von den ersten Seiten. Ich kannte auch mal einen David. In der Schule. Wie habt ihr euch kennengelernt? Sorry, frage ich zu viel?
Ist schon okay. Wir haben uns über Freunde kennengelernt, antworte ich, aber meine Stimme geht im Dröhnen eines Presslufthammers unter. Wir verständigen uns mit Gesten, es ist zu laut zum Reden. Ich drücke die Zigarette aus, wir nippen am Tee.
Mein Freund macht zurzeit viele Überstunden, sagt Clémentine schließlich. Aber ich sollte trotzdem dankbar sein, wenigstens ist er in Paris.
Was macht er?
Er ist auch Anwalt. Ihm wurde gerade ein ziemlich großes Mandat übertragen, deswegen arbeitet er mehr als sonst. Er will den Fall unbedingt gewinnen. Ich hasse es!, sagt sie und lacht nervös. Ich wünschte, er wäre den ganzen Tag bei mir, dann könnten wir uns in den schäbigen Kinos an der Sorbonne alte Filme ansehen oder mittagessen gehen oder, ich weiß auch nicht, den ganzen Tag im Bett bleiben … Mein Vater hat immer nur gearbeitet. Meine Mutter auch. Ich bin es wohl nicht anders gewohnt. Aber ich hasse es trotzdem.
Was machen deine Eltern?
Sie unterrichten an der Uni. Philosophie und Mathematik.
Sie erzählt mir, dass sie im 5. Arrondissement aufgewachsen ist, in einer großen Wohnung an der Rue Claude Bernard, was ihren nachlässigen Studentinnenlook erklärt. Sie sieht aus, als hätte sie ihre Jugend damit verbracht, zu demonstrieren und Amnesty-International-Flyer zu verteilen. Sie trägt ein dickes, trotz der Hitze eng um den Hals geschlungenes Baumwolltuch, einen Oversize-Pulli mit V-Ausschnitt, eine Militaryhose und abgewetzte Chucks, die irgendwann einmal weiß waren. Unter dem Pullover blitzt ein Spitzentop auf, dessen Träger ihr ständig von der Schulter zu rutschen droht.
Mein Vater unterrichtet auch, am Lycée. Er ist Amerikaner, sage ich.
Ach, wirklich? Was unterrichtet er, Englisch?
Biologie. Eigentlich wollte er Arzt werden, aber dafür hat sein Zeugnis nicht gereicht. Er ist mit meiner Mutter zur Schule gegangen, sie war Austauschschülerin, und später haben sie dann beschlossen, nach Frankreich zu ziehen. Er hat hier studiert.
Aber Clémentine scheint bereits an etwas anderes zu denken. Sie zündet sich eine Zigarette an, steht auf, tritt ans Regal und scannt die Buchrücken ab wie auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Sie streicht mit dem Finger über die Freud-Gesamtausgabe. Ganz schön viel Psychoanalyse, sagt sie.
Ich bin Psychoanalytikerin, sage ich.
Noch eine! Anscheinend betreibt die Hälfte aller Pariser eine Therapiepraxis, und die andere Hälfte ist in Therapie, sagt sie im Scherz. Ich habe selbst mal daran gedacht, Psychologie zu studieren. War es sehr schwierig? Kommt mir so vor. Sehr naturwissenschaftlich. Vermutlich hat dein Vater dir geholfen? Sie zieht ein Buch von Lacan aus dem Regal, schlägt es auf, wirft einen längeren Blick hinein. Seminar 16, D’un Autre à l’autre. Von einem Anderen zum anderen. Homophob, sagt sie und stellt das Buch ins Regal zurück.
Na ja, er hat mein Interesse an Naturwissenschaften geweckt, obwohl sie nach dem Vordiplom ehrlich gesagt kaum noch eine Rolle gespielt haben. In der Nähe unseres Hauses gab es einen Teich, er hat mich auf Spaziergänge dorthin mitgenommen und mir das Ökosystem erklärt. Das empfindliche Gleichgewicht von natürlichen Lebensräumen. Falls es eine Störung gibt, ist das gesamte System betroffen. Zum Beispiel hat unser Hund als Welpe in dem Teich Frösche gejagt. Wir hätten ihn von den Fröschen fernhalten sollen, aber es war zu komisch zu sehen, wie sie vor seiner Nase rumgehüpft sind. Später, als er älter war, hat er die Frösche getötet. Die Fische konnten sich ungehindert vermehren, und irgendwann gab es nicht mehr genug Nahrung. Im Herbst trieben sie tot an der Oberfläche. Mein Vater musste in den Teich waten und sie rausfischen.
Aber hat er das Ökosystem damit nicht selbst gestört? Warum hat er nicht gewartet, bis die Fische sich zersetzen? Sie zieht ein weiteres Buch heraus, Janet Malcolms Fragen an einen Psychoanalytiker. Zur Situation eines unmöglichen Berufs, und setzt sich damit aufs Sofa.
Ich glaube, er wollte den Schaden begrenzen. Ich weiß es nicht mehr.
Das erinnert mich an ein Kunstwerk, das ich einmal auf der Documenta gesehen habe, sagt sie. Ich zucke die Achseln. Eine Ausstellung, die alle fünf Jahre stattfindet. Meine Eltern haben mich schon als Kind dorthin mitgenommen. Jedenfalls hatten sie in dem Jahr Pierre Huyghe eingeladen, einen französischen Künstler. Er hat einen Wald gestaltet, sehr schön, eine Mischung aus botanischem Garten und Komposthaufen. Man sollte darin herumgehen und nach einem Hund mit rosa Bein Ausschau halten oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wem der Hund gehörte, aber das Ganze war sehr surrealistisch. Wenn die Surrealisten sich für die Umwelt interessiert hätten. Es gab auch eine Skulptur von einer liegenden Frau, und ihr Kopf war ein Bienenkorb.
Ach, der! Ja, ich habe seine Bienen im Beaubourg gesehen.
Ja, sie wurden gleich nach der Documenta dort ausgestellt. Jedenfalls ging es um das Spannungsverhältnis zwischen der unberührten und der menschengemachten Natur – der Hund mit dem rosa Bein. Ich glaube, der Künstler wollte damit zum Ausdruck bringen, dass wir zwangsläufig Spuren in der Welt hinterlassen, das Anthropozän und so weiter. Aber unsere Spuren sollten schön und überraschend sein statt destruktiv.
Du weißt so viel über Kunst, sage ich. Ich habe kaum eine Ahnung!
Oh, ich studiere Kunstgeschichte, sagt Clémentine und drückt sich das geöffnete Buch an die Brust. Ich habe eben meinen Master gemacht, und jetzt weiß ich nicht, ob ich promovieren oder aufhören soll. Ich habe mir eine kleine Auszeit genommen, um mich zu entscheiden.
Ich bin überrascht. Ihr Auftreten vermittelt Erfahrung, durch Handeln gewonnenes Selbstbewusstsein. Wie kann sie immer noch eine Studentin sein? Woher bezieht sie ihre Selbstsicherheit? Ist sie angeboren? Liegt es am Geld? Wie alt bist du?, frage ich in der Hoffnung, nicht unhöflich zu klingen.
Vierundzwanzig, antwortet sie lächelnd. Ich weiß, die meisten Leute schätzen mich älter. Irgendwie ahne ich, dass ich das bald nicht mehr hören will.
Oh, nein, sage ich. So war das nicht gemeint.
Vielleicht werde ich Kuratorin, fuhr sie fort, oder ich mache einfach … etwas komplett anderes.
Nie zuvor habe ich einen Menschen getroffen, der nicht weiß, was er später einmal sein will. Ich frage: Und, wie verbringst du deine Zeit?
Ich habe keinen Plan, antwortet Clémentine. Es ist schön, so viel Freizeit zu haben. Ich engagiere mich ehrenamtlich für eine kleine Frauencommunity. Organisieren, demonstrieren und so weiter. Was das Berufliche angeht … Keine Ahnung. Ich schreibe Gedichte und fotografiere, will mich aber nicht festlegen. Ach ja, und dann sind da natürlich noch die Modeljobs. Damit verdiene ich mir ein bisschen was dazu.
Ich nicke, als wüsste ich, wie es ist, sich mit Modeln ein bisschen was dazuzuverdienen.
Ich erfahre alles Mögliche über Clémentine: den Namen des ersten Typen, mit dem sie Sex hatte (Thibault), und den des ersten Mädchens (Céline). Wie sie erzählt, war sie vor allem mit Frauen zusammen. Sie bezeichnet sich selbst als queer, weiß aber nicht, ob sie tatsächlich auf Frauen steht oder das nur glaubt, weil sie zu viel Pornografie aus der heterosexuell-männlichen Perspektive gesehen und somit gelernt hat, Frauen zu begehren. Wie würde, fragt sie, unsere Sexualität ohne den männlichen Blick aussehen? Ich erfahre, dass sie als kleines Mädchen Puppenspielerin bei Les Guignols werden wollte. Offenbar haben wir viele gemeinsame Interessen: Yoga, Tarot, Astrologie (sie: Fische, ich: Skorpion). Ich erzähle ihr, dass ich mit meinem Vater Englisch rede und als Kind die Sommerferien bei meinen amerikanischen Großeltern in Vermont verbracht habe. Dass meine Eltern mich als Frankoamerikanerin großziehen wollten und dass ich mich bei Familienurlauben in der Bretagne über den Gestank des trocknenden Seetangs auf dem Strand beschwerte. Meine französischen Cousins machten sich über mich lustig und nannten mich die dumme Amerikanerin. Um diesen Teil meiner Identität zu erforschen, hatte ich später in den Staaten studiert (am Bennington College, weil es in der Nähe meiner Großeltern lag), was aber leider meinen Eindruck, ein Mischwesen zu sein, nur noch verstärkte. Die Fehlgeburt verschweige ich Clémentine ebenso wie den Umstand, dass ich gerade krankgeschrieben bin. Ich schaue zu, wie sie die letzte Zigarette aus der Packung fischt und anzündet. Hinter ihr verfärbt die untergehende Sonne den Himmel, die Häuserwand gegenüber leuchtet in einem frühabendlichen Rosa, Orange und zuletzt Dunkelblau. Der Tee in der Kanne ist längst kalt geworden. Ich biete Clémentine einen Wein an, aber sie sagt, sie trinke keinen Alkohol. Ich muss los, fährt sie fort, heute Abend wollen wir dieses laotische Restaurant ausprobieren. Ist das in Ordnung?
Was? Natürlich. Ich muss ohnehin noch etwas lesen.
Heute Abend läuft diese Serie, sagt sie, wie hieß sie gleich … The Grass is Always Greener? Während ich sie zur Tür begleite, reden wir über den tröstlichen Surrealismus von Reality-TV. Beim Abschied fällt ihr das Buch von Janet Malcolm wieder ein. Es liegt auf dem Sofatisch. Kann ich es mir ausleihen?, fragt sie. Klar, sage ich, wenn du es wieder zurückbringst. Ja, natürlich, sagt sie. Versprochen. Ich lese es sofort.
Ich schließe die Tür hinter ihr, lehne mich kurz dagegen und höre die Sneaker meiner neuen Freundin auf den hölzernen Treppenstufen. Als die Schritte verhallt sind, gehe ich in die winzige Küche und schenke mir ein Glas Wein ein, und weil ich schon mal da bin, wechsle ich auch gleich den Wasserfilter. Ich sehe mich in dem unrenovierten, halbdunklen Raum um. Es gäbe hier so viel zu tun; ich fühle mich wie auf einem Minenfeld fremder Geschmacksentscheidungen oder als ränge ich mit der Vergangenheit. Die Küche müsste komplett entkernt und neu gestaltet werden, angefangen bei der Tapete in schimmeligen Orange- und Brauntönen. Hier und dort hat sie sich von der Wand gelöst. Die braunen Kacheln über dem Herd haben ein Eulenmotiv. Eulen, um Gottes willen! Man sollte sie von der Wand schlagen und mit einem Hammer zertrümmern. Den restlichen Mörtel abkratzen und neue weiße Métro-Fliesen mit abgeschrägter Kante anbringen, makellos sauber und frei von Öl- und Saucenspritzern. Als Nächstes eine neue Arbeitsplatte – ein Hackblock wie beim Metzger, bloß dass niemals Tierblut darüber fließen wird, denn wir ernähren uns vegetarisch, genau wie unsere zukünftigen Kinder. Anschließend die Küchenschränke, an deren geöffneten Türen wir uns ständig den Kopf stoßen. Wir werden sie von der Wand reißen (das wird ein Fest!) und stattdessen ehrliche offene Regale anbringen. Wir haben nichts zu verbergen. Hier sind unsere Gläser, dort die Teller. Als wir von offenen Regalen sprachen, räusperte Davids Mutter sich skeptisch. Die Gläser werden verstauben, sagte sie, ihr werdet sie ständig spülen müssen. Nicht wenn sie regelmäßig in Gebrauch sind, widersprachen wir, denn genau das hatten wir geplant; aber nun lebe ich hier quasi allein und benutze immer dieselben zwei Wassergläser und zwei weitere für Wein. Eins ist in Gebrauch, das andere in der Spüle. Die restlichen Gläser stehen in den Oberschränken aus Resopal, die wir beim Einzug vorgefunden haben. Wenn die neuen Regale angebracht sind, wird David hoffentlich, hoffentlich zurück sein.
Ich muss oft an die Frau denken, die früher hier gewohnt hat. Sie ist hier in der Wohnung gestorben. Ich habe nicht gefragt, in welchem Zimmer. Lungenembolie. Sie war ebenfalls Psychoanalytikerin, erzählte ihr Sohn, als er uns die Wohnung verkaufte. Eine der letzten Analysandinnen von Lacan, er hat sie ausgebildet, ergänzte er mit einem Anflug von Stolz. Oh, sagte ich, genau wie meine Lehranalytikerin! Ein beeindruckender Stammbaum. Ja, sagte er. Seine Mutter, eine französische Feministin, hatte viele Jahre lang in Yale unterrichtet; als er mir ihren Namen nannte, erkannte ich ihn sofort wieder. Im amerikanischen Universitätsbetrieb war sie eine ziemlich bekannte Theoretikerin gewesen, denn sie hatte den großen Denker – den Maestro, wie ihr Sohn ihn nannte – zu einer Vortragsreise in die USA geholt und damit zu seiner späteren Bekanntheit beigetragen. Sie war vor gar nicht langer Zeit nach Frankreich zurückgekehrt, um sich hier zur Ruhe zu setzen, aber dann …
Ich versuche mich an den Namen des Sohnes zu erinnern. Wie hieß er gleich? Isaac Soundso, sein Nachname war anders als der seiner Mutter und ein ziemlicher Zungenbrecher. Der Mann hatte irgendwie seltsam gewirkt, wie jemand, der schon seit langer Zeit trauert. Die Wohnung endlich los zu sein, hatte ihn unglaublich erleichtert, und wir waren unglaublich erleichtert, sie kaufen zu können. Die Räume selbst strahlten eine eigenartige Dankbarkeit aus, fast wie ein Hund, der endlich ein neues Zuhause findet und ein gutes Gefühl hat, was seine neuen Besitzer betrifft.
Aber ich nehme noch etwas wahr, eine Art Präsenz. Ihre vielleicht. Ich bilde mir ein, sie spüren zu können, solange die Eulenkacheln in unserer Küche hängen. Ihr Geist will uns nichts Böses, aber er muss verschwinden. Da sind zu viele Leute in unserer Wohnung.
Ich nehme das von Clémentine auf dem Sofa zurückgelassene Hochzeitsalbum in die Hand, blättere darin herum und bleibe am obligatorischen Kussfoto hängen: wir in inniger Pose, um uns herum applaudierende Freunde und Verwandte. Der dunkelhaarige David trägt einen hellgrauen Anzug, ich stehe in meinen roten High Heels wie auf Zehenspitzen. Unsere Kennenlernphase war kurz, aber intensiv, und nach etwa sechs Monaten heirateten wir standesamtlich. Hinterher gab es einen kleinen Empfang in einem gemieteten Château vor den Toren der Stadt, dessen symmetrische Gärten man durch die Fenster des Salons bewundern konnte. Das Glas der Scheiben war so alt, dass es aussah wie im Schmelzen begriffen; aber wer weiß, vielleicht hatte es beim Einbau vor dreihundert Jahren schon genauso ausgesehen. Der Tag war kühl, aber hell, und meine Mutter hatte sich stolz bei David untergehakt. Mein stattlicher Schwiegersohn! Seht ihn euch bloß an, sagte sie zu den Gästen. Das Album war ihr Geschenk zum ersten Hochzeitstag.
Ein paar Jahre später bezogen wir dann diese Wohnung in der Rue de Belleville, hoch oben auf dem Hügel, über dem l’Égyptien, wie alle den Mann mit dem Gewürzladen nennen, dem chinesischen Gemüseladen und dem algerischen Schlosser, der allen Klatsch des Viertels kennt, der Buchhandlung und dem Biosupermarkt, der schicken Weinbar und der schicken Cocktailbar, so hoch oben, dass man auf alle Dächer der Gegend blickt und noch viel weiter. Es ist die Pariser Wohnung, von der ich immer geträumt habe. Ich habe sie mir schon als Kind vorgestellt, wenn meine Mutter mich einmal im Jahr nach Paris mitnahm, um mir die weihnachtlich dekorierten Schaufenster der Galeries Lafayette zu zeigen. Danach tranken wir einen heißen Kakao im Angelina’s, wo ich mich sehr bemühte, nichts von dem sämigen, puddingartigen Getränk auf das von meiner Mutter ausgewählte, makellose Outfit zu kleckern. Ich stellte mir die Wohnung vor, als ich im verschneiten Neuengland studierte und bis spätabends am Schreibtisch saß. Und ich stellte sie mir vor, als ich auf der anderen Seite des Flusses in einer winzigen Dienstmädchenkammer wohnte, von deren Fenster es nichts zu sehen gab als die winzige Dienstmädchenkammer im Haus gegenüber.
Sie ist nicht groß, knapp siebzig Quadratmeter, aber größer als jede andere Wohnung, in der ich als Erwachsene gelebt habe. Die davor – diejenige, in der jetzt das Paar mit dem Baby wohnt – hatte höchstens fünfzig Quadratmeter, ein beengtes Zweizimmerappartement mit Laminatböden, dessen ursprüngliche Ausstattung herausgerissen wurde. Unsere neue Wohnung weist alle Haussmann’schen Details auf: in jedem Zimmer ein Kamin und darüber ein riesiger altersblinder Spiegel im Goldrahmen; Stuckdecken; vor den Fenstern schmiedeeiserne verschnörkelte Gitter; vor den Wohnzimmerfenstern ein umlaufender Balkon; original erhaltene Parkettböden. Als wir die Wohnung kauften, malte ich mir aus, wie ich Blumenkästen bepflanzen und in der Küche Kräuter ziehen würde; wir würden unsere Freunde zu Dinnerpartys einladen, Kerzen in den Kamin stellen und bei einer Flasche Wein bis tief in die Nacht unsere Zukunft planen. Nicht meine oder unsere jeweilige, sondern eine gemeinsame Zukunft, als gäbe es für uns nur diese eine und als wäre das Wir ein Floß, auf dem wir jede Strömung meistern könnten. All das würde erst noch kommen. Meine Praxis habe ich mir in einem Raum eingerichtet, der früher wahrscheinlich ein Einzelzimmer oder eine Dienstbotenkammer war – es gibt einen eigenen Zugang vom Treppenhaus –, irgendwann aber mit unserer Wohnung verbunden wurde. Wir wollten ein Kinderzimmer daraus machen, ich hätte irgendwo ein kleines Büro gemietet, um meine Klienten dort zu empfangen, aber dann gab es kein Kind.
Das Zimmer ist klein, die Wände sind von einer beruhigenden hellblauen Blümchentapete bedeckt. Ich glaube, das Material nennt sich Chintz. Meinen Sessel und die Couch habe ich so ausgerichtet, dass man von beiden zum Fenster hinausblickt, über die Dächer, denn ich hoffte, meine Patientinnen könnten die Aussicht ebenso therapeutisch finden wie ich. Ganz in der Nähe befindet sich eine Grundschule, und jeden Tag ab halb fünf gellen die aufgeregten Kinderstimmen bis in den fünften Stock herauf. Das Kreischen und das Trampeln der kleinen Füße auf dem Gehweg schießt am Gebäude empor wie eine Flipperkugel. In solchen Momenten halte ich inne und sehe zum Fenster, hinter dem die Dächer der Häuser von gegenüber in makelloser Uniformität als Linie stehen mit ihrer Schieferrüstung, den sanft geschwungenen Schrägen, den Kaminen, unterscheidbar nur durch abblätternde Farbe oder vereinzelte Graffiti. Und gleich dahinter: Paris. Wenn ich Paris betrachte, vergesse ich die Zeit. Welcher Tag ist heute? Welches Jahr? Immer wieder ein Klopfen an der Tür, eine Klientin, die hereinwollte und mich mit ihren Problemen ablenkte. Jetzt hilft mir die Aussicht, meine eigenen zu vergessen.
Der friedliche Ehealltag dauerte nur so lange, bis erste Splitter der Vergangenheit ans Licht kamen wie Rasierklingen, die ans Ufer eines vormals sauberen und nun verseuchten Flusses geschwemmt werden. Was in den Jahren vor David nicht gestimmt hatte, wusste ich nicht so genau. Vielleicht war unglücklich zu sein einfach meine Natur. Denn ich hatte keinen echten Grund dafür, kein Trauma, nichts von dem, was ich bei meiner Teilzeitstelle auf der Kinder- und Jugendstation des Sainte-Anne zu sehen bekam. Vielleicht bin ich auch deshalb Psychoanalytikerin geworden, weil ich die Traurigkeit verstehen wollte. Zu Beginn meiner Ausbildung belegte ich einen Analysekurs, in dem ich meine menschlichen Beziehungen aufarbeiten und benennen musste, inwiefern die anderen mich geprägt oder verletzt hatten. Meine Mutter. Mein Vater. Meine Freunde. Alle Begegnungen, Gespräche und Gefühle, die zusammenfließen und sich immer wieder neu anordnen, und heraus kommen Variationen, wie man sie in der Psyche so findet, Beulen, Kanten und Furchen. Nichts daran war wirklich ernst oder heikel. Meine Vergangenheit war eine völlig gewöhnliche Topografie aus Unzufriedenheit, Enttäuschung, Standardgefühlen der Unzulänglichkeit und Verlustängsten. Anfangs besuchte ich den Kurs dreimal wöchentlich, doch nach ein paar Semestern gab ich ihn auf und wurde selbst eine Therapeutin, eine Zuhörerin. Meinen Klienten war alles Mögliche zugestoßen, vom Banalen bis zum Unvorstellbaren. Probleme am Arbeitsplatz, eine Scheidung, frische oder längst vergangene Verlusterfahrungen. Im Saint-Anne lernte ich ein kleines Mädchen kennen, dessen Mutter im Bataclan gestorben war. Einige konnte ich bei der Bewältigungsarbeit unterstützen; ich half ihnen, Verbindungen zu sehen oder das Geschehene in ein Narrativ zu bannen. Ich betrachtete es als meine Aufgabe, das Puzzle zusammenzusetzen und ein Schlaglicht auf Muster, Sorgen, Erinnerungslücken zu richten.
Das also war mein Leben. Ich arbeitete an mir, an meinen Patienten und an meiner Wohnung, bis wir das Kind verloren und alles wegbrach, alles außer der Therapie, die sich intensivierte. Ich traf mich mit Esther, meiner alten Analytikerin, zur sogenannten Supervision – eine Art Nachkontrolle, die zugleich eine reinigende Wirkung hat und sicherstellen soll, dass bei der Therapeutin alles in Ordnung ist, sie nicht komplett den Verstand verloren hat und weiterhin Menschen behandeln darf. Esther war allerdings klar, dass bei mir alles andere als in Ordnung war. Sie schrieb mich krank, und plötzlich war ich keine Therapeutin mehr, sondern eine Patientin. Seither besuche ich sie pflichtbewusst viermal pro Woche.
Esther riet mir, Tagebuch zu führen und jeden Morgen zu schreiben. Sie sagte mir, ich solle über Begriffe wie Subjektivität und Objektivität nachdenken. Aber meistens sagt sie nur wenig. Ist die Wohnungsrenovierung in Wahrheit vielleicht nur der Versuch, unter Kontrolle zu bekommen, was sich letztlich nicht kontrollieren lässt?, fragte ich sie eines Vormittags. Sie antwortete nicht. Es ist gut, sich in ein Projekt stürzen zu können, fuhr ich fort, warf einen Blick aus dem Erdgeschossfenster, sah eine Toreinfahrt und vermisste sofort meine Pariser Aussicht. Ich möchte Klarheit darüber gewinnen, warum ich mir diese Renovierung in den Kopf gesetzt habe, sagte ich und betrachtete die dezenten blonden Highlights in Esthers Haaren, die anscheinend nicht die Funktion hatten, graue Strähnen abzudecken, ihre schmalen Schultern in der hellbraunen Kaschmirstrickjacke, die weiche, knittrige Haut am Dekolleté, die aussah, als hätte man Seidenstoff in der Faust zusammengeknüllt und dann wieder ausgebreitet. Bei unseren ersten Sitzungen wollte ich ihr unbedingt gefallen; indem ich eine gute Analysandin war, wollte ich ihr meine Eignung zur Therapeutin beweisen. Mir war kein Terrain zu schmerzhaft, ich preschte barfuß voran und ließ nichts aus. Nach einer Weile fühlte es sich irgendwie mechanisch an.
Ich bemühte mich dennoch, drückte mein Ohr an die Außenmauern meines Unbewussten und lauschte auf das Echo dessen, was dort vor sich ging. Bei einer anderen Sitzung versuchte ich zu ergründen, welche Gefühle die Tatsache in mir auslöste, dass David jetzt in einer anderen Stadt arbeitete. Er wollte nicht ins Ausland, aber ich hatte ihn ermutigt. Ich habe ein bisschen Angst, ihn zu verlieren, sagte ich, ohne zu wissen, ob das wirklich stimmte. Doch es klang plausibel, vielleicht war es tatsächlich so, wer weiß. Ich glaube nicht, dass er mich je verlassen würde, es sei denn, ich … Ich versuchte mir vorzustellen, was David abschrecken könnte, aber mir fiel nichts ein. Ich glaube, sagte ich, er würde mich nicht einmal verlassen, wenn ich ihn betrügen würde. Esther wartete. Aber ich habe Angst, er könnte mich nicht mehr so lieben wie vor der Fehlgeburt. Ich möchte ihn glücklich machen, aber ich weiß nicht, ob er glücklich ist. Wahrscheinlich nicht. Wir sind nicht glücklich. Was weiß ich. Man liest ja immer davon, wie solche Ereignisse Paare auseinanderbringen. Weil sie ständig mit der unendlichen Trauer des anderen konfrontiert werden, kommen sie mit dem Unglück nicht zurecht. Könnte es sein, dass ich ihn verlasse, indem ich ihn nach London schicke?, fragte ich. Um ihm meine Gefühle zu ersparen? Dann wiederum ist es ja nicht so, als wäre uns etwas wirklich Schreckliches passiert. Ich hatte eine Fehlgeburt. Ich weiß nicht, wie niedergeschlagen ich sein darf, was angemessen wäre.
Was ist denn angemessen?, antwortete sie, undurchschaubar wie immer. Sie ist ein Spiegel, ein Echo.
Aber wenn ich am Morgen allein aufwache, wenn ich abends allein ins Bett gehe; wenn ich nur für mich koche und anschließend vor dem Laptop esse und die Netflix-Serie binge, die mich durch die Woche bringt, habe ich nur einen Wunsch: wieder ein normales Leben zu führen. Sonntags zum Wald von Fontainebleau zu fahren, zu lange spazieren zu gehen und im Dunkeln das Auto nicht wiederzufinden. Meine Eltern zum Abendessen zu besuchen und am nächsten Morgen mit dem TGV nach Hause zu fahren. Davids Bruder zum Fußballschauen einzuladen. Mich über eine nervige Angewohnheit von David zu beschweren und mich ins Büro zurückzuziehen.
Ich wünschte, es gäbe hier etwas, von dem ich mich zurückziehen könnte.
Trotz der Hitze gehe ich jeden Morgen joggen. Ich laufe nach Buttes-Chaumont, einmal um den Park und wieder nach Hause. Die Runde dauert ungefähr eine Stunde. Es ist eine der verschwommensten Stunden des Tages, und das gefällt mir. Ich bin in meinem Körper, und das ist alles. Das ist alles. Das ist alles.
Beim ersten Mal passierte etwas Seltsames. Ich joggte vor dem Frühstück und hatte mein Geld vergessen. Auf dem Rückweg hatte ich vergessen, dass ich mein Geld vergessen hatte, und betrat eine Bäckerei, um mir etwas zu kaufen. Ich nahm mir die Kopfhörer raus, war immer noch in der Musik verloren. Als ich an der Reihe war, trat ich vor, gab meine Bestellung auf und merkte erst beim Bezahlen, dass ich nichts dabeihatte. Ich wollte mich schon entschuldigen, dann eben nicht, als der Mann hinter mir sagte: Wenn ich darf, bezahle ich das Brot der jungen Frau.
Ich drehte mich um. Der Mann machte einen vertrauenswürdigen Eindruck. Groß, kurze graue Haare, dickes schwarzes Brillengestell. Ein älterer, kultivierter Mann mit auffällig gepflegter Gesichtshaut. Er lächelte nicht, aber dann irgendwie doch. Ich wollte ablehnen, aber er bestand darauf. Mais je vous en prie, madame. Danach ging ich bergab, überzeugte mich, dass er mir nicht folgte, riss ein Stück Baguette ab und verschlang es im Gehen, als müsste ich meinen Hunger vor ihm verbergen.
Was hat es zu bedeuten, wenn ein älterer Mann das Brot bezahlt? Die Geste war ebenso großzügig wie überflüssig, und danach spürte ich ein leichtes Unbehagen. Gleichzeitig schaffte sie eine Art Verbindung zwischen uns; wann immer wir einander begegnen, plaudern wir kurz, und er bezahlt mein Brot, egal wie lautstark ich protestiere. Er will sich weder unterhalten, noch will er mich kennenlernen; im Gegenteil, er benimmt sich, als kenne er mich längst. Ich glaube, irgendwann werde ich in die Bäckerei gehen, der Verkäuferin Geld geben und sagen: Das ist für meine nächsten zehn Baguettes und seine.
Oder auch nicht, denn das Geld ist gerade knapp.
Weil ich bei jeder unserer Begegnungen Sportklamotten trage, lobt er mich oft für meinen gesunden Lebensstil. Manchmal nickt er nur und sagt: Bonne continuation, als wäre jeder neue Tag die Fortsetzung einer lebenslangen Fitnessübung. Was auch stimmt: Seit meiner Teenagerzeit gehe ich joggen und mache Krafttraining, Step Aerobic, Hot Yoga, Zumba oder was auch immer gerade in Mode ist. Anfangs bin ich mit meiner Mutter zum Sport gegangen, später dann alleine. Mein Freund aus der Bäckerei wirkt ziemlich fit. Wahrscheinlich spielt er Tennis. Zweimal pro Woche in irgendeinem Club, Doppel. Oder vielleicht auch Squash mit einem alten Schulfreund, der seine geschiedene Frau kennt und alle seine Ex-Freundinnen.
David bewegt sich kaum, er isst, worauf er Lust hat, macht keinen Sport und bleibt trotzdem dünn. Selbstfürsorge ist nicht sein Ding. Einmal habe ich beobachtet, wie er sich für die Arbeit fertig macht. Er duscht, was allerhöchstens zehn Minuten dauert. An manchen Tagen rasiert er sich in fünf, maximal zehn Minuten. Er putzt sich die Zähne. Geht auf die Toilette. Sucht ein Hemd, einen Pulli und eine Hose heraus. Zieht sich Socken und Schuhe an. Fertig.
Ich brauche morgens sehr viel länger und abends vor dem Schlafengehen auch, ganz zu schweigen von dem komplizierten Entscheidungsgeflecht, das dem Ankleiden vorausgeht. Es gibt eine fast unendliche Zahl von Produkten, die für einen laufenden Feldzug benötigt werden, schließlich will ich jung, dünn und ausgeruht erscheinen und, wenn ich Glück habe und alle Mittel wirken, auch hübsch. Creme für mehr Glanz (meine Haare sind eher trocken). Eine Art Puder für mehr Volumen (sie sind auch zu glatt und zu dünn). Mizellenwasser, daneben Wattepads und ein Becher mit Wattestäbchen. Fettfreier Augen-Make-up-Entferner. Evian in einer Sprühflasche. Zwei unterschiedliche Seren. Tagescreme, Nachtcreme (premières rides d’expression). Sonnenschutz, den ich in die Tagescreme mische (LSF 50), weil ich sehr helle Haut habe. Als ich klein war, schützte meine Mutter mich immer vor der Sonne – große Hüte, breite Schirme –, weil ihre Mutter das vergessen habe, wie sie sagte, und sie nun dafür bezahle. Creme für die Augen, Creme für die Oberschenkel. Bodylotion. Fußsalbe. Ein täglich benutztes Parfum. (Drei andere sammeln Staub an.) Zwei schwarze Eyeliner (einer fest, einer flüssig). Concealer. Puder. Lidschatten in unterschiedlichen Schattierungen. Mehrere Lippenstifte. Mehrere Lipgloss (keins davon neu). Rouge als Creme und als Puder. Unterschiedliche Bürsten, Nagelfeilen, Haarnadeln, Spangen, Pinzetten, Proben, die ich eines Tages vielleicht verwende und die, als ich für von mir tatsächlich gebrauchte Produkte bezahlte, von der Verkäuferin in die Tüte geworfen wurden in der Hoffnung, ich könnte zurückkommen und die reguläre Packungsgröße kaufen.
Mithilfe dieser Mittel erzeugt ein Mensch einen bestimmten Eindruck von Weiblichkeit, die plötzlich nicht mehr nur ein Konglomerat aus Organen, Knochen und Fleisch ist, ein ehemaliges Babygehäuse, jetzt ein neutraler Organismus, der keinen anderen Zweck mehr verfolgt als den Selbsterhalt. Die Elemente meiner täglichen Erneuerung und die erste Verteidigungslinie gegen das Unvermeidliche. Angefangen hat es mit einem alten Lippenstift, den meine Mutter mir überließ, als ich zwölf war, und wie ich vermute, wird es weitergehen, bis ich tot bin und im Bestattungsinstitut für meine Beerdigung geschminkt werde, und dann verschwinde ich in der Erde oder im Feuer.
Einige meiner Patienten werden einzig und allein von der Tatsache, dass sie altern, in meine Praxis getrieben. Der Verstand nutzt sich ab wie der Körper, was manchmal beunruhigend ist. Wenn sie gegangen sind, blicke ich aus dem Fenster und mache mir bewusst, dass dieses Fenster und diese Aussicht vor mir da waren und noch existieren werden, wenn ich schon lange nicht mehr bin. Ich frage mich, ob die Aussicht, mit wenigen Ausnahmen seit mindestens einem Jahrhundert dieselbe, sich sehr verändern wird. Jedes Gebäude mit einer eigenen Geschichte. Das Haus gegenüber ist recht alt für dieses Viertel, 18. Jahrhundert. Das dort drüben entstand im 19., Haussmann. Ein anderes sieht nach späten 1980ern aus. Werden Bomben, die Zeit, eine Flut oder ein Feuer diese Aussicht verändern?
Im August wollten wir Urlaub machen und Abstand gewinnen von dem, was passiert war, Abstand zur Stadt, zur Hitze, den Touristenmassen, den Ladengeschäften mit den dauerhaft heruntergelassenen Gittern, CONGÉS D’ÉTÉ REOUVERTURE FIN AOUT. Aber dann nahm David das Jobangebot aus London an und sollte sofort anfangen. In London nimmt sich niemand den ganzen August frei und hier eigentlich auch nicht, denn Belleville brummt vor Geschäftigkeit. Die reichere Hälfte der Stadt redet über nichts anderes als ihre vacances, damit die andere, die ohne Zeit und Geld, sich schlecht fühlt. Außerdem brauchen die Angestellten der öffentlichen Verwaltung eine Ausrede, nicht auf E-Mails antworten zu müssen. Dennoch tun alle so, als wären alle anderen verreist.
Fairerweise muss ich sagen, dass viele meiner Bekannten tatsächlich im Urlaub sind. Meine Freundinnen haben sich eine nach der anderen verabschiedet und sind zu ihren Landhäusern oder Ferienwohnungen gefahren. Meine Therapeutin ist wie jeden Sommer im Süden und nur im Notfall zu erreichen. Und zuletzt ging auch David.
Bis kurz vor seiner Abreise dachten wir, ich würde ihn begleiten. Er hatte eine Wohnung in East London gefunden, und unsere wollten wir zeitweise untervermieten. Alles war schon geplant. Neue Stadt, neues Leben. Ich hätte dort arbeiten können. Die Leute werden eine echte französische Psychoanalytikerin lieben, sagte er, und dazu sprichst du auch noch Englisch. Es wäre perfekt! Doch am Ende konnte ich mich nicht dazu überwinden. Ich möchte dich nicht allein lassen, sagte David, worauf ich antwortete: Ich werde nicht allein sein, denk an all die Leute da draußen. Das bedeutet nicht, dass du nicht allein sein wirst, sagte er. Okay, sagte ich, dann lass mich eben nicht allein. Ich komme dich an den Wochenenden besuchen, sagte er, und genau das hat er meistens getan.
Das Schlimmste an Paris im August sind nicht die Touristen, sondern die Daheimgebliebenen, die glauben, sie hätten die Stadt nun für sich allein und könnten zu jeder Tages- und Nachtzeit Partys feiern. Eine Party im Haus gegenüber ging einmal bis fünf Uhr morgens. Die Gäste hielten mich mit ihrem Lachen und Johlen, Grölen und Singen wach, mit Rihanna und Madonna. Als nette Überraschung spielten sie zwischendurch Céline Dions »On ne change pas«, trop ringard, trotzdem hat mir der Song vor etwa einer Million Jahren, als ich nach Paris zog und niemanden kannte, sehr viel bedeutet. Er lief ständig im Radio, und irgendwie half er mir zu entscheiden, wie ich mein Leben gestalten wollte. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte zu der jungen Frau von damals Kontakt aufnehmen und ihr etwas sagen, ich weiß bloß nicht, was.
Als der Song endet und ein anderer, schlechterer beginnt, spiele ich mit dem Gedanken, die Beschwerdehotline anzurufen. In Momenten wie diesen frage ich mich: Warum bin ich nicht bei meinem Mann in London. Was stimmt mit mir nicht.
Im August sind alle Pariser Gerüche intensiver, Körper und Parfums, der warme Gummigeruch aus den Lüftungsschächten der Métro, der muffige Häuseratem aus geöffneten Kellerfenstern, der künstliche Brotbackduft der zweitklassigen Boulangerien, Hopfen und Holzpolitur aus den Irish Pubs und immer und überall der Zigarettenqualm. Heute werden es vierunddreißig Grad. (Inzwischen erreichen die Sommertemperaturen Zahlen, die es in meiner Kindheit nicht gab – vierunddreißig, fünfunddreißig, sechsunddreißig.) Abends sitze ich allein in meinem Sprechzimmer und sehe hinaus, bis es Nacht geworden ist. Der Sonnenuntergang steht als rote Linie am Horizont, und es sieht aus, als hätte die Erde eine Entzündung.
Allein in meiner Wohnung, das ist mein liebster Zustand. Ich kann essen, was ich will und wann ich will. Und während ich esse, was ich will, schaue ich, was ich will. Sauber mache ich erst am nächsten Tag, und ich muss meine Zeitplanung auch nicht nach anderen Leuten richten, nach David oder meinen Patienten. Außerdem hat das Alleinsein eine physische Komponente. Ich nehme den Raum um mich herum anders wahr. Nicht dass es stiller wäre; es ist eher so, dass ich die Stille körperlich erfahre. Ich existiere auf andere Weise in der Atmosphäre.
Ich sehe aus dem Küchenfenster und entdecke ein Licht in einem der Dachfenster gegenüber. Das Gebäude ist dunkel, hebt sich aber deutlich vom Himmel ab, und plötzlich habe ich das Gefühl, das erleuchtete Dachfenster zu sehen, wie andere vor mir es gesehen haben, hundert Jahre lang. Das Licht selbst hat sich wahrscheinlich verändert – erst Kerzen, dann Gas, zuletzt elektrischer Strom. Sicher waren die Veränderungen eher subtil; aus den bewegten Kerzenschatten wurden die starren Umrisse des elektrischen Lichts. Ich fühle mich wie aus der Zeit gefallen.
Das Gefühl der Haltlosigkeit spiegelt sich in meinen Gewohnheiten wider. Ich gehe kaum noch ans Handy. Ich schalte den Fernseher ein statt den Laptop. Eine echte psychologische Verschiebung; statt ganz bestimmter Serien (lass uns The Wire schauen; ich habe noch nie die Sopranos gesehen; wäre es an der Zeit für BreakingBad?) überlasse ich mich dem unberechenbaren TV-Programm. Es fühlt sich an, wie durch eine Menschenmenge zu gehen oder über eine Kirmes auf dem Land; ich hatte ja keine Ahnung, was die Leute alles so machen (und während ich mein Leben in unterschiedlichen Wohnungen verbracht habe, waren sie da draußen und haben alles Mögliche angestellt. Zur selben Zeit!). Ich zappe und sehe, wie die Leute im Garten arbeiten oder Jazz spielen und wie Weltraumexperten darüber spekulieren, was die USA als Nächstes planen; eine Dokumentation über den TGV; einen alten Film über Vincent van Gogh, in dem eine sehr junge und sehr schöne Elsa Zylberstein eine Prostituierte in einer Art Flussuferbordell spielt. Ich lande in einer Talkshow, in der Frauen über die Beschwerlichkeiten des Mutterwerdens sprechen. Darüber, dass unsere Gesellschaft aus der Mutterschaft eine kapitalistische Institution gemacht hat, die sich outsourcen lässt und gleichzeitig einen Wettbewerb bedeutet. Die Frauen berichten von einer entfremdeten Geburtserfahrung und betrauern den Verlust ihres Jobs, ihres Körpers, ihrer Identität. Ich schalte zurück auf Elsa Zylberstein.
An manchen Tagen kann mich nicht bewegen und liege stundenlang auf dem Bett wie unter einer riesigen Klarsichtfolie.
Oder ich stehe am Fenster, während der Himmel draußen sein Ding macht.
Unter der Dusche drehe ich das warme Wasser ab und das kalte auf. Es fühlt sich gut an und zugleich verstörend.
Eines Morgens, ich bin auf dem Rückweg von meiner Joggingrunde, entdecke ich an der Wand des Nachbarhauses einen Schriftzug:
TU N’ES PAS SEULE
Doch mir bleibt nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, weil ich im Hof Clémentine in die Arme laufe. Sie bedankt sich für das Buch von Janet Malcolm, das sie schon fast durchhat und bald zurückbringen will. Sie möchte über das Konzept der Übertragung sprechen, das sie nie so richtig verstanden hat. Angeblich behauptet Malcolm, Übertragung sei der Grund, warum wir die Menschen, mit denen wir zusammenleben, niemals wirklich kennen können; statt sie zu sehen, wie sie sind, erfinden wir sie zu unseren Zwecken. Wir können einander einfach nicht sehen, heißt es bedeutungsschwer. Genau darüber habe ich versucht zu schreiben, sagt Clémentine. Können wir darüber reden?
Komm vorbei, wann du willst, sage ich.
Im Treppenhaus habe ich die alte Frau aus dem sechsten Stock vor mir. Wir steigen als Tandem hinauf, sehr langsam. Ich möchte nicht drängeln. Ich habe es nicht eilig. Manchmal höre ich ihr Radio. Das letzte Mal ist aber schon eine Weile her, ich hatte mir fast schon Sorgen gemacht, ihr könne etwas passiert sein. Vielleicht war sie verreist, um eins ihrer Kinder zu besuchen? Wir haben uns einander nie vorgestellt, und jetzt ist es zu spät. Wir sagen nur bonjour und steigen langsam die Treppe hoch, hintereinander.
Mitten in der Nacht weckt mich ein schlechter Traum, der eigentlich ein guter war. In dem Traum war ich schwanger. Ich war wieder in der Vergangenheit und immer noch schwanger. Ich war sehr erleichtert zu merken, dass ich das Baby gar nicht verloren hatte. Und dann wache ich auf und bin wieder vollkommen verzweifelt.
Ich gehe in mein Sprechzimmer, schalte die Schreibtischlampe ein und hole mein Tagebuch heraus. Ich habe versucht, alles mitzuschreiben, was wir zusammen erlebt haben, David und ich, weil ich verstehen möchte, warum ich auf diese Weise auf die Fehlgeburt reagiere (überreagiere?). Mein Mann lebt in einem anderen Land, vielleicht ist es so einfach, dann wiederum ist nichts so einfach. Vielleicht war es das einmal, früher. Oder doch nicht? Wir sind beide eher ruhige Menschen und stets um Klärung bemüht. In der Frage, was das für uns bedeutet, sind wir allerdings uneins. David glaubt, es bedeute, dass wir füreinander bestimmt seien. Die Person, die man heiratet, liebt man mehr als jede andere, denn sonst hätte man eine dieser anderen geheiratet, sagt er. Das war sehr nett von ihm, vielleicht hat er es selbst geglaubt, aber er irrt sich. Ich habe jeden Menschen, den ich je geliebt habe, so geliebt wie ihn. Und diejenigen, mit denen es nicht geklappt hat, habe ich, obwohl ich das ihm gegenüber niemals zugeben würde, vielleicht sogar noch mehr geliebt, weil sie verloren waren oder weil ich wusste, ich würde sie verlieren. Doch vielleicht handelt es sich hier um eine andere Art von Liebe, um die zum Scheitern verurteilte, wogegen David und ich die dauerhafte Liebe erleben, die Liebe, für die man sich nicht zu sehr anstrengen muss.
Das Problem daran, die letzte Person zu sein, die jemand in seinem Leben lieben wird, ist genau das: Du bist die letzte. Du stehst am Ende einer langen Liste von Wünschen, Sehnsüchten, fleischlichen Passungen und vorübergehenden Übersättigungen. Ich fand die Vorstellung nahezu unerträglich. Nicht dass ich mit irgendwem aus Davids Vergangenheit tauschen wollte; doch der Gedanke an sein auf eine andere Frau gerichtetes Verlangen ließ mich vor Wut erbeben. Ich verstand es selbst nicht, doch anscheinend konnte ich ihm nie verzeihen, dass er andere Frauen begehrt hat. Vielleicht lag es an meiner Befürchtung, er würde mir, falls er davon erfuhr, nie vergeben, wie sehr ich andere Männer begehrt hatte.
Einmal habe ich im E-Mail-Eingang eines meiner Freunde nachgeschaut, ob er weiterhin Kontakt zu seinen Ex hatte. Natürlich fand ich genau das, wonach ich suchte. Eine kurz nach unserem Kennenlernen verfasste Mail. Die Frau hieß Aude. Er schrieb ihr, dass er eine neue Freundin habe, aber immer noch an sie denken müsse. Er schrieb, er vermisse die eigenartige Schönheit ihrer Beziehung. Als ich den Ausdruck las, zuckte ich vor dem Computer zurück. Regte ich mich so auf, weil er einer anderen Frau so etwas schrieb oder weil er zu mir niemals etwas Vergleichbares gesagt hatte? Ich googelte ihren Namen, fand aber nichts. Besser gesagt fand ich zu viel, denn ihr Nachname war ebenso geläufig wie ihr Vorname. Es gab zu viele Treffer, und meine Suchanfrage löste sich in der Ungewissheit auf. Genau wie die Beziehung.
Bei einem anderen meiner Freunde stieß ich beim Wühlen in einem Schuhkarton, den ich ganz hinten in seinem Schrank gefunden hatte, auf eine Erklärung dafür, dass alle Leute, denen er mich vorstellte, der Überzeugung waren, mich längst zu kennen. In dem Schuhkarton fand ich Fotos von meinem Freund und einem Mädchen, das aussah wie ich. Es war unheimlich. Manche Menschen sind einfach auf einen bestimmten Typ festgelegt, sagte eine Freundin. Dünn, weiß, braune Haare – du bist nicht gerade einzigartig, weißt du. Dennoch war die Ähnlichkeit zu groß, um sich unter »einen Typ haben« verbuchen zu lassen. Ich fragte mich, ob ich ein Echo der anderen war oder die andere eine Platzhalterin für mich.
Vielleicht ist es das Beste, nichts über die Vergangenheit zu wissen. Einmal lernte ich jemand Neues kennen und weigerte mich beharrlich, ihm von meinen vergangenen Beziehungen zu erzählen, und genauso wenig wollte ich über seine hören. Nach der Trennung fragte ich mich, ob ich offener hätte sein sollen. Aber es gab einfach zu viel, womit ich mich damals noch nicht auseinandersetzen und was ich ihm nicht anvertrauen wollte.
Mit David war es entspannter; er kennt die ungefähren Umrisse meiner Vergangenheit und vice versa. Ich habe noch nie in seinen Mails gestöbert. Einmal öffnete ich in seiner alten Wohnung auf der Suche nach einem Stift eine Schreibtischschublade und entdeckte einen Haufen Notizen, Fotos und Postkarten von anderen Frauen. Die Überreste seiner romantischen Geschichte. Ich schloss die Schublade wieder. Nachdem wir zusammengezogen waren, fragte ich mich, ob er die Andenken mitgenommen hatte. Ich suchte nie danach. Ich wollte, dass wir einander völlig neu begegneten. In welcher Gestalt hatte ich früher neben ihm gelegen, war ich kleiner, größer, dicker, dünner, dunkler, heller als seine Verflossenen? Intelligenter, dümmer, lustiger, stiller? Ich wollte mich nicht mit einem weiteren Satz Eigenschaften vergleichen müssen. Ich wollte die Geister aus unserem Schlafzimmer fernhalten.
Einander völlig neu zu begegnen. Ein Ding der Unmöglichkeit.
All das erzähle ich Esther bei unserer nächsten Sitzung. Ich spreche über den Schuhkarton und das Mädchen, das mir so ähnlich sah. Über meine Eifersucht.
Vielleicht liegt der Schlüssel darin, dass Sie sie in der Vergangenheit nicht kannten, im Gegensatz zu Ihren damaligen Partnerinnen. Unserer Eifersucht liegt der Wunsch zugrunde, mehr über den geliebten Menschen zu erfahren, gleichzeitig wissen wir, dass das unmöglich ist. Wer ist er, wenn wir nicht bei ihm sind?
Clémentine kommt rüber, um mir das Buch von Janet Malcolm zurückzugeben und weil sie auf der Flucht vor ihren Umzugskartons ist. Ich verstehe nicht, sagt sie, wieso ich es nicht schaffe, endlich auszupacken. Es ist ja nicht so, als hätte ich keine Zeit. Ich finde, Jonathan sollte mir helfen, aber er will nicht. Er hat überhaupt kein Problem damit, aus Kartons zu leben.
Männer, sage ich kopfschüttelnd.
Er arbeitet so viel, sagt sie, aber ich bin den ganzen Tag zu Hause, schreibe Gedichte und masturbiere.
Klingt gar nicht übel, sage ich.
Sie sitzt auf dem Sofa und trägt ein kurzes zerknittertes Sommerkleid. Wenn ich Jonathan bitte, ein paar Kartons auszupacken, sagt er, dass schon August ist, wir werden bald verreisen, wir kümmern uns nach der Rückkehr darum.
Wo macht ihr Urlaub?
Bei meiner Familie in der Normandie. Er war noch nie da. Wir werden schwimmen gehen. Verreist du auch?
Nein. Ich hatte mir überlegt, meine Eltern zu besuchen, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich Lust darauf habe. Vielleicht fahre ich nach London. Oder auch nicht.
Sie beobachtet mich, möchte etwas sagen, überlegt es sich anders. Wir schweigen. Ich halte es aus.
Janet Malcolm, sagt sie nach einer Weile. Du weißt ja, ich bin kein großer Fan von Psychoanalyse, dieses Konstrukt namens Mami-Papi-Ich macht mich skeptisch; es ist ja nicht so, als würden wir von niemandem sonst geprägt. Dazu dieser binäre Ansatz, was Gender betrifft. Weißt du, was ich meine? Als hätte man das Patriarchat destilliert und in Flaschen abgefüllt.
Ich weiß, was du meinst.
Ich kenne so viele Therapeuten, aber bis heute hat mir noch keiner von denen erklären können, wie Psychoanalyse die Gesellschaft besser machen soll. Aber Malcolm? Das Buch ist super. Na ja, es ist natürlich ein bisschen überholt, und die Homophobie ist wirklich grausig, wobei sie eher von diesem Typen ausgeht als von ihr, von dem Analytiker, oder? Ich finde es toll, dass sie dem Kult um die Psychoanalyse misstraut, obwohl sie ein Buch darüber schreibt.
Aber glaubst du wirklich, reden könne heilsam sein?, fährt sie nach einer Weile fort. Glaubst du, dass es mir, wenn ich ein Problem habe und jahrelang mit dir darüber rede und auch über meine Eltern und so weiter, dass es mir dann irgendwann besser geht? Ich war nämlich in Therapie, und ich fand es nicht besonders hilfreich.
Na ja, sage ich, es ist ein bisschen komplizierter. Ich verfolge eher Lacans Ansatz. Es geht weniger darum, ein Narrativ zu finden, das deine Symptome erklärt und heilt, als um das, was der therapeutische Prozess hervorbringt, und darum, dass unser Sprechen uns etwas über unser Leben verrät, wie wir darüber denken und was wir wollen. Es geht um unser Begehren und wie wir damit leben können, statt uns davon leiten zu lassen. Man wird in dem Sinne nicht geheilt. Es gibt kein Heilmittel gegen das Menschsein.
Hm, macht sie unzufrieden.
Hast du Deleuze und Guattari gelesen?, fragt sie, und ich muss ein Lächeln verbergen. Sie hat sich noch keine Schutzschicht zugelegt, die sie davon abhalten würde, offene Fragen wie diese zu stellen. Ich sehe ihre Ernsthaftigkeit, ihre Sehnsucht nach einer echten Verbindung, die über das Alltägliche hinausgeht und die sie im Alltag nicht finden kann. Ich vermute, dass ihr Partner weder Deleuze noch Guattari gelesen hat, sie es sich aber wünschen würde.
Ich finde, redet sie weiter, ihre Kritik an Freud sehr überzeugend. Sie lehnen die Vorstellung ab, dass wir nur diese eine Sache sind, eine Einheit mit einer einzigen prägenden Vergangenheit. Ihre Vorstellungen vom Ich und vom Begehren sind sehr vielschichtig. Ich finde das wichtig. Sie sind fluide. Revolutionär.
Auf einmal fühle ich mich ins Studium zurückversetzt; ich sitze wieder in der Nationalbibliothek und ringe mit Anti-Ödipus. Gerade als ich ihr zustimmen will, springt sie zu einem anderen Thema weiter.
Wann hattest du deinen ersten Orgasmus?, fragt sie.
Hm. Ich kann mich nicht erinnern. Lass mich nachdenken. Und du?