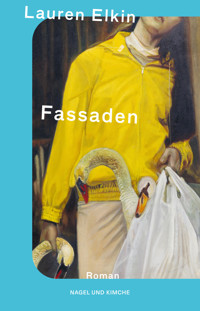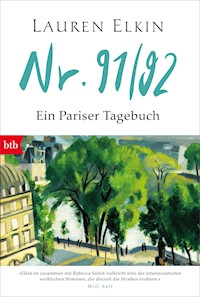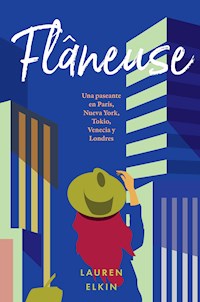3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die Flâneuse - Virginia Woolf in London ist eine von ihnen, Jean Rhys in Paris, Holly Golightly in New York. Sie alle erobern sich selbstbewusst Städte, Menschen und Gedanken. Sie sind neugierig, klug und unabhängig, reisen, wohin sie wollen und genießen die Freiheit der Großstadt. Die Autorin und Essayistin Lauren Elkin folgt den Spuren außergewöhnlicher flanierender Frauen, indem sie selbst durch das heutige Paris, New York, London, Venedig und Tokyo spaziert. Sie lässt sich treiben durch Städte, Literatur, Kunst und Geschichte und zeigt in ihrer Geschichte des weiblichen Flânierens wie berauschend es sein kann, sich eine Stadt zu erobern, was lange nur Männern vorbehalten war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
»Wenn wir in der Zeit zurückreisen, war da schon immer eine Flâneuse, die auf der Straße an Baudelaire vorüberging.« Die Autorin und Essayistin Lauren Elkin folgt den Spuren außergewöhnlicher flanierender Frauen, indem sie selbst durch das heutige Paris, New York, London, Venedig und Tokio spaziert. Sie lässt sich treiben durch Städte, Literatur, Kunst und Geschichte und zeigt in ihrer Geschichte des weiblichen Flânierens wie berauschend es sein kann, sich eine Stadt zu erobern, was lange nur Männern vorbehalten war. In ihren Porträts zeigt sie, dass die Flâneuse mehr ist als nur ein weiblicher Flâneur, sie steht für sich allein, ist eine inspirierende Gestalt. Sie geht auf Reisen, sie geht an Orte, die nicht für sie gedacht sind; sie konfrontiert uns damit, wie die Wörter Zuhause und Zugehörigkeit gegen Frauen verwendet werden. Sie ist ein entschlossenes, kreatives Individuum mit einem tiefen Gespür für das schöpferische Potenzial einer Stadt und die befreiende Kraft eines Spaziergangs.
»Es ist an der Zeit, die aufsehenerregende und revolutionäre Bedeutung der Flâneuse zu entdecken!« The Guardian
»Elkin hat ein Auge für das unerwartete Detail wie es sich für eine Flâneuse gehört.« New York Times
LAUREN ELKIN
Frauen erobern die Stadt – in Paris, New York, Tokio, Venedig und London
Aus dem Englischen von Cornelia Röser
Für TriviaGöttin der Wegkreuzungen
»Sie ist eine Wanderin, Herumtreiberin, Emigrantin, Geflüchtete, Deportierte, Streunerin, ziehende Schauspielerin. Manchmal möchte sie sesshaft werden, aber Neugier, Trauer und Unzufriedenheit machen es ihr unmöglich.«
– Deborah Levy, Swallowing Geography
INHALT
FLÂNEUS-IEREN
LONG ISLAND · NEW YORK
PARIS · CAFÉS WO MAN
LONDON · BLOOMSBURY
PARIS · KINDER DER REVOLUTION
VENEDIG · GEHORSAM
TOKIO · VON INNEN
PARIS · PROTEST
PARIS · NACHBARSCHAFT
ÜBERALL · DER BLICK VON UNTEN
NEW YORK · RÜCKKEHR
EPILOG · FLÂNEUSERIE
Anmerkungen
Dank
Bildnachweise
Eine Straße in Paris. Eine Frau bleibt stehen und zündet sich eine Zigarette an. In einer Hand hält sie das Streichholz, in der anderen die Schachtel und einen Handschuh. Ihre hochgewachsene Gestalt korrespondiert mit dem Schatten eines Laternenpfahls, zwei parallele senkrechte Linien auf der Wand hinter ihr, als die Fotografin die Blende schließt. Innehaltend; festgehalten im Vorübergehen.
An der Wand steht eine klare Anweisung: Défense d’Afficher et de faire aucun Dépôt le long de ce … dann wird die Mahnung vom Bildrand abgeschnitten. Défense d’Afficher, das verkünden viele Wände in Paris. Plakatieren verboten, ein Verbot aus dem späten neunzehnten Jahrhundert, damit die Stadt nicht zu einer Wüste aus Reklametafeln verkommt. Über dem Schriftzug lassen schablonierte Buchstaben wissen – trotzig? Oder waren sie zuerst da? –, dass man hier oder in der Nähe früher charcuterie kaufen konnte. Darunter hat jemand die groben Umrisse eines Gesichts gemalt.
Es ist 1929. Frauen, die in der Öffentlichkeit rauchen, sind kein so ungewöhnlicher Anblick mehr. Dennoch enthält das Foto ein Moment der Grenzüberschreitung. Der Tag wird zu Ende gehen, die Frau wird weiterziehen, die Fotografin wird weiterziehen, selbst die Sonne wird weiterziehen und mit ihr der Schatten der Laterne. Doch alles, was wir von diesem Ort in der Vergangenheit sehen, ist eine Frau, die sich vor einer Wand voller Verbote und deren Missachtung eine Zigarette anzündet. Sie fällt auf, in ihrer anonymen, unsterblichen Einzigartigkeit.
Die urbane Schwarz-Weiß-Fotografie jener Zeit hat mich immer berührt, besonders die Bilder von Frauen – von Marianne Breslauer, die diese Aufnahme gemacht hat, von Laure Albin-Guillot, Ilse Bing oder Germaine Krull, einer Freundin Walter Benjamins, die gerne mit ihm – und ohne ihn – durch die Passagen von Paris streifte und dort fotografierte. Diese Frauen kamen in die Stadt (oder waren vielleicht dort geboren oder kamen aus anderen Städten), um unbeobachtet zu sein, aber auch um der Freiheit willen, tun zu können, was sie wollten und wie sie es wollten.
Vor meinem geistigen Auge sind ähnliche Bilder entstanden. Von Momenten, die in Tagebüchern oder Romanen festgehalten wurden, in denen aber kein Fotograf zugegen war. Eines zum Beispiel von George Sand, die in Männerkleidung durch die Straßen spaziert. Verloren in der Stadt, ein »Atom« in der Menge. Oder Jean Rhys, deren Frauenfiguren an Kaffeehausterrassen vorbeigehen und sich innerlich winden, weil die Kunden ihnen mit Blicken folgen und sie als Außenseiterin erkennen. Breslauers Fotografie und die anderen Bilder in meiner Vorstellung zeigen das Kernproblem der urbanen Erfahrung: Sind wir Individuen oder Teil der Masse? Wollen wir uns abheben oder in der Menge verschwinden? Ist das überhaupt möglich? Wie wollen wir – egal, welchen Geschlechts – in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden? Wollen wir die Blicke auf uns ziehen oder ihnen ausweichen? Wollen wir unabhängig und unsichtbar sein? Beachtenswert oder unbeachtet?
Défense d’Afficher. Keine Werbung. Und doch: Elle s’affiche. Sie zeigt sich. Sie hebt sich vor dem Hintergrund der Stadt ab.
FLÂNEUS-IEREN
Wann ist es mir zum ersten Mal begegnet, dieses elegante französische Wort flâneur mit seinem überdachten â und dem rollenden eur? Es muss in den 1990ern gewesen sein, als ich in Paris studierte, aber ich glaube nicht, dass ich in einem Buch darauf gestoßen bin. Viel Pflichtlektüre habe ich in jenem Semester nicht gelesen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, und das bedeutet wohl, dass ich bereits zum Flâneur wurde, bevor ich wusste, was das ist; ich durchstreifte die Straßen in der Nähe meiner Universität – links der Seine, wie es sich für eine amerikanische Uni gehört.
Das Wort Flâneur für jemanden, »der ziellos umherstreift«, abgeleitet vom französischen Verb flâner, entstand in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in den mit Glas und Stahl überdachten Pariser passages. Als Haussmann anfing, seine lichten Boulevards in die dunkle unebene Kruste aus Häusern zu schneiden wie mit einem Messer durch Chèvre im Aschemantel, spazierte auch der Flâneur hindurch, um das urbane Spektakel zu betrachten. Als männliche Figur mit Privilegien und Muße, mit Zeit und Geld und ohne unmittelbare Verpflichtungen, die seine Aufmerksamkeit erfordert hätten, versteht der Flâneur die Stadt wie nur wenige ihrer Bewohner, denn er hat sie sich mit den Füßen eingeprägt. Jede Ecke, jede Gasse, jeder Treppenaufgang hat das Potenzial, ihn in rêverie zu versetzen. Was ist hier geschehen? Wer ist hier vorbeigekommen? Welche Bedeutung hat dieser Ort? Der Flâneur, eingestimmt auf die Saitenschwingungen seiner Stadt, weiß es intuitiv.
In meiner Ignoranz muss ich geglaubt haben, ich hätte die flânerie erfunden. Für jemanden aus einem amerikanischen Vorort, wo die Menschen überall mit dem Auto hinfahren, war es ein wenig exzentrisch, ohne besonderen Grund zu Fuß zu gehen. In Paris konnte ich stundenlang laufen, ohne je irgendwo »anzukommen«. Ich beobachtete die Zusammensetzung der Stadt und erhaschte hier und da einen Blick auf ein inoffizielles Stück Geschichte: ein Einschussloch in der Fassade eines hôtel particulier, vergessene Schriftzüge hoch oben an der Seitenfassade eines Hauses, der Name einer Mehlfabrik oder einer Zeitung, die es nicht mehr gibt (was ein kreativer Graffiti-Künstler als Aufforderung nahm, etwas Eigenes daraus zu machen), oder ein paar Reihen bei Straßenarbeiten freigelegter Pflastersteine: verschiedene Schichten unter der Oberfläche der heutigen Stadt, die sich langsam immer weiter nach oben schiebt. Ich hielt Ausschau nach Rückständen, nach Strukturen, nach Zufällen, Begegnungen und unerwarteten Entdeckungen. Die wichtigste Erfahrung mit dieser Stadt machte ich nicht mittels Büchern, Restaurants oder Museen und auch nicht durch die seelischen Narben jener Affäre, die sich in einer Dachkammer nahe der Börse abspielte, sondern durch das viele Zufußgehen. Irgendwo im sechsten Arrondissement wurde mir klar, dass ich für den Rest meines Lebens in der Stadt wohnen wollte, und zwar genau hier, in Paris. Es hatte etwas mit der absoluten, vollkommenen Freiheit zu tun, die sich entfaltet, wenn man einen Fuß vor den anderen setzt.
Zwischen meiner Wohnung in der Avenue de Saxe und der Uni in der Rue de Chevreuse lief ich eine Furche in den Boulevard Montparnasse. Von den Namen der Restaurants, an denen ich vorbeikam, lernte ich ein Französisch, das nicht in den Schulbüchern steht: Les Zazous (benannt nach einem Jazzer-Typ aus den 1940er-Jahren mit kariertem Blazer und Stirnlocke), das Restaurant Sud-Ouest & Cie, von dem ich die französische Entsprechung zu »& Co« erfuhr, und von einer Bäckerei namens Pomme de pain lernte ich das Wort für Kiefernzapfen, pomme de pin, wobei ich nie recht verstanden habe, warum dieses Wortspiel der Mühe wert sein sollte. In einem Brezel-Shop namens Duchesse Anne kaufte ich mir jeden Tag auf dem Weg zu meinen Veranstaltungen einen Orangensaft und dachte darüber nach, wer diese Anne sein mochte und in welcher Beziehung sie zu Brezeln stehen könnte. Ich sinnierte über das verzerrte Bild, das die Franzosen von der amerikanischen Geografie haben mussten, was sich in einem TexMex-Restaurant namens Indiana Café äußerte. Auf meiner Strecke lagen all die berühmten Cafés des Boulevards: La Rotonde, Le Sélect, Le Dôme und La Coupole, Wasserstellen für Generationen von amerikanischen Schriftstellern in Paris, deren Geister unter den Markisen der Cafés hockten, ohne sich von den Entwicklungen des zwanzigsten Jahrhunderts beeindruckt zu zeigen. Ich überquerte die Straße zur Rue Vavin mit dem gleichnamigen Café, in das die coolen lycéens nach Schulschluss gingen, lässig Zigaretten rauchend, die Ärmel länger als die Arme, Converse-Sneakers an den Füßen. Jungen mit dunklen Locken, die Mädchen ungeschminkt.
Mutiger geworden, wagte ich mich bald in die Straßen, die vom Jardin du Luxembourg abgingen, einige Gehminuten von meiner Uni entfernt. Ich gelangte zur Kirche Saint-Sulpice, die damals renoviert wurde – und das schon seit Jahrzehnten, ebenso wie der Turm Saint-Jacques. Niemand konnte sagen, ob die Baugerüste an den Türmen je wieder abgebaut werden würden. An der Place Saint-Sulpice saß ich im Café de Mairie und beobachtete, wie die Welt an mir vorüberzog: die magersten Frauen, die ich je gesehen hatte, in Leinenkleidung, die in New York spießig ausgesehen hätte, in Paris aber unvergleichlich chic wirkte, Nonnen in Zweier- oder Dreiergrüppchen, Yuppie-Mütter, die ihre kleinen Söhne an Bäume pinkeln ließen. Ich schrieb alles auf, was ich sah, ohne zu wissen, dass Georges Perec 1974 eine Woche lang an genau diesem Platz, in genau diesem Café gesessen und dasselbe Kommen und Gehen notiert hatte: Taxis, Busse, Gebäck essende Menschen, die Richtung und Stärke des Windes – alles in dem Versuch, seinen Lesern die Schönheit des Alltäglichen nahezubringen, dessen, was er als das Infraordinäre bezeichnete: was geschah, wenn nichts geschah. Was ich ebenfalls nicht wusste, war, dass Nachtgewächse, das eines meiner Lieblingsbücher werden sollte, in genau diesem Café und dem darüberliegenden Hotel spielte. Paris fing gerade erst an, der Ort meiner wichtigsten persönlichen und intellektuellen Bezugspunkte zu werden – und sie hervorzubringen. Wir lernten uns gerade erst kennen.
Mit Englisch als Hauptfach hatte ich eigentlich nach London gehen wollen, doch aufgrund einer Formalie verschlug es mich stattdessen nach Paris. Innerhalb eines Monats hatte mich die Stadt verzaubert. Da war etwas in den Straßen von Paris, das mich innehalten und mir das Herz stocken ließ. Sie schienen von einer Gegenwart durchdrungen, selbst wenn außer mir niemand dort war. Es waren Orte, an denen etwas geschehen könnte oder geschehen war oder beides. In New York, der Stadt, in der sich alles der Zukunft beugt, hätte ich ein solches Gefühl nicht haben können. In Paris hielt ich mich viel im Freien auf und dachte mir Geschichten zu den Straßen aus, durch die ich ging. Nach diesen sechs Monaten waren die Straßen nicht mehr nur die Strecke zwischen meiner Wohnung und meinem jeweiligen Zielort, sondern meine große Leidenschaft. Ich ließ mich überallhin treiben, wo es interessant aussah, ließ mich vom Anblick einer verfallenden Wand anlocken, von bunten Blumenkästen oder von irgendetwas Faszinierendem am Ende einer Straße, auch wenn es etwas so Alltägliches war wie eine Querstraße. Alles, jedes Detail, das plötzlich hervortrat, zog mich an. Jedes Mal, wenn ich um eine Ecke bog, wurde mir bewusst, dass der Tag ganz mir gehörte und ich nirgendwo sein musste, wo ich nicht sein wollte. Ich war erstaunlich immun gegen Verantwortung, denn ich hatte keinerlei Ambitionen, außer das zu tun, was mich interessierte.
Ich erinnere mich, dass ich einmal für zwei Stationen die Metro nahm, weil mir nicht bewusst war, wie nah alles beieinanderlag, wie gut man in Paris zu Fuß gehen konnte. Ich musste gehen, um zu begreifen, wo ich mich im Raum befand und wie die Orte miteinander zusammenhingen. An manchen Tagen lief ich bis zu zehn Kilometer und kehrte mit wunden Füßen und der einen oder anderen Geschichte für meine Mitbewohner nach Hause zurück. Ich sah Dinge, die ich in New York noch nie gesehen hatte. Bettler (Roma, wie mir erklärt wurde), die regungslos mit gesenktem Kopf in den Straßen knieten und Schilder hielten, auf denen sie um Geld baten. Manche hatten Kinder dabei, andere Hunde. Obdachlose, die in Zelten, unter Treppen oder Brücken hausten. Für jede malerische Ecke in Paris gab es das entsprechende Elend. Ich legte meine New Yorker Apathie ab und gab, so viel ich entbehren konnte. Wenn man sehen lernt, bedeutet das auch, dass man nicht mehr wegsehen kann. In den Straßen von Paris war mir immer bewusst, dass uns nur der schmale Grat des Schicksals voneinander trennte. Und dann erfuhr ich irgendwie durch Zufall, dass dieses ganze Herumlaufen und der unablässige Drang, alles, was ich sah und empfand, in die biegsamen Notizbücher zu kritzeln, die ich in der Buchhandlung Gibert Jeune am Boulevard Saint-Michel kaufte – dass also alles, was ich intuitiv tat, schon andere vor mir getan hatten, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass es dafür ein eigenes Wort gab. Ich war ein Flâneur.
Oder eher – als gute Französisch-Schülerin machte ich aus dem maskulinen Substantiv ein feminines – eine Flâneuse.
+
Flâneuse [flah-nöhse], Subst.: aus dem Französischen. Weibliche Form von Flâneur [flah-nöhr], Müßiggänger, gemächlich umherstreifender Beobachter, normalerweise in Städten anzutreffen.
Diese Definition ist eine Erfindung von mir. In den meisten französischen Wörterbüchern ist das Wort nicht einmal aufgeführt. Das Littré von 1905 macht mit ›flâneur, -euse‹: Qui flâne ein Zugeständnis,doch im Dictionnaire Vivant de la Langue Française wird es, man mag es nicht glauben, als eine Art Liegestuhl definiert.
Soll das ein Witz sein? Die einzige Art neugierigen Müßiggangs, der eine Frau nachgeht, ist es, sich hinzulegen?
Diese (natürlich umgangssprachliche) Verwendung kam um etwa 1840 auf und erreichte ihren Höhepunkt in den 1920er-Jahren, sie hält sich jedoch bis heute: die Google-Bildersuche nach »flâneuse« liefert eine Zeichnung von George Sand, eine Frau auf einer Bank in Paris und einige Bilder von Gartenmöbeln.
+
Während meines letzten Studienjahres, das ich wieder in New York verbrachte, schrieb ich mich für ein Seminar mit dem Titel »Der Mann in der Menge, die Frau auf der Straße« ein. Vor allem der zweite Teil interessierte mich: Ich hoffte, einen Stammbaum oder eine Schwesternschaft für mein exzentrisches neues Hobby erstellen zu können. Mich reizte zwar der Begriff des Flâneurs als jemand, der die Fesseln der Verantwortung abgestreift hat. Aber ich wollte vor allem herausfinden, wie sich eine Frau ins Stadtbild einfügen könnte.
Bei den Recherchen für meine Bachelorarbeit über Zolas Nana und Dreisers Schwester Carrie stellte ich verblüfft fest, dass Wissenschaftler die Idee einer weiblichen Flâneuse weitgehend verworfen hatten. »Die Erfindung einer Flâneuse steht nicht zur Debatte«, schreibt Janet Wolff in einem vielzitierten Essay zu dem Thema; »eine solche Figur wurde durch die Geschlechtertrennung des neunzehnten Jahrhunderts verunmöglicht.«1 Die große feministische Kunsthistorikerin Griselda Pollock vertrat die gleiche Ansicht: »Es gibt keine weibliche Entsprechung zu dieser, ihrem Wesen nach männlichen Figur, dem Flâneur: Eine weibliche Flâneuse gibt es nicht und kann es nicht geben.«2 »Der urbane Beobachter […] wurde als ausschließlich männliche Figur gesehen«, notiert Deborah Parsons. »Die Möglichkeiten und Aktivitäten der Flânerie waren vorwiegend das Privileg begüterter Männer, und somit verstand es sich von selbst, dass der ›moderne Lebenskünstler‹ notwendigerweise ein Mann aus der bürgerlichen Schicht war.«3 In ihrem Buch Wanderlust: Eine Geschichte des Gehens wendet sich Rebecca Solnit von ihren »ausschweifenden Philosophen, Flâneuren und Bergsteigern« ab, um die Frage zu stellen, »warum Frauen nicht auch draußen herumlaufen.«4
Den meisten Kritikern zufolge war diese Frau auf der Straße höchstwahrscheinlich eine Prostituierte. Also las ich weiter und stieß auf zwei Probleme mit dem Konzept der Flâneuse als Hure: Erstens gab es Frauen auf der Straße, die nicht ihren Körper verkauften, und zweitens haftete dem Auf- und Abgehen dieser Frauen nichts von der Freiheit eines Flâneurs an; Prostituierte konnten sich nicht frei in der Stadt bewegen. Ihre Bewegungen waren streng reguliert: Mitte des neunzehnten Jahrhunderts schrieben alle möglichen Gesetze vor, wann und zu welchen Uhrzeiten sie Männer ansprechen durften. Für ihre Kleidung galten strenge Reglementierungen, sie mussten sich bei der Stadt registrieren lassen und regelmäßig bei der Gesundheitspolizei vorstellig werden. Mit Freiheit hatte das nichts zu tun.
Die meisten leicht zugänglichen Quellen, aus denen man erfährt, wie das Straßenbild im neunzehnten Jahrhundert ausgesehen hat, sind männlich und sehen die Stadt auf ihre eigene Weise. Wir dürfen ihre Zeugnisse nicht als objektive Wahrheit ansehen; ihnen fielen bestimmte Dinge auf, über die sie dann Vermutungen anstellten. Baudelaires geheimnisvolle und verführerische passante, die er in seinem Gedicht »Einer Vorübergehenden« verewigt, wurde oft als Prostituierte interpretiert, doch für ihn war sie nicht einmal eine echte Person, sondern nur seine lebendig gewordene Fantasie:
Es tost betäubend in der strassen raum.
Gross schmal in tiefer trauer majestätisch
Erschien ein weib ihr finger gravitätisch
Erhob und wiegte kleidbesatz und saum
Beschwingt und hehr mit einer statue knie.
Ich las · die hände ballend wie im wahne
Aus ihrem auge (heimat der orkane):
Mit anmut bannt mit liebe tötet sie.5
Baudelaire hat kaum Zeit, sich ein Urteil über sie zu bilden: Sie ist zu schnell (und gleichzeitig statuenhaft). Er will nicht darüber nachdenken, wer sie in Wirklichkeit sein könnte, woher sie kommt, wohin sie geht. Für ihn ist sie die Hüterin eines Geheimnisses und verfügt über die Macht, zu verzaubern oder zu vergiften.
Natürlich hängt der Grund dafür, dass die Flâneuse in der Geschichte des Durch-die-Stadt-Streifens keine Berücksichtigung findet, mit den gesellschaftlichen Bedingungen zusammen, unter denen Frauen im neunzehnten Jahrhundert lebten – der Zeit, in der unser Begriff vom Flâneur entstand. Die früheste Erwähnung eines Flâneurs stammt aus dem Jahr 1585, möglicherweise entlehnt vom skandinavischen Wort flana, »eine Person, die umherstreift«. Eine Person – nicht notwendigerweise ein Mann. Durchgesetzt hat sich das Wort allerdings erst im neunzehnten Jahrhundert, und diesmal hat es ein Genus: 1806 nahm der Flâneur die Form des »M. Bonhomme« an, eines Lebemanns aus vermögenden Verhältnissen, der über genug Zeit verfügt, um nach Belieben durch die Stadt zu streifen, in Cafés zu sitzen und die verschiedentlichen Bewohner der Stadt bei Arbeit und Spiel zu beobachten. Er interessiert sich für Klatsch und für Mode, aber nicht besonders für Frauen. In einem Wörterbuch von 1829 ist ein Flâneur ein Mann, der gern untätig ist, der den Müßiggang mag. Balzacs Flâneur gestaltete sich in zwei Grundformen aus: im gewöhnlichen Flâneur, der gern ziellos durch die Straßen streift, und im künstlerischen Flâneur, der die Wahrnehmung der Stadt in seine Arbeit einfließen lässt. Dies sei die unglücklichere Form, wie Balzac 1837 in seinem Roman Cäsar Birotteaus Größe und Niedergang schrieb, genauso oft ein verzweifelter Mann wie ein Müßiggänger.
Baudelaires Flâneur ist ein Künstler, der »Zuflucht in der Menge« sucht; Vorbild dafür war sein Lieblingsmaler Constantin Guys, der selbst durch die Stadt flanierte und vielleicht in Vergessenheit geraten wäre, hätte Baudelaire ihn nicht berühmt gemacht. Edgar Allen Poes Kurzgeschichte »Der Mann in der Menge« wirft weitere Fragen auf: Ist der Flâneur derjenige, der folgt, oder dem gefolgt wird? Mischt er sich in die Menge und entschwindet, oder tritt er zurück und schreibt auf, was er sieht? Auf Französisch sind die Wörter für »ich bin« und »ich folge« identisch: je suis. »Sag mir, wem du folgst, und ich sage dir, wer du bist«, schrieb André Breton in Nadja. Selbst für den männlichen Flâneur steht die flânerie nicht notwendigerweise für Freiheit und Muße; in Flauberts Version der flânerie spiegelt sich seine eigene soziale Unsicherheit wieder.6 Im frühen neunzehnten Jahrhundert wird der Flâneur mit einem Polizisten gleichgesetzt. In Québec, erzählt mir ein Freund, der dort einige Zeit lebte, sei ein Flâneur eine Art Trickbetrüger.
Als Beobachter und gleichzeitig Beobachteter ist der Flâneur ein verführerisches, aber leeres Gefäß, eine nackte Leinwand, auf die verschiedene Epochen ihre jeweiligen Sehnsüchte und Ängste projizierten. Er erscheint, wenn man ihn braucht, und zwar in der Form, in der man ihn braucht.7 Unsere Vorstellung vom Flâneur enthält viele Widersprüche, was uns womöglich gar nicht bewusst ist, wenn wir von ihm sprechen. Wir glauben zu wissen, was wir meinen, aber dem ist nicht so.
Das Gleiche könnte man über die Flâneuse sagen. Natürlich ist es eine relevante Frage, zu welchen Räumen Frauen Zugang hatten, und von welchen sie ausgeschlossen waren. 1888 schrieb Amy Levy: »Die weibliche Clubgängerin, die Flâneuse in der St James Street mit dem Schlüssel in der Tasche und der Brille auf der Nase, bleibt ein Geschöpf der Fantasie.«8 Schön und gut. Aber es gab zu allen Zeiten viele Frauen in der Stadt, und eine Menge Frauen, die über Städte schrieben, Aufzeichnungen über ihr Leben festhielten, Geschichten erzählten, fotografierten, Filme drehten und sich auf alle möglichen Arten mit der Stadt auseinandersetzten – einschließlich Levy selbst. Die Freude daran, durch die Stadt zu streifen, ist Männern und Frauen gleichermaßen zu eigen. Zu behaupten, es könne keine weibliche Version des Flâneurs geben, bedeutet, die Möglichkeiten, wie Frauen mit der Stadt in Kontakt stehen, auf die zu beschränken, wie Männer mit der Stadt interagiert haben. Wir können über gesellschaftliche Gepflogenheiten und Einschränkungen diskutieren, aber wir können nicht negieren, dass Frauen da waren; wir müssen versuchen zu begreifen, was es für sie bedeutet hat, sich in der Stadt zu bewegen. Vielleicht liegt die Antwort darin, Frauen nicht in einen männlichen Begriff einpassen zu wollen, sondern den Begriff selbst neu zu definieren.
Wenn wir in der Zeit zurückreisen, war da schon immer eine Flâneuse, die auf der Straße an Baudelaire vorüberging.
+
Liest man nach, wie Frauen im neunzehnten Jahrhundert über sich selbst sprachen, stellt sich tatsächlich heraus, dass bürgerliche Frauen in der Öffentlichkeit unentwegt Gefahr liefen, der eigenen Tugend und dem eigenen Ruf zu schaden; sich allein in die Öffentlichkeit zu wagen, bedeutete, Schimpf und Schande zu riskieren.9 Frauen der Oberschicht zeigten sich in offenen Kutschen im Bois de Boulogne oder unternahmen, in Begleitung, Gesundheitsspaziergänge im Park. (Eine Frau im geschlossenen Wagen erregte ein gewisses Misstrauen, wie die berühmte Kutschenszene in Madame Bovary belegt.) Die großen gesellschaftlichen Risiken für eine alleinstehende junge Frau im späten neunzehnten Jahrhundert kommen deutlich in den achtbändigen Tagebüchern von Marie Bashkirtseff zum Ausdruck (auf Englisch und gekürzt erschienen unter dem unglaublichen Titel I Am the Most Interesting Book of All (Ich bin das interessanteste Buch der Welt)). Die Tagebücher berichten über ihre Entwicklung von der verwöhnten jungen russischen Aristokratin zur erfolgreichen Künstlerin, deren Arbeiten im Pariser Salon ausgestellt werden – nur zweieinhalb Jahre, nachdem sie ernsthaft anfängt, Malerei zu studieren –, und die mit fünfundzwanzig an Tuberkulose stirbt. Im Januar 1879 schrieb sie in ihr Tagebuch:
Ich sehne mich nach der Freiheit, alleine auszugehen: zu kommen und zu gehen, im Jardin des Tuileries auf einer Bank zu sitzen und ganz besonders, in den Jardin du Luxembourg zu gehen, mir Schaufensterdekorationen anzusehen, in Kirchen und Museen zu gehen und am Abend durch die alten Straßen zu schlendern. Das wünsche ich mir. Ohne diese Freiheit kann man kein großer Künstler werden.10
Marie hatte vergleichsweise wenig zu verlieren. Sie wusste, dass ihr ein früher Tod bevorstand – warum hätte sie nicht allein herumlaufen sollen? Doch sie hegte noch bis einen Monat vor ihrem Tod die Hoffnung, wieder gesund zu werden, und während sie mit Freuden Schande über ihre Familie gebracht hätte, hatte sie gleichzeitig die kulturelle Abneigung gegen junge Frauen, die sich allein auf der Straße zeigten, so tief verinnerlicht, dass sie sich schon für den bloßen Wunsch danach schämte. In ihr Tagebuch schrieb sie, selbst wenn sie sich den gesellschaftlichen Strukturen widersetzen würde, wäre sie nur »halb frei, denn eine Frau, die sich herumtreibt, ist töricht.«
Mit ihrer Entourage im Schlepptau lief sie dennoch ganze Tage mit ihrem Notizbuch in der Hand durch die Armenviertel von Paris und skizzierte alles, was sie sah. Aus dieser Recherche sollten zahlreiche Gemälde hervorgehen, darunter Das Treffen von 1884, das jetzt im Musée d’Orsay in Paris hängt und eine Gruppe Gassenjungen an einer Straßenecke abbildet. Einer von ihnen hält ein Vogelnest in den Händen, die anderen beugen sich mit jenem jungenhaften Interesse darüber, das sich als völlige Gleichgültigkeit tarnt.
Und Marie hat einen Weg gefunden, sich selbst in das Bild einzubringen. Im Hintergrund, rechts von den Jungen, in einer anderen Straße, sehen wir ein Mädchen von hinten; ein geflochtener Zopf fällt ihr auf den Rücken, sie entfernt sich von der Gruppe, womöglich allein, obwohl sich das nicht mit Gewissheit sagen lässt, weil das Bild hier abgeschnitten ist. Wir sehen nicht einmal ihren rechten Arm. Für mich ist das der schönste Teil an diesem Gemälde: Maries Signatur befindet sich am unteren rechten Bildrand, unter dem Mädchen. Wir dürfen wohl vermuten, dass sich Marie hier selbst auf die Leinwand gebracht hat: in Gestalt eines Mädchens, das vielleicht allein davongeht und die Jungen sich selbst überlässt.
+
Das Argument gegen die Existenz der Flâneuse ist manchmal mit der Frage der Sichtbarkeit verknüpft. »Für den Flâneur ist es entscheidend, praktisch unsichtbar zu sein«, schreibt Luc Sante, um sein Verständnis des Flâneurs als ein männliches, und nicht weibliches zu verteidigen.11 Diese Anmerkung ist zugleich unfair und schmerzlich zutreffend. Wie gern wären wir so unsichtbar wie es Männer sind. Nicht wir selbst machen uns im Sinne Santes sichtbar, im Sinne der Aufregung also, die eine Frau auslösen kann, wenn sie sich allein in der Öffentlichkeit bewegt; es ist der Blick des Flâneurs, durch den eine Frau, die sich in seine Reihen begeben wollte, zu sichtbar wird, um unbemerkt vorbeizugehen. Wenn wir aber so sehr ins Auge fallen, warum wurden wir dann aus der Geschichte der Stadt herausgeschrieben? Es ist an uns, uns wieder in dieses Bild hineinzumalen, und zwar auf eine Art, die uns gerecht wird.
Wenngleich Frauen aus Marie Bashkirtseffs Schicht bis ins späte neunzehnte Jahrhundert weitgehend mit dem eigenen Zuhause assoziiert wurden, hatten Frauen der Mittel- und Unterschicht reichlich Gründe, sich auf der Straße aufzuhalten, sei es zum Spielen oder um einer Arbeit nachzugehen, als Ladenmädchen, in einer Wohltätigkeitsorganisation, als Dienstmädchen, Näherin, Wäscherin oder eine von vielen anderen Beschäftigungen auszuüben. Und wenn sie das Haus verließen, war das nicht nur zweckdienlicher oder beruflicher Art; in seinen farbenfrohen Gemälden, die das Leben von Frauen der Arbeiterschicht darstellten, zeigt David Garrioch, dass die Straße in gewisser Hinsicht ihnen gehörte. Sie betrieben die meisten Stände auf den Pariser Märkten, und auch zu Hause saßen sie gemeinsam draußen vor den Türen ihrer Wohnungen und Häuser und taten das, was Jane Jacobs zweihundert Jahre später »ein Auge auf die Straße haben« nennen würde: Sie »hatten ein Auge darauf, was vor sich ging, und waren oftmals die Ersten, die bei Streitigkeiten eingriffen und dazwischengingen, um sich prügelnde Männer zu trennen. Ihre Bemerkungen über die Kleidung und das Verhalten der Passanten stellte eine Form sozialer Kontrolle dar.«12 Sie wussten besser als jeder andere, was in ihrem Viertel geschah.
Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts konnten in Städten wie London, Paris und New York Frauen aller Schichten den öffentlichen Raum nutzen. Die wachsende Verbreitung der Kaufhäuser in den 1850er und 1860er-Jahren trug viel dazu bei, dass sich das Bild von Frauen in der Öffentlichkeit normalisierte; in den 1870er-Jahren führten bereits einige Reiseführer »Orte in London« auf, »an denen Damen in Ruhe zu Mittag essen konnten, wenn sie einen Tag lang ohne Begleitung eines Gentleman zum Einkaufen in der Stadt waren.«13 James Tissots Reihe Fünfzehn Porträts der Pariserin aus den 1880er-Jahren zeigt Frauen bei allen möglichen Betätigungen in der Stadt: in einem Park sitzend (in Begleitung von Maman), bei einem Künstler-Dinner mit ihren Ehemännern (in ihren Korsetts, so steif wie die Karyatiden im Hintergrund) oder auf einem Streitwagen, verkleidet als römische Krieger im Circus, mit einem Strahlenkranz auf dem Kopf wie die Freiheitsstatue. Sein Gemälde The Shop Girl von 1885 zieht den Betrachter direkt in das Bild hinein: Das namensgebende Ladenmädchen, groß und schlank, in nüchternes Schwarz gekleidet, hält uns zur Begrüßung oder zum respektvollen Abschied die Tür auf. Auf dem Tisch liegt ein Durcheinander von Seidenstoffen, ein Band ist zu Boden geglitten. Das Gemälde bringt die Frau in der Öffentlichkeit in Verbindung mit dem harten Kommerzialismus des Marktes, doch es suggeriert auch lockere Sitten, ein ungeordnetes Privatleben und intimere Orte, an denen Bänder zu Boden gleiten.
In den 1890er-Jahren gab es auf einmal die neue Frau, die mit ihrem Fahrrad überallhin fuhr, wo es ihr gefiel, und junge Mädchen ermöglichten sich durch Arbeit in Geschäften und Büros ihre Unabhängigkeit. Seit sich Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts das Kino und andere Freizeitaktivitäten durchsetzten und seit dem massenhaften Eintritt von Frauen in die Arbeitswelt während des Ersten Weltkriegs, ist die Anwesenheit von Frauen auf den Straßen sichtbar. Möglich war dies jedoch nur durch das Aufkommen semi-öffentlicher Orte wie Cafés und Teestuben, an denen Frauen allein Zeit verbringen konnten, ohne belästigt zu werden. Und natürlich durch den intimsten aller öffentlichen Orte: die Damentoilette.14 Ein weiterer Schlüsselfaktor für die urbane Unabhängigkeit der Frau waren respektable, bezahlbare Pensionen für Unverheiratete; oft genug war es schwierig, beide Eigenschaften in ein und derselben Einrichtung vereint zu finden. Wie Jean Rhys’ Romane belegen, bewegten sich viele Frauen am Rande der Ehrbarkeit in heruntergekommenen Häusern, deren Moralvorstellungen direkt proportional zum Grad ihrer Schäbigkeit anstiegen. Je zwielichtiger ein Etablissement war, umso strenger die patronne. Rhys’ alleinstehende Frauen in der Stadt liegen im ewigen Zwist mit den Vermieterinnen ihrer Absteigen.
+
Die Namen, die eine Stadt ihren Sehenswürdigkeiten – und insbesondere ihren Straßen – gibt, spiegeln die Werte dieser Stadt wider und zeigen, wie sich diese im Laufe der Zeit verändern. In dem Bemühen, den öffentlichen Raum zu säkularisieren (und angeblich zu demokratisieren), wurden Straßennamen, die einst weibliche Heilige, Herrscherinnen und Frauenfiguren der Mythologie geehrt hatten, in der Moderne durch säkulare, demokratische Helden ersetzt – allesamt Männer. Intellektuelle, Wissenschaftler, Revolutionäre.15 Doch in solcher Unvoreingenommenheit können jene übersehen werden, denen das kulturelle oder geschlechtsspezifische Kapital fehlt, sich in einer Kultur durchzusetzen, was dazu führt, dass Frauen mit dem überholten Regime identifiziert und mit »dem Privaten, dem Traditionellen und Anti-Modernen« assoziiert wurden.16
Wenn sie doch vorkommen (und das ist nicht oft der Fall, in Edinburgh gibt es doppelt so viele Statuen von Hunden wie von Frauen), werden Frauen dekorativ oder idealisiert dargestellt, in Stein gehauen als Allegorien oder Sklavinnen. Der Obelisk an der Pariser Place de la Concorde, wo der König guillotiniert wurde (und die Königin, und Charlotte Corday, Danton, Olympe de Gouges, Robespierre und Desmoulins und Tausende andere, deren Namen die Geschichte vergessen hat), ist von Frauenstatuen umringt, die verschiedene französische Städte repräsentieren. Das Vorbild für James Pradiers Skulptur von Straßburg soll entweder Victor Hugos Geliebte Juliette Drouet oder Flauberts Geliebte Louise Colet gewesen sein.17 Deshalb ist diese Statue für mich nicht nur eine Allegorie auf Straßburg, sondern steht für alle Geliebten von großen Schriftstellern und Künstlern, die selbst zeichneten und malten und vielleicht nie aus dem Schatten ihrer Liebhaber heraustreten konnten, obwohl sie, abstrahiert als eine von zwei Staaten umkämpfte Stadt, am helllichten Tag mitten in Paris sitzen.18
1916 besprach Virginia Woolf London Revisited von E. V. Lucas für die Literaturbeilage der Times. Seine Darstellung von Londons Vergangenheit und Gegenwart umfasst eine Auflistung der Denkmäler der Stadt. Doch ein bestimmtes verschweigt er, und Woolf fragt: »Warum wird die Frau mit der Amphore vor den Toren des Foundling Hospitals nicht erwähnt?«19 Noch heute kniet sie dort mit ihrem Krug, an einem modern aussehenden Trinkbrunnen auf einer Verkehrsinsel gegenüber von Coram’s Fields.20 Der Bildhauer ist unbekannt. Die Statue, eine Frau, bekleidet mit einer Toga oder Tunika, die Haare in offenen Locken herabfallend, wird manchmal »Die Wasserträgerin« oder »Die Frau aus Samaria« genannt, nach jener Frau, die an einem Brunnen mit Jesus sprach und ihn als Propheten erkannte.
In den Straßen einer jeden großen Stadt wird einem, wenn man darauf achtet, eine weitere Art Frau auffallen, die unbewegt dasteht. Die französische Regisseurin Agnès Varda produzierte in den 1980er-Jahren einen Kurzfilm mit dem Titel Les dites-cariatides (Die sogenannten Karyatiden), in dem sie mit ihrer Kamera durch Paris streift, um nach Beispielen für eine architektonische Kuriosität zu suchen: die Karyatiden, jene steinernen Frauen, die als lastentragende Säulen die großen Gebäude der Stadt stützen. Man findet sie überall in Paris. Sie treten jeweils zu zweit oder zu viert auf, manchmal auch in deutlich größeren Gruppen, je nach Prunkfaktor des Gebäudes. Manchmal sind es auch Männer. Dann nennt man sie Atlanten, nach Atlas, der die Welt auf seinen Schultern trägt. Die männlichen Karyatiden, die Varda beobachtet, werden mit schwellenden Muskeln dargestellt, während die Frauen alle rank und schlank sind und mit müheloser Eleganz posieren: Falls ihnen das Bauwerk, das sie tragen müssen, zu schwer ist, würden wir es ihnen nie ansehen.
Andererseits sehen wir sie eigentlich nie richtig an. Vardas Film endet mit einer enorm großen Karyatide im dritten Arrondissement. Sie ist so groß, dass sie an einem Gebäude in der belebten Rue Turbigo über drei Stockwerke reicht. Varda fragt Anwohner nach deren Meinung zu dieser Frau, doch die hatten die Figur noch nicht einmal bemerkt. Wie der Schriftsteller Robert Musil feststellte, ist es das Wesen eines Denkmals, unbemerkt zu bleiben. »Sie werden doch zweifellos aufgestellt, um gesehen zu werden, ja geradezu, um die Aufmerksamkeit zu erregen; aber gleichzeitig sind sie durch irgendetwas gegen Aufmerksamkeit imprägniert.« Und dennoch nehmen wir sie auf einer unterschwelligen Ebene wahr. In ihrem Buch Monuments & Maidens mutmaßt Marina Warner, würde jemand die Statue des Gesetzes (allegorisch als Frau dargestellt) von der Place du Palais-Bourbon entfernen, würden wir alle irgendwie spüren, dass etwas fehlt, selbst wenn wir nicht wüssten, was. Wir sind stärker auf unsere Umgebung eingestimmt als uns bewusst ist.
+
Auch heute noch hat die Flâneuse mit ihrer Sichtbarkeit zu kämpfen, obwohl sie sich in der Stadt inzwischen mehr oder weniger frei bewegen kann.
Heutzutage findet man eher einen politisch motivierten Nachfahren der baudelaireschen flânerie in den Städten, einen, der sich eher der Methode des dérive oder »Treibenlassens« bedient. Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts erfand eine Gruppe radikaler Dichter und Künstler, die sich Situationisten nannten, die »Psychogeografie«, bei der aus ziellosem Umherstreifen ein Treibenlassen wurde und aus losgelöster Beobachtung eine Kritik des Nachkriegsurbanismus. Urbane Entdecker nutzten das dérive, um das emotionale Kraftfeld der Stadt zu kartografieren und zu erkunden, wie sich Architektur und Topografie zu »psychogeografischen Konturen« verbinden.21 Robert Macfarlane, ein Schriftsteller und Fußgänger, der weniger in der Stadt als auf dem Land unterwegs ist, fasst die Methode zusammen: »Man klappt einen Stadtplan von London auf, stellt ein Glas mit der Öffnung nach unten darauf und umfährt den Rand mit einem Stift. Dann nimmt man die Karte, geht raus in die Stadt und folgt diesem Kreis, wobei man sich so nah wie möglich an die gezeichnete Linie hält. Unterwegs hält man das Erlebnis mit einem Medium seiner Wahl fest: Film, Foto, Handschrift, Tonband. Man fängt die textlichen Abschwemmungen der Straße auf, die Graffitis, die Markennamen auf Verpackungsmüll, Gesprächsfetzen. Man liest Spuren, protokolliert den Datenstrom, achtet auf zufällige Metaphern, hält Ausschau nach visuellen Reimen, Zufällen, Analogien, Familienähnlichkeiten, den wechselnden Launen der Straße.«22 Der Ausdruck »Psychogeografie« wird von vielen von Macfarlanes Zeitgenossen (manchmal ironisch) übernommen oder aber abgelehnt: Will Self verwendete den Terminus als Überschrift für einen Essay. Ian Sinclair sah das Wort skeptisch, da es vereinnahmt worden und zu einem »sehr hässlichen Markenzeichen« geworden sei. Er bevorzuge den Ausdruck »tiefe Topografie«, den er von Selfs gutem Freund Nick Papadimitriou hat (dieser spricht davon, auf bestimmten Spaziergängen eine festgelegte Umgebung »eingehend zu studieren«).
Wie man sie auch nennen will, diese Erben der Situationisten im ausgehenden letzten Jahrhundert haben jedenfalls Baudelaires beschränkte Vorstellung von der Frau auf der Straße geerbt. Self erklärte die Psychogeografie – nicht ohne eine gewisse persönliche Enttäuschung – zur Männerarbeit und verfestigte damit das Bild des Fußgängers in der Stadt als das einer Figur mit männlichen Privilegien.23 Self ging so weit, die Psychogeografen als eine »Burschenschaft« zu beschreiben: »mittelalte Männer in Gore-Tex, bewaffnet mit Kamera und Notizbüchern, die sich auf Vorortbahnsteigen die Stiefel platttreten, die Betreiber von Teeständen in moosigen Parks höflich bitten, unsere Thermoskannen aufzufüllen, und nach den Zielorten von Überlandbussen fragen […] und sich mit schwellender Prostata über die Glasscherben hinter einer stillgelegten Brauerei am Stadtrand bücken.«
Er klingt tatsächlich gar nicht so viel anders als Louis Huart, der 1841 den Flâneur definiert: »Gute Beine, gute Ohren, gute Augen, […] das sind die grundlegenden physischen Eigenschaften, die ein Franzose mitbringen muss, um in den Club der Flâneure aufgenommen zu werden, sobald wir ihn gegründet haben werden.«24 Die großen urbanen Schriftsteller, die großen Psychogeografen, von denen man am Wochenende im Observer liest: Sie alle sind Männer, und sie schreiben stets über die Arbeiten anderer Männer und schaffen so einen reifizierten Kanon schreibender, spazierengehender Männer.25 Als wäre ein Penis eine Art Wanderstab, ein notwendiges Anhängsel, das man zum Gehen braucht.
Ein Blick in das psychogeografische Fanzine Savage Messiah, entworfen von der Grafikerin Laura Oldfield Ford, zeigt, dass dem eigentlich nicht so ist; Ford geht zu Fuß durch ganz London, sie zieht es von der Innenstadt hinaus in die Vororte, und überall skizziert sie, was sie sieht. Ihre Skizzen enthüllen eine Hauptstadt inmitten von Ballard’schen Vororten: Wohnblöcke, verlassene Behelfsbauten, Anker in einem Meer aus Unrat, Abfall und Zorn. Selbst Woolf, Großbritanniens schicklichste Modernistin und Lieblingszielscheibe männlicher Literaten, die sie niedermachten, um ihre Männlichkeit aufzupolieren, streifte gern durch die hässlichen Ecken von London. Eines Tages im Jahr 1939 verschlug es sie in die Nähe der Southwark Bridge, sie »sah eine Treppe, die zum Fluß hinunterführte. Ich ging sie hinunter – unten ein Seil. Entdeckte das Themseufer, unter den Lagerhallen – übersät mit Steinen, Drahtstücken […] Sehr glitschig; die Lagerhallenmauern verkrustet, voller Unkraut, abgewetzt. Bei Flut müssen sie unter Wasser stehen.«26
Es wäre schön, ja ideal, wenn wir nicht nach Geschlechtern unterteilen müssten – Spaziergänger und Spaziergängerinnen, Flâneure und Flâneusen –, doch die Narrative des Gehens lassen die weiblichen Erfahrungen zu sehr vermissen.27 Sinclair räumt ein, die von ihm bewunderten Arbeiten der tiefen Topografie sähen den Spaziergänger als eine typisch britische Figur: den Naturbeobachter.28 Diese Art der Interaktion mit der Welt interessiert mich nicht sonderlich. Ich mag die bebaute Umgebung, ich mag Städte. Nicht ihre Grenzen oder die Orte, an denen sie zu Nicht-Städten werden. Städte selbst. Ihre Zentren. Ihre vielfältigen Viertel, Bezirke, Gegenden. Und es waren die Stadtzentren, in denen Frauen an Macht gewannen: indem sie sich mitten hineinstürzten und Orte betraten, die nicht für sie vorgesehen waren. Orte, an denen sich andere (Männer) bewegen konnten, ohne Anlass zu einem Kommentar zu geben. Das ist der grenzüberschreitende Akt. Eine Frau braucht nicht in Gore-Tex herumzustapfen, um subversiv zu sein. Sie braucht einfach nur vor die Haustür zu gehen.
+
Fast zwei Jahrzehnte nach diesen ersten Experimenten in der Flâneuserie laufe ich immer noch zu Fuß durch Paris, nachdem ich durch New York, Venedig, Tokio und London gelaufen bin, wo ich, der Arbeit oder der Liebe wegen, vorübergehend gewohnt habe. Es ist eine Gewohnheit, und sie lässt sich schwer ablegen. Warum gehe ich zu Fuß? Weil ich es mag. Ich mag den Rhythmus, ich mag, dass mir mein Schatten auf dem Bürgersteig immer ein kleines Stück voraus ist. Ich mag es, jederzeit stehen bleiben zu können, wenn mir danach ist, mich an eine Hauswand zu lehnen und eine Notiz in mein Tagebuch zu schreiben oder eine E-Mail zu lesen oder eine Nachricht zu verschicken, und dass die Welt währenddessen stillsteht. Paradoxerweise erschafft das Gehen für mich die Möglichkeit des Stillstands.
Gehen ist Kartografieren mit den Füßen. Es hilft, sich die Stadt zusammenzusetzen, Viertel miteinander zu verknüpfen, die sonst separate Entitäten geblieben wären, verschiedene Planeten, die fest, aber über eine große Entfernung miteinander verbunden sind.
Ich mag es, Übergänge zu betrachten und die Grenzen zwischen den Vierteln zu entdecken. Gehen hilft mir, mich zu Hause zu fühlen. Es bereitet mir ein gewisses Vergnügen zu sehen, wie gut ich eine Stadt durch meine Spaziergänge bereits kennengelernt habe; dabei streife ich durch verschiedene Viertel, einige, die ich einmal sehr gut kannte, andere, die ich vielleicht schon länger nicht mehr besucht habe, als würde man jemanden neu kennenlernen, dem man mal auf einer Party begegnet ist.
Manchmal gehe ich spazieren, weil mir etwas im Kopf herumgeht und mir das Gehen hilft, meine Gedanken zu ordnen. Solvitur ambulando, wie man sagt.
Ich gehe, weil es mir ein Gefühl der Verortung verleiht – oder zurückgibt. Der Geograf Yi-Fu Tuan sagt, Räume werden zu Orten, wenn wir ihnen mittels Bewegung eine Bedeutung einschreiben, wenn wir sie als etwas betrachten, das wahrgenommen, erfasst, erfahren werden kann.29
Ich gehe, weil es in gewisser Hinsicht wie lesen ist. Wir bekommen Einblicke in das Leben und die Gespräche anderer Menschen, die nichts mit uns selbst zu tun haben; wir können sie belauschen. Manchmal ist es zu voll, und manchmal sind die Stimmen zu laut. Aber man ist immer in Gesellschaft. Wir sind nicht allein. Wir gehen Seite an Seite mit den Lebenden und den Toten durch die Stadt.
+
Nachdem ich einmal angefangen hatte, nach der Flâneuse Ausschau zu halten, fand ich sie überall.
Ich entdeckte sie an Straßenecken in New York, sah sie aus Türen in Tokio kommen, Kaffee trinken an einem Bistrotisch in Paris, ich sah sie am Fuß einer Brücke in Venedig oder auf einer Fähre in Hongkong.
Sie geht irgendwohin oder kommt von irgendwoher; sie ist der Inbegriff des Dazwischen-Seins.
Vielleicht ist sie Schriftstellerin, vielleicht Künstlerin, vielleicht Sekretärin oder Au-pair-Mädchen. Vielleicht ist sie arbeitslos. Vielleicht arbeitsunfähig. Vielleicht ist sie Ehefrau oder Mutter oder völlig ungebunden. Wenn sie müde ist, nimmt sie vielleicht den Bus oder die Bahn. Aber meistens geht sie zu Fuß. Sie lernt die Stadt kennen, indem sie durch ihre Straßen streift, ihre dunklen Ecken erkundet, hinter Fassaden blickt und in geheime Innenhöfe vordringt. Sie nutzt die Stadt als Bühne und als Versteck, um Ruhm und Reichtum zu finden oder die Anonymität, um sich aus Unterdrückung zu befreien oder anderen Unterdrückten zu helfen, um ihre Unabhängigkeit zu erklären, um die Welt zu verändern oder sich von ihr verändern zu lassen.
Ich habe viele Schnittstellen zwischen ihnen gefunden; diese Frauen haben alle übereinander gelesen und voneinander gelernt, und ihre Lektüre bildet mit der Zeit ein so weit verzweigtes Netz, dass sie sich einer Katalogisierung entzieht. Die Porträts, die ich hier zeichne, belegen, dass die Flâneuse mehr ist als nur ein weiblicher Flâneur, sie steht für sich allein, ist eine beachtenswerte und inspirierende Gestalt.30 Sie geht auf Reisen, sie geht an Orte, die nicht für sie bestimmt sind; sie konfrontiert uns damit, wie die Wörter Zuhause und Zugehörigkeit gegen Frauen verwendet werden. Sie ist ein entschlossenes, kreatives Individuum mit einem tiefen Gespür für das schöpferische Potenzial einer Stadt und die befreiende Kraft eines guten Spaziergangs.
Die Flâneuse existiert, und zwar überall dort, wo wir vorgeschriebene Wege verlassen und uns neue Gebiete erschließen.
Ausfahrt 53 Sunken Meadow Nord, Ausfahrt SM3E, am Friendly’s rechts, bei Northgate links abbiegen
man braucht wirklich ein Auto
LONG ISLANDNEW YORK
New York war meine erste Stadt.
In meiner Kindheit fuhren meine Eltern gelegentlich die eine Stunde von Long Island nach New York, um mit meiner Schwester und mir ins Theater oder in ein Museum zu gehen. Damals, unter Bürgermeister Koch, war manchen Leuten nicht wohl dabei, ihre Kinder mit nach New York zu nehmen. Meine Eltern stammten beide aus den Außenbezirken – der Bronx und Queens – und hatten uns bewusst in denruhigen Vororten am North Shore außerhalb der Stadt aufgezogen. Sie waren Teil eines Mittelschicht-Exodus gewesen, und die Vororte entsprachen eher ihren Bedürfnissen: Meine Mutter mochte das beengte Gefühl allzu naher Nachbarn nicht; mein Vater mochte Boote und Werften. Beides gibt es auf Long Island reichlich, dafür keine Menschen auf der anderen Seite der Wand.
Wenn wir in die Stadt fuhren, wurden meine Eltern nervös und übervorsichtig. Sobald wir aus dem Midtown Tunnel kamen, machte die automatische Türverriegelung schlagartig klack. »Sieh niemandem in die Augen«, sagte meine Mutter jedes Mal, wenn wir zum Times Square kamen. Es waren die 1980er-Jahre, Giulianis großes Aufräumprojekt lag noch ein Jahrzehnt in der Zukunft; der Times Square war noch nicht asphaltiert, immer noch voller Stripclubs und Junkies, und religiöse Fanatiker mit Bärten und Megafonen riefen BRENNEN! IHRWERDETALLEBRENNEN! Aber in meinen Augen ist es heute, überlaufen mit Touristen, die für Fotos posieren, und Jugendlichen, die sich als Schlümpfe und Ninja Turtles verkleiden, sehr viel beängstigender, als ich es damals empfunden habe.
Nach der Highschool durfte ich mich nicht an Unis in der Stadt bewerben. Daher zog ich in den Norden, kurz vor die kanadische Grenze, und fing dort an, Musical zu studieren. Eisiger Wind wehte vom Lake Ontario zu uns herüber, und zu den Kursen mussten wir durch einen halben Meter hohen Schnee stapfen. Wenn meine Eltern zu Besuch kamen, saßen sie in einer meiner Schauspielklassen und sahen sich an, wofür sie mit ihrem Geld bezahlten: Wir mimten das Werfen und Fangen unsichtbarer Tennisbälle. Ein Jahr später, als mir klar wurde, dass ich von meiner Konstitution her nicht für die Bühne gemacht war, wechselte ich an die Columbia University, um Englisch zu studieren. Meine Eltern dankten dem Himmel und sagten keinen Ton gegen die Lage: direkt südlich von Harlem. Von da an habe ich nur noch in großen Städten gelebt.
Ich fühlte mich in den Menschenmengen zu Hause, umgeben von Lärm und Neonleuchten, mit dem Supermarkt unten im Haus, der rund um die Uhr geöffnet hatte, und dem äthiopischen Restaurant um die Ecke, in dem man fantastisches Essen zum Mitnehmen bekam; es war, als wäre ich, kaum dass ich aus dem Haus ging, wirklich Teil dieser Welt, ein gebender und nehmender Teil, und eins mit allen anderen. Es lässt sich schwer in Worte fassen, aber psychologisch betrachtet gab mir die Stadt das Gefühl, auf eine Art für mich sorgen zu können, wie ich es draußen in der Vorstadt nicht gekonnt hatte.
Wenn ich jetzt nach Long Island komme, machen mir die leeren Straßen in der Wohngegend meiner Eltern Angst. Der bloße Anblick eines anderen Fußgängers wirkt deplatziert und bedrohlich. Nach Einbruch der Dunkelheit schaue ich nicht mehr aus dem Fenster, weil ich fürchte, jemanden zu sehen, der sich im Garten herumtreibt und zu mir hereinstarrt. Wenn ich allein zu Hause bin und es klingelt, gehe ich nicht an die Tür, sondern verstecke mich in einem fensterlosen Raum: im Bad oder in der Vorratskammer. Ich weiß, dass das unsoziales, fast schon pathologisches Verhalten ist. Ich bin überzeugt, die Vorstadt ist schuld daran.
+
Der amerikanische Vororttraum wurde in Long Island geboren, als Werk eines Mannes namens William Levitt, der, aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt, riesige Flächen Land in Long Island aufkaufte, um dort ein Haus nach dem anderen für andere heimkehrende Veteranen zu bauen. Die Häuser, die er in Levittown errichtete, waren (und sind) auffallend gleichförmig, immer dieselben eingeschossigen Quader aus vorgestanztem Holz auf Betonfundamenten, mit Dachboden in gleichmäßigem Abstand auf Tausend-Quadratmeter-Grundstücken. Weil sie billig im Bau und billig im Verkauf waren, war das ein erstaunlich erfolgreiches Geschäftsmodell – 1949 wurden 1400 Häuser am Tag verkauft. Ein Levittown-Haus lag irgendwo zwischen 7990 (heute 78 000) und 9950 US-Dollar – und eine Waschmaschine gab es gratis dazu. In den ersten Jahren ihrer Existenz hatten die Levittown-Häuser eine Klausel im Kaufvertrag, die eine Vermietung an Afroamerikaner untersagte.
+
»Die Geschichte von Suburbia«, schreibt Rebecca Solnit, »ist eine Geschichte der Fragmentierung.«1 Davon abgesehen ist es eine Geschichte der Ausgrenzung. Nachdem sie aus den übervölkerten, verschmutzten Industriestädten geflohen sind, leben die meisten Amerikaner heutzutage in Vorstädten (oder in den enormen Vorstadtkonglomeraten, die heute als »exurbs« bezeichnet werden). Sie hofften auf ein Fleckchen Grün, ein bisschen Raum zum Atmen und die Möglichkeit, ihre Kinder an einem, wie man sagte, »anständigen« Ort aufwachsen zu lassen. Doch so überließen sie die verslumenden Städte den Armen und Entrechteten und trugen damit selbst zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate bei, wodurch sie wiederum die Gründe für ihr Fortgehen bestätigt sahen. Es ist die Geschichte des Ausbrechens aus einem vielfältigen Kollektiv, um nur noch unter seinesgleichen zu leben.
Wenn Vorstädter mit ihren Autos und Einfamilienhäusern eine Pufferzone gegen Begegnungen mit dem Fremden und Anderen errichtet haben, ist das zum Teil auch das Ergebnis von Bebauungsplänen, die Städte in zweckgebundene Enklaven untergliedern. Wohn-, Geschäfts- und Industriegebiete sind streng voneinander getrennt, und das bedeutet, dass man alle Strecken mit dem Auto zurücklegt, weil die Umlaufbahn zwischen Arbeit, Heim, Einkaufen und Freizeit immer größer wird. Ursprünglich als Schlafstädte in der Nähe von Eisenbahnstationen angelegt, um einfachen Zugang zu den angebundenen Städten zu bieten, gewannen die Vororte mit der Zeit an Autonomie und entfernten sich immer weiter von den Stadtzentren. Dies ist hauptsächlich die Schuld des Automobils, das in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts das wichtigste Fortbewegungsmittel wurde und ein komplex verschlungenes Straßennetz hervorbrachte, das sich immer enger mit der Landschaft verwob, jede Stadt mit jeder anderen verknüpfte und sie zu einer einzigen wuchernden Masse verschwimmen ließ, deren Bestandteile sich untereinander nicht mehr ohne Weiteres zu Fuß erreichen ließen.
Dass Vorstädte heute so aussehen, wie sie aussehen, ist auf den Versuch zurückzuführen, sie am Autoverkehr auszurichten. Ein Stadtplaner, der diese neue Art von Verkehr durch die Wohngebiete schleusen musste, entwickelte 1929 die Idee, das Rasterlayout der Metropolen durch gewundene Vorortstraßen zu ersetzen. An diesen Binnenstraßen wurden Wohnviertel angelegt, miteinander verbunden durch Ausfallstraßen, an denen sich sämtliche Geschäfts- und Gewerbeangebote fanden, die der Ort brauchte. Die »Nachbarschaft« wurde zu einem Schlagwort für einen fast schon utopischen Lebensstil, in dem Nachbarn sich einander verbunden fühlten und in dem man ohne Gefährdung durch den Straßenverkehr zu Fuß zur Schule und zur Arbeit gehen konnte. Die Realität der Vororte hat sich anders entwickelt.
Wenn man alle Wege mit dem Auto zurücklegt, führt das letztlich nur dazu, dass die Einwohner zur Arbeit und Freizeitgestaltung weite Strecken fahren, was garantiert nicht zur Entwicklung eines lokalen Zusammenhalts beiträgt. Mit dem Aufkommen der privaten Unterhaltungselektronik wie dem Radio und später dem Fernsehen zogen sich Familien in ihre behagliche Privatsphäre zurück, und die Einheit des Wohngebiets wurde weiter untergraben. Leider dienten diese in sich geschlossenen Anlagen bald als Vorwand für scheußliche Beispiele ethnischer und sozialer Segregation. Wir hatten keine Gelegenheit zu sehen, wie andere Menschen lebten, unser einziger Zugang zur Außenwelt war der Fernseher, und dessen Bildschirm zeigte uns Visionen von weißen Vorstadtfamilien, die sich kaum von unseren eigenen unterschieden.
Die Vorbilder, die unsere Kultur lieferte, waren ohne Autos nicht denkbar. Die Fernsehserien der Achtziger und frühen Neunziger handelten hauptsächlich von weißen Vorstadtfamilien. Die Bill Cosby Show – eine der wenigen Ausnahmen – spielte in New York, doch die Kulisse hatte mit einem echten Häuserblock in der Stadt nicht viel mehr zu tun als die aus der Sesamstraße. Selbst in Full House, das in San Francisco spielt, sieht man die Familie im Auto (einem ambitionierten roten Cabriolet) über die Golden Gate Bridge fahren. Filme begannen in Vororten, gelegentliche Ausflüge in die große, böse Stadt entpuppten sich als gewaltige Abenteuer (Ferris macht blau, Die Nacht der Abenteuer), und am Schluss waren alle wieder wohlbehalten zu Hause in ihren riesigen Kolonien.
In vielen Vororten gibt es keine Gehwege.
Wenn meine Eltern mit dem Auto unterwegs sind, mache ich mir Sorgen und beende unsere Telefongespräche mit Fahrt vorsichtig statt mit Ich hab euch lieb.2 Sie fahren überall mit dem Auto hin. Freunde von ihnen wohnen gerade mal ein paar Straßen weiter, fünf Minuten zu Fuß, maximal sieben, aber sie besuchen sie mit dem Auto. Für Menschen, die nicht in Vororten wohnen, ist das schwer zu verstehen, aber ich würde nichtwollen, dass meine Eltern zu Fuß gehen. Tagsüber wäre es okay, aber die Straße ist kurvig und hügelig und schlecht beleuchtet; die Autofahrer rechnen nicht mit Fußgängern auf der gehweglosen Fahrbahn. Es ist irritierend, jemanden zu Fuß gehen zu sehen, der nicht entweder einen Hund dabeihat oder einen Jogginganzug trägt. Ganz besonders ungewöhnlich ist der Anblick eines Fußgängers an den Ein- und Ausfallstraßen, an denen die Geschäfte liegen. Wer kein Auto besitzt, gehört einer speziellen Art von Vorstadt-Unterschicht an, einer Kaste von Unberührbaren, die nur dann sichtbar werden, wenn sie deplatziert sind – zum Beispiel zu Fuß auf einer Straße, auf der alle anderen mit dem Auto fahren.3
+
Meine Eltern gehörten zu den dreizehn Millionen Menschen, die in den 1970er-Jahren aus der Stadt aufs Land zogen. Dieser Exodus zog einen Verfall der Städte nach sich, auch weil die Arbeitsplätze den Mittelschichtlern hinaus in die Vororte folgten. »Schon 1942 zog AT&T BellTelephone Laboratories von Manhattan auf einen 213 Acre großen Campus in Murray Hill in New Jersey, der mehr Platz und Ruhe bot sowie die anmutig geschwungenen Straßen und das ländliche Gefühl blühender Vorortviertel«, erklärt Leigh Gallagher in ihrem Buch über Vororte. »Doch in den 70ern begann eine Abwanderung von Blue-Chip-Unternehmen aus den Städten, die sich über Jahrzehnte fortsetzen sollte: IBM zog von New York City nach Armonk, New York, GE nach Fairfield, Connecticut, Motorola von Chicago nach Schaumburg, Illinois. Bis 1981 befand sich die Hälfte der Büroflächen außerhalb der Stadtkerne. Ende der 1990er belief sich der Anteil auf zwei Drittel.«4
Damit baute mein Vater sein Architekturbüro auf: Er entwarf Firmenzentralen aus Stahl und Glas für die Unternehmen an den Ein- und Ausfallstraßen des Long Island Expressways. Sein großes Vorbild war der deutsche Architekt Mies van der Rohe, weil dessen Gebäude zweckmäßig, symmetrisch, klar und schlicht waren. In diesem Sinne entwarf mein Vater einige der schöneren Bauwerke auf Long Island, viele davon Gewerbe- oder Industriebauten, deren Form, Raum und Nutzung sorgfältig aufeinander abgestimmt waren. Im Rahmen seiner Möglichkeiten tat er alles, um die Landschaft nicht zu verunstalten – und gewann für seine Entwürfe sogar einige Preise –, doch die Zahlungsbereitschaft seiner Kunden setzte ihm enge Grenzen. Am stolzesten ist er, abgesehen vom ansprechenden Äußeren seiner Häuser, darauf, dass sie funktionieren. Es regnet nicht rein, und sie fallen nicht in sich zusammen. Es ist verblüffend, von wie wenigen Gebäuden sich das sagen lässt.
Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der ich nicht über Häuser, Räume und ihre Bedeutung nachgedacht hätte. Als Kind maß ich meine Größe an zusammengerollten Bauplänen; die Werkzeuge meines Vaters waren mein Spielzeug: Zeichentische, Geodreiecke, Kompasse, Buntstifte. Mein Vater brachte mir bei, meine Umgebung bewusst wahrzunehmen. Vielleicht habe ich mich auf Long Island deshalb nie wohlgefühlt. Ich komme nicht aus einer Stadt wie Northport, Huntington oder Port Jefferson mit ihren idyllischen Schindelhäusern und historischen Hauptstraßen, an denen sich Herrenausstatter an Fischerkneipen reihen. Wir lebten zwei Meilen südlich von solchen Städten, aber schon diese geringe Entfernung macht viel aus. Unsere Stadt ist ein Koagulat an der Jericho Turnpike, einer sechsspurigen Hauptstraße, an der sich eine Ladenzeile an die nächste reiht: zweckmäßige Scheußlichkeiten, die in den 70er- und 80er-Jahren möglichst billig hochgezogen worden waren. Neben Autowerkstätten, Autohändlern und Tankstellen (einfach alles fürs Auto) beherbergen sie Tattoo-Studios, längst geschlossene Chinarestaurants, Haven Pools, Crazy Diamond, ein Geschäft, in dem man Waffenscheine bekommt, Dix Hills Diner und einen sieben Tage die Woche geöffneten Hundesalon. Im Osten und Westen gelangt man zu flachbedachten Garagen mit Telefonleitungen, die sich unter einem tiefhängenden Himmel von Mast zu Mast ziehen: einsame Backsteingebäude inmitten von Asphalt, wo SUVs und Familienkutschen ein- und ausfahren; Satteldach-Attrappen: das blaue IHOP-Dach und das rote Friendly’s-Dach, Betonklötze, die mit serifenlosen Schriftzügen für MÖBEL, HANDWÄSCHE, BILLARD, DROGERIE werben. Ich weiß genau, wie es im Inneren dieser Bank sein wird: der Geruch von Teppichboden, Neonlicht, Resopaltische und Drehstühle.
+
+
Es ist nicht schön, aber es ist zu Hause.
+
Diese Häuser beherbergen kleinere Gewerbe, allerdings nur notdürftig, etwa wie Luftschutzbunker. Man geht hinein, erledigt, was zu erledigen ist, und geht wieder hinaus. Das ist zermürbend für die Menschen, die darin arbeiten, und ein tägliches Elend für jene, die sie aufsuchen, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Marc Augé nennt solche Bauten »Nicht-Orte«, und leider sind sie die prägenden Raumformen im Amerika des späten zwanzigsten – und allem Anschein nach auch des einundzwanzigsten – Jahrhunderts.
Unsere Bauwerke reflektieren nicht nur, wer wir sind, sie bedingen auch, wer wir sein werden. »Eine Stadt ist so etwas wie ein Versuch kollektiver Unsterblichkeit«, schrieb Marshall Berman in einem Essay über den Untergang der Stadt: »Wir selbst sterben, doch wir hoffen, dass die Formen und Strukturen unserer Stadt fortbestehen.«5 In Vorstädten ist das Gegenteil der Fall: Sie haben keine Geschichte und keine Vorstellung von der Zukunft. Nur sehr wenig hier ist auf Beständigkeit ausgelegt.6 Für eine Zivilisation, die in einer permanenten, niemals endenden Gegenwart lebt und sich um Zukunft und Vergangenheit ebenso wenig sorgt wie ein Kind, ist die Nachwelt nicht von Belang. Lewis Mumford beschreibt in seiner Studie Die Stadt. Geschichte und Ausblick aus dem Jahr 1961 die Naivität der Vorstädte, die bei ihren Einwohnern »eine kindliche Perspektive auf die Welt« und eine Illusion von Sicherheit, wenn nicht sogar eine regelrechte politische Apathie aufrechterhält.7